|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Aach
(Hegau) (Kreis Konstanz)
Jüdische Geschichte
Übersicht:
Zur jüdischen Geschichte
in Aach
In Aach bestand eine jüdische Gemeinde im 16. und
Anfang des 17. Jahrhunderts. Erstmals werden 1494 zwei jüdische Familien genannt (darunter Löwman
Jud zu Aach, genannt 1496 im Fürstenberger Urkundenbuch Bd VII Urk. 18,22) genannt. 1518 werden die Juden von Geisingen beschuldigt,
ein
christliches Kind ermordet zu haben; in diesem Zusammenhang werden auch Juden in
Aach (und Stockach) genannt. Eine weitere Erwähnung eines jüdischen Kaufmanns aus Aach liegt
von 1522 vor. 1540 waren vier jüdische Familien (1543/1554 wird genannt: Jud
Secklin von Aach, 1549 Jud Essaias von Aach), 1551 fünf jüdische Familien am Ort
(1555/64 Abraham Jud zu Tettnang bzw. Aach). Die höchste Zahl jüdischer Bewohner wird um 1583 mit 10 jüdischen
Familien in Aach erreicht. Ihren Lebensunterhalt verdienten die Aacher Juden vor
allem durch Geldverleih, aber wohl auch durch Handel mit Waren aller Art. 1570 wanderte Jud Jacob von Aach nach Kandern (heute
Kreis Lörrach) aus. 1608 ist der letzte jüdische Bewohner aus Aach weggezogen,
nachdem bereits 1604 die meisten ausgewiesen worden waren.
Beim letzten Aacher Juden dürfte es sich um Jäckle Jud gehandelt haben,
dessen Haus neben der Pfarrkirche mit Hofraite, Stallungen usw. der Aacher
Bürger Hans Niklaus Keller am 26. Februar 1608 erwarb. Von Jäckle Jud hieß es
damals: "wohnhaft zu Hanau und seßhaft zu Aach". Im Zusammenhang mit dem Verkauf
wird auch Mayerle Jud, der Sohn von Jäckle Jud genannt (Weiteres im Beitrag von
S. Krezdorn s.Lit.).
Einrichtungen der
jüdischen Gemeinde
Wohngebiet und Betsaal/Synagoge.
Die jüdischen Häuser lagen teilweise in der Stadt, teilweise außerhalb.
Möglicherweise befanden sich einige davon in der bis heute so genannten Flur "Judenloch"
nordwestlich der Stadt. Auch unmittelbar nördlich der Stadtmauer am Weg entlang
zum Buchbühl könnte - oberhalb der Flur "Judenloch" - eine jüdische Ansiedlung
gewesen sein.
Der Betsaal befand sich in dem 'Haus beim (unteren) Stadttor'. Hier
wohnte auch der 1581 genannte 'Judenschulmeister" Isaak Jud (genannt in
der Güterbeschreibung der beiden Kirchen). In den ersten Schutzbriefen war den
jüdischen Familien das Abhalten ihrer Gottesdienste ohne Einschränkung genehmigt
worden. Der Schutzbrief von 1583, der nur noch fünf und nicht wie bisher zehn
Jahre gelten sollte, war allerdings voller Restriktionen (§ 6): 'obwohl den
Juden zu Aach bisher ihre Versammlungen zu Vollbringung ihres Gebets und
Gesangs, wie auch Schul und Schulmeister gestattet worden, so sollen sie doch
fürohin sich ihres Gesangs gänzlich enthalten, auch einige Schul noch
Schulmeister nicht mehr halten, und da sie dawider thun, sollen sie nach
Gelegenheit ihres Verbrechens, von unsern Amtsleuten ohne Gnad gestraft werden".
Diese Einschränkungen gehörten zum Beginn einer Entwicklung, die mit der
Ausweisung der Juden 20 Jahre später (1604) endete.
M. Merian: Topographia Sueviae Frankfurt 1643 S. 4 schreibt zu Aach: "und
daselbst, wie Laterus de Censu p. 1057 schreibt, im Jahr 1604 die Juden
auf Befelch H. Ertzherzogs Maximilians von Österreich verjagt worden seien".
Weitere Einrichtungen der jüdischen Gemeinde
Ein jüdischer Friedhof befand sich auf der Flur (heute Waldgebiet) "Hohenhalden".
Die genaue Lage ist unbekannt.
Fotos / Karte
(Quelle: Fotos: sw-Fotos Hahn um 1985; Karte: Stadt Aach;
Farbfoto: Wikimedia Commons Artikel Aach (Hegau))
Flurkarte der Stadt Aach
(um 1980) |
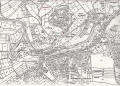 |
|
| |
Mit rot markiert: Die
Flur "Judenloch" und das
"Haus beim unteren Stadttor" (siehe unten) |
|
| |
|
|
Das untere Stadttor
mit dem
"Haus beim unteren Stadttor" |
 |

 |
| |
Links: Blick
auf Aach; in der Mitte des Fotos ist das untere Stadttor zu sehen; im Haus
beim unteren Stadttor (rechte Fotos) befand sich der Betsaal der jüdischen
Gemeinde; hier wohnte auch der "Judenschulmeister" |
| |
|
|
| "Judenloch" und "Hohenhalden"
|
 |
 |
| |
Das "Judenloch" ist
heute ein Acker
unterhalb der Stadt |
Im Waldgebiet "Hohenhalden"
soll der
jüdische Friedhof gelegen haben |
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Germania Judaica III,1 S. 1; III,1 Art. Aach.
|
 | Leopold Löwenstein: Zur Geschichte der Juden in
Großherzogtum Baden. In: Zeitschrift für die Geschichte des Judentums Bd. II
1888 S. 383-188;
III 1889 S. 74-77 (der zweite Beitrag ist eingestellt als pdf-Datei).
|
 | August Mayer: Aus der Geschichte der Stadt Aach im
Hegau. Bonndorf 1911. S. 20. |
 | Gert Leiber: Das Landgericht der Baar, Verfassung
und Verfahren zwischen Reichs- und Landesrecht 1283-1632. 1964 S. 208ff. |
 | Beitrag "Die Kirchen der Stadt Aach, insbesondere ihre
Güter, Stiftungen und Einkünfte im 16. Jahrhundert. In: Hegau. Zeitschrift
für Geschichte, Volkskunde und Naturgeschichte des Gebietes zwischen Rhein,
Donau und Bodensee. 1967. S. 264 wird aus dem Jahr 1581 berichtet über
"Isaac Jud, Judenschulmeister, vom Haus am Tor, so er derzeit innehat".
|
 | Siegfried Krezdorn: Die Familie Keller von
Schleitheim in Aach/Hegau. In: Hegau. Zeitschrift für Geschichte, Volkskunde
und Naturgeschichte des Gebietes zwischen Rhein, Donau und Bodensee 22.
Jahrgang Heft 34 1977 ab S. 7. S. 19 wird in diesem Beitrag von dem
Erwerb des Hauses von Jäckle Jud 1608 berichtet. |
 | Franz Götz (Hg.): Aach. 700 Jahre Stadt -
1283-1983. 1983. S. 48-49. |
 | Karl Heinz Burmeister: Spuren jüdischer Geschichte
und Kultur in der Grafschaft Montfort. (= Veröffentlichungen des Museums
Langenargen). Sigmaringen 1994. |
 | Englisch: Richard Gottheil: Artikel Aach in Jewish
Encyclopedia.
Online zugänglich. |
 | Daniel Bauerfeld / Lukas Clemens (Hrsg.):
Gesellschaftliche Umbrüche und religiöse Netzwerke. Analysen von der Antike
bis zur Gegenwart. Bielefeld 2014. Innerhalb des Beitrages von Kathrin
Geldermans-Jörg: Schreiben, sag, berichte, antwort. Kommunikationswege und
soziale Netzwerke am Beispiel des Waldkircher Ritualmordverfahrens
(1504/05). S. 173-206. zu Aach insbesondere ab S. 186. |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|