|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Oberdischingen (Alb-Donau-Kreis)
Jüdische Geschichte
(Seite wurde erstellt unter Mitarbeit von Rolf
Hofmann, Stuttgart)
Übersicht:
Zur Geschichte jüdischer
Einwohner
In Oberdischingen lebte seit 1851 die Familie Friedrich
Kaulla. Kaulla, der aus einer Stuttgarter jüdischen Bankiersfamilie
entstammte (Familie ursprünglich aus Hechingen, wo Friedrich 1807 noch geboren
ist), hatte das "Rittergut
Oberdischingen" von Ludwig Anton Reichsgraf Schenk von Castell (1802-1876)
ersteigert und nannte sich seitdem "Rittergutsbesitzer". Das
Hauptgebäude des Rittergutes war der Kavalierbau des früheren Schlosses des
Reichsgrafen Franz Ludwig Schenk von Castell (genannt der "Malefiz-Schenk", geb.
1736), das 1807 abgebrannt ist. Der erhalten gebliebene Kavalierbau (1969
abgebrannt, 1974 zum Altenheim St. Hildegard aufgebaut) befindet
sich an der Nordwestecke des Schlossparkes. Bis 1900 blieb das Anwesen im Besitz der Familie Kaulla, danach wurde es von
Franz Fugger von Kirchberg-Weißenhorn erworben (seitdem wurde das Gebäude auch
"Fugger-Schlösschen" genannt). 1929 übernahm die Vereinigung
der Steyler Missionsschwestern das Schlossgut und den Park und nutzte das
Gebäude zusammen mit einem Neubau als Kloster und Altersheim, bis die
Schwestern später
nach Laupheim umgezogen sind. 1995 übernahm der Deutsche Orden (DOH) das
Anwesen von den Steyler Missionsschwestern und betreibt seitdem das Altenheim
(Altenheim St. Hildegard), wiederum mit Neubauten. Im ehemaligen Kavalierbau
bzw. Kanzleigebäude aus dem Jahr 1767 befindet sich heute das Rathaus der
Gemeinde, ein Gemeindehaus und ein Vereinsheim.
Zur Person und Familie: Friedrich Kaulla war ein Sohn von Wolf
von Kaulla und seiner Frau Eva geb. Bing. Er ist in Stuttgart 1807 geboren und
war seit 5. Dezember 1837 verheiratet mit Louise (Luise) geb. Pfeiffer, eine 1820
geborene Tochter von Marx Pfeiffer und seiner (zweiten) Frau Dorothea (Tolz) geb.
Kaulla (Tochter von Wolf von Kaulla und Eva geb. Kaulla).
Die beiden hatten fünf Kinder: Eva Dorothea Kaulla (1841 Stuttgart - 1924
Darmstadt, war verheiratet mit Wilhelm Hohenemser, Bankier in Frankfurt, 1828
-1897), Wilhelm Benjamin Kaulla (1842 Stuttgart - 1843),
Paula Luise Friederika Mathilda Kaulla (1843 Stuttgart - ?, war verheiratet
mit Oskar von Sarwey, Ludwigsburg, 1837-1912), Herrmann Michael Kaulla (1844 -1882,
war verheiratet mit Eugenie Jenny geb. Mayer; siehe zum Tod von Herrmann den Presseartikel unten) und
Clara Maria Catharina Kaulla (1845-1911 Weimar, beigesetzt in Ulm; war
verheiratet mit Ludwig Heinrich Ebers aus Berlin). Louise Kaulla geb. Pfeiffer
starb 1888; Friedrich von Kaulla starb - drei Jahre nach seiner Konversion zum
Protestantismus - 1895 (siehe unten).
Vgl. Rolf Hofmann:
Family Sheet Friedrich Kaulla of Stuttgart + Oberdischingen
(pdf-Datei) und
Zusammenstellung: Vorfahren und Bruder von Friedrich Kaulla
(pdf-Datei)
Friedrich Kaulla versuchte 1861 und 1891/92 nochmals, in den erblichen Adel
erhoben zu werden, jedoch ohne Erfolg. Er wurde darauf hingewiesen, dass noch
keinem Juden in Württemberg diese Ehre zuteil geworden sei (bislang war an
Juden nur der persönliche Adel vergeben worden). Auch wenn die Kommission für
die Adelsmatrikel bereits 1861 festgestellt hatte, dass die jüdische
Religionszugehörigkeit auf Grund der Gleichstellung durch das württembergische
Israelitengesetzt von 1828 kein generelles Hindernis für eine Nobilitierung
sei, änderte sich bei dieser Einstellung nichts bis zum Ende der Monarchie in
Württemberg.
Quelle: Kai Drewes: Jüdischer Adel. Nobilitierungen von Juden im Europa des 19.
Jahrhunderts. Campus Verlag 2013.
Friedrich Kaulla übernahm außer dem Rittergut auch eine 1872 gegründete Brauerei am Ort (1898
Gutsherrschaftliche Bierbrauerei Friedrich Kaulla, 1920 Gräfliche von
Fuggersche Brauerei Friedrich Kaulla). Die Schlossbrauerei (abgebrochen 1922)
lieferte das beste Bier des Oberlandes. Von Oberdischingen aus erwarb Friedrich
Kaulla auch einige Liegenschaften in der Umgebung wie das große Barockhaus
("Neues Haus") in Schelklingen an der Ecke Bemmelberger- und
Stadtschreibergasse. Dieses Gebäude hatte 1853 Friedrich Kaulla von Graf Franz
Ludwig Schenk von Castell erworben. Auch sonst hinterließ Friedrich Kaulla
einige bemerkenswerte Spuren in Oberdischingen und Umgebung. So kam seine 30 bis
35 Kästen umfassende Sammlung von Tierpräparaten 1891 an das Ehinger Gymnasium
und von dort in das Ehinger Museum, wo sie heute noch zu den Besonderheiten der
Exponate gehören.
Vgl. Artikel von Julia-Maria Bammes in der Südwestpresse vom 27.12.2014:
"Ehingen.
Affe trifft auf Eule: Ungewöhnliche Sammlung im Museum..."
und Artikel von Julia-Maria Bammes in der Südwestpresse vom 8.4.2015: "Seltene
Tiere im Museum..."
Friedrich Kaulla war in Oberdischingen zu seinen Lebzeiten hoch angesehen. Er
hatte nach Berichten ein gutes Verhältnis zum damaligen Schullehrer Rupert
Brechenmacher, mit
dem er öfters zusammen musizierte. Der Lehrer spielte auf der Violine,
Friedrich Kaulla auf dem Flügel. Er war sehr an Musik interessiert, hat
wohl auch komponiert. Im Hauptstaatsarchiv Stuttgart finden sich einige
Erinnerungsstücke, u.a. ein Verzeichnis der Ehrungen für Friedrich Kaulla und
das Testament von ihm und seiner Gattin Louise Kaulla geb. Pfeiffer vom
23.4.1895.
(Findbuch J 50 1.38 https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=23078&klassi=001.039&anzeigeKlassi=001.039.002)
.
Siehe auch die Lebenserinnerungen des Lehrers Josef Karlmann Brechenmacher https://www.gwrs-oberdischingen.de/unsere-schule/unsere-schule-rückblick/j-k-brechenmacher/
(Quelle: Werner Kreitmeier, Museumsverein Oberdischingen)
Die Familiengruft der Bankiersfamilie Kaulla auf dem Friedhof in Oberdischingen wurde
1882 nach dem Tod von Hermann Kaulla über dessen Grab erbaut. Sie wurde 1951
von der Gemeinde Oberdischingen restauriert, jedoch 1976 abgebrochen / zerstört,
nachdem sich Verwitterungsspuren am weichen Buntsandstein zeigten und die
Gemeinde Oberdischingen eine Finanzierung der Instandsetzung scheute. Zwei
Grabplatten (für Luise Kaulla geb. Pfeiffer und ihren Sohn Hermann Michael
Kaulla) konnten gerettet werden; sie wurden 1990 in die Mauer des jüdischen
Friedhofes in Laupheim
eingelassen (Friedhofsnordmauer). Auf seiner Grabplatte hat Friedrich Kaulla seine Titel und
Auszeichnungen vermerken lassen: "...Herr Friedrich Kaulla
Rittergutsbesitzer Ritter des kgl. württ. Kronordens, des kgl. preuss.
Kronordens, des kgl. württ. Olga-Ordens, Inhaber der Kriegsgedenkmünze für
Nichtkombattanten u. der silbernen Jubiläums Medaille". Bei seiner Frau:
"... Frau Luise Kaulla geb. Pfeiffer ... Inhaberin des kgl. württb.
Olgaordens, des kgl. preuß. Luisenordens und der Kriegsgedenkmünze
1870/71".
Zusätzlicher Hinweis zur Geschichte von Friedrich Kaulla: Vor
seiner Zeit in Oberdischingen hatte Friedrich Kaulla 1836 bereits den Teurershof
bei Schwäbisch Hall (mit einer Fläche von 600 bis 700 Morgen) übernommen
und ihn bis 1856 durch Einführung neuer Produktionsmethoden und Produkte
vorbildlich geführt. Er baute hier nach zeitgenössischen Berichten "eines
der schönsten Hofgüter des Landes" auf (vgl. Oberamtsbeschreibung von
Hall von 1847). Nachdem er 1851 nach Oberdischingen gezogen ist, übertrug
Kaulla die Führung des Hofes einem Verwalter.
Der Teurershof war einer der ältesten und bedeutendsten Gutshöfe im Bereich
der Stadt Schwäbisch Hall. Im Mittelalter war er im Besitz führender Haller
Adelsgeschlechter, von 1479 bis 1836 Haller Spitalbesitz. Heute ist der
Teurershof als Kulturdenkmal gem. § 2 des Denkmalschutzgesetzes unter Schutz.
U.a. ist noch das Wohnhaus erhalten aus der Zeit, als der Hof Haller
Spitalbesitz war und einige andere Gebäude. Die Grundstücke des Teurerhofes
sind großenteils überbaut (Bereich "Zukunftswerk Teurershof e.V. Freie
Walddorfschule Schwäbisch Hall e.V.", "Wohn- und Pflegestift
Teurershof" u.a.m.). An Friedrich Kaulla erinnert im Bereich des
Teurerhofes der "Kaullaweg".
Familien-Begräbnisstätte der Familie Steiner:
auf einem Waldfriedhof bei Oberdischingen befindet sich die Familien-Begräbnisstätte
der Familie Kilian Steiner. Kilian Steiner selbst ließ sich nach seinem Tod am
25. September 1903 einäschern
und zunächst in Niedernau bestatten; die Nachkommen waren getaufte Christen. Bei der
Familiengrabstätte handelt es sich nicht um einen jüdischen Friedhof (siehe
Fotos unten).
Berichte zur
Geschichte jüdischer Einwohner
Berichte aus der Familie Kaulla
Ordensverleihung für Rittergutsbesitzer Friedrich Kaulla
in Oberdischingen (1871)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Oktober 1871:
"Stuttgart, im September (1871). Aus Anlass des 25-jährigen
Ehejubiläums des Königspaares bringt der Staatsanzeiger
Ordensverleihungen, unter welchen sich vier Israeliten befinden:
Rittergutsbesitzer Friedrich Kaulla in Oberdischingen, Hofrat Albert
Kaulla in Stuttgart, Dr. med. Steiner in Stuttgart und Konsul Hofrat
Pfeiffer in Wien; ersterer wurde mit dem Kronenorden, die beiden anderen
mit dem Friedrichs- und letzterer mit dem Olgaorden
dekoriert." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Oktober 1871:
"Stuttgart, im September (1871). Aus Anlass des 25-jährigen
Ehejubiläums des Königspaares bringt der Staatsanzeiger
Ordensverleihungen, unter welchen sich vier Israeliten befinden:
Rittergutsbesitzer Friedrich Kaulla in Oberdischingen, Hofrat Albert
Kaulla in Stuttgart, Dr. med. Steiner in Stuttgart und Konsul Hofrat
Pfeiffer in Wien; ersterer wurde mit dem Kronenorden, die beiden anderen
mit dem Friedrichs- und letzterer mit dem Olgaorden
dekoriert." |
Zum Tod von Hermann Kaulla, Sohn von Rittergutsbesitzer Friedrich Kaulla, und Beisetzung in Oberdischingen (1882)
Hinweis: Im Artikel wird versehentlich der Familie der Adel
zugeschrieben.
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. April 1882:
"Württemberg. Der Staatsanzeiger vom 25. März bringt nachstehendes
Kuriosum: Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. April 1882:
"Württemberg. Der Staatsanzeiger vom 25. März bringt nachstehendes
Kuriosum:
Ulm, 23. März (1882). Am 16. dieses Monats verstarb zu Meran
mit Hinterlassung einer jungen Witwe Herr Hermann von Kaulla von
Oberdischingen. Die sterblichen Reste wurden in die Heimat verbracht, um
zu Laupheim, woselbst der Verblichene der israelitischen Gemeinde
angehört hatte, bestattet zu werden. Die Einwohner Oberdischingens aber,
welche der Familie und namentlich dem Vater des Verstorbenen,
Rittergutsbesitzer Friedrich von Kaulla, sehr anhänglich gesinnt sind und
an dem großen Unglück, das so schöne Hoffnungen zerstört hat, wärmsten
Anteil nehmen, baten darum, dass der Verblichene, der allseitig beliebt
war, in ihrer Mitte ruhen möge. Das katholische Pfarramt gab
bereitwilligst seine Zustimmung und so erfolgte am Dienstag auf dem
Friedhof zu Oberdischingen unter großer Teilnahme des Ortes und der
Umgegend die Beisetzung. Es ist dies ein erfreuliches Zeichen von Toleranz
in einer Zeit, wo konfessionelle Unterschiede zur allzu häufig zur
Ursache oder zum Vorwand von Unfrieden und Hetzereien genommen
werden.
Es wäre doch interessant zu erfahren, ob keine Anverwandten und
Glaubensgenossen bei der Beerdigung anwesend waren, wer die Leiche rituell
behandelte und einkleidete, welcher Geistliche als Redner dabei
funktionierte und ob der Verstorbene ein Reihen- oder ein Familiengrab
erhalten hat. (Siehe die Antwort unter Artikel 'Laupheim'. - Red.). |
Zur Beisetzung von Hermann von Kaulla durch Rabbiner Dr. Ludwig Kahn in Oberdischingen
(1882)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. April
1882: ""Württemberg. Der Staatsanzeiger vom 25. März bringt nachstehendes
Kuriosum: Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. April
1882: ""Württemberg. Der Staatsanzeiger vom 25. März bringt nachstehendes
Kuriosum:
Ulm, 23. März (1882). Am 16. dieses Monats verstarb zu Meran
mit Hinterlassung einer jungen Witwe Herr Hermann von Kaulla von
Oberdischingen. Die sterblichen Reste wurden in die Heimat verbracht, um
zu Laupheim, woselbst der Verblichene der israelitischen Gemeinde
angehört hatte, bestattet zu werden. Die Einwohner Oberdischingens aber,
welche der Familie und namentlich dem Vater des Verstorbenen,
Rittergutsbesitzer Friedrich von Kaulla, sehr anhänglich gesinnt sind und
an dem großen Unglück, das so schöne Hoffnungen zerstört hat, wärmsten
Anteil nehmen, baten darum, dass der Verblichene, der allseitig beliebt
war, in ihrer Mitte ruhen möge. Das katholische Pfarramt gab
bereitwilligst seine Zustimmung und so erfolgte am Dienstag auf dem
Friedhof zu Oberdischingen unter großer Teilnahme des Ortes und der
Umgegend die Beisetzung. Es ist dies ein erfreuliches Zeichen von Toleranz
in einer Zeit, wo konfessionelle Unterschiede zur allzu häufig zur
Ursache oder zum Vorwand von Unfrieden und Hetzereien genommen
werden.
Es wäre doch interessant zu erfahren, ob keine Anverwandten und
Glaubensgenossen bei der Beerdigung anwesend waren, wer die Leiche rituell
behandelte und einkleidete, welcher Geistliche als Redner dabei
funktionierte und ob der Verstorbene ein Reihen- oder ein Familiengrab
erhalten hat. (Siehe die Antwort unter Artikel 'Laupheim'. - Red.)..
"Laupheim. (Württemberg). Hermann von Kaulla, Sohn des Herrn
Friedrich von Kaulla, Rittergutsbesitzer zu Oberdischingen, unweit hier,
starb am 17. März in Meran (Südtirol), wohin er sich zur
Wiederherstellung seiner gefährdeten Gesundheit begeben, im Alter von 37
Jahren, nachdem er kaum 18 Monate verheiratet war. Nach dem Tode des
Sohnes telegraphierte der bei ihm weilende Vater hierher an Herrn Dr.
Rödelheimer, Oberamtsarzt, dass die Leiche nach Laupheim verbracht werde,
um sie auf dem israelitischen Friedhofe (in Oberdischingen wohnen keine
Israeliten) beisetzen zu lassen.
Auf diese Nachricht hin wurden alle möglichen Anordnungen getroffen, um
dem Verstorbenen einen würdigen Empfang und ein standesgemäßen
Grabgeleite zu bereiten, umso mehr, da er ungefähr vor einem Viertel
Jahre in die hiesige israelitische Gemeinde sich eingekauft.
Doch da Herr von Kaulla vor dem Toten in die Heimat zurückgekommen war,
wurde der Sache eine andere Wendung gegeben. Wie Abraham zu den Kindern Chet
(= Hetiter), als er diese um eine Begräbnisstätte für seine
verstorbene Sara anging, sprach er zu dem Gemeinderate von Oberdischingen:
gebet mir zum Besitztum ein Begräbnis bei euch, dass ich begrabe meine
Leiche, mir aus dem Gesichte' (1. Mose 23,4) und als darauf in
entgegenkommender Weise der Gemeinderat antwortete: 'in der auserlesensten
unserer Grabstätten begrabe deine Leiche' wurde am 20. März, am
Dienstag, dem 1. Nissan - der junge Herr Kaulla auf dem katholischen
Kirchhofe zu Oberdischingen in den kühlen Schoß der Mutter Erde gebettet
und zwar, was die Hauptsache ist, unter Leitung des hiesigen Herrn
Rabbiner Kahn. Er hielt, unbeachtet seines Amtes, wie gewöhnlich
auf dem Gottesacker die Grabrede und sprach darauf das Kaddisch-Gebet.
Über diese in den Annalen Laupheims Epoche machende Handlungsweise des
Herr Rabbiners sind die Ansichten geteilt. Ein Häuflein der Kinder der
Reform, speziell die Schleppträger des Herrn Rabbinen, erblicken in dem
Vorgehen einen Akt der höchsten, lobenswürdigsten Toleranz, dagegen alle
Übrigen, unter denen viele, die auch dem Zeitgeiste huldigen, erklären
die rabbinische Handlungsweise als eine wahrhaft
antijüdische." |
Im Druck erschienen sind: Rabbiner Dr.
Ludwig Kahn: Worte, gesprochen am Grabe des seligen Herrn Hermann Kaulla
zu Oberdischingen. Ehingen 1882.
und ders.: Erinnerung an die selige Frau Louise Kaulla geb. Pfeiffer,
Gattin des Rittergutsbesitzers Fr. Kaulla zu Oberdischingen. Ehingen 1888.
Link |
Auszeichnung für Rittergutsbesitzer Friedrich Kaulla
in Oberdischingen (1891)
 Mitteilung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. April 1891: "Stuttgart, 20. März (1891). Herr
Rittergutsbesitzer Friedrich
Kaulla in Oberdischingen ist vom Könige mit der silbernen
Verdienst-Medaille für Landwirtschaft ausgezeichnet
worden." Mitteilung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. April 1891: "Stuttgart, 20. März (1891). Herr
Rittergutsbesitzer Friedrich
Kaulla in Oberdischingen ist vom Könige mit der silbernen
Verdienst-Medaille für Landwirtschaft ausgezeichnet
worden." |
Sonstige Berichte aus
Oberdischingen
Der christliche Wagner Schmidt wird "entschiedener
Anhänger des mosaischen Glaubensbekenntnisses" (1846)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. August 1846:
"(Kuriosum). Seit Jahren ist allenthalben dahin zu arbeiten,
Glaubensgenossen im Judentum zu erhalten und zu befestigen. Endlich hat
sich hierzu ein einfaches Mittel aufgefunden. Und dies wäre? - Gebt
denen, welche lau oder gar abtrünnig werden wollen, das Leben Jesu von
Strauß zu lesen (vgl. Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/David_Friedrich_Strauß)!
- Man höre: der Wagner Schmidt in Oberdischingen, Oberamt Ehingen,
ein braver, stiller und sonst ganz besonnener Mann, ist durch die Lektüre
des Lebens Jesu von Strauß wo nicht ein Jude, doch wenigstens ein
so entschiedener Anhänger des mosaischen Glaubensbekenntnisses geworden,
dass er den Sabbat hält und sich allen jüdischen Gebräuchen
unterwirft." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. August 1846:
"(Kuriosum). Seit Jahren ist allenthalben dahin zu arbeiten,
Glaubensgenossen im Judentum zu erhalten und zu befestigen. Endlich hat
sich hierzu ein einfaches Mittel aufgefunden. Und dies wäre? - Gebt
denen, welche lau oder gar abtrünnig werden wollen, das Leben Jesu von
Strauß zu lesen (vgl. Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/David_Friedrich_Strauß)!
- Man höre: der Wagner Schmidt in Oberdischingen, Oberamt Ehingen,
ein braver, stiller und sonst ganz besonnener Mann, ist durch die Lektüre
des Lebens Jesu von Strauß wo nicht ein Jude, doch wenigstens ein
so entschiedener Anhänger des mosaischen Glaubensbekenntnisses geworden,
dass er den Sabbat hält und sich allen jüdischen Gebräuchen
unterwirft." |
Anzeigen
Anzeige von Rittergutsbesitzer Friedrich Kaulla (1858)
 Anzeige im "Schwäbischen Merkur" vom 2. September 1858 über
"Anlehen des Rittergutsbesitzers Herrn Friedrich Kaulla zu
Oberdischingen" Anzeige im "Schwäbischen Merkur" vom 2. September 1858 über
"Anlehen des Rittergutsbesitzers Herrn Friedrich Kaulla zu
Oberdischingen" |
Neuere Presseberichte:
 | Artikel von Rainer Schäffold im "Ehinger
Tagblatt" (Südwestpresse) vom 22. Juli 2015: "Oberdischingen. Wie im Märchen.
Aus seinem Dornröschenschlaf erweckt wurde das Häuschen im Park von St. Hildegard in Oberdischingen - allgemein "Pavillon" genannt. Es soll einmal als Ort für Ausstellungen und kleinere Feste dienen..."
Link
zum Artikel
Anmerkung: Im Park von St. Hildegard Oberdischingen befindet sich ein
Pavillon, der von 2007 bis 2015 in Eigenleistung aufwändig saniert
wurde. Der Pavillon wurde von Friedrich Kaulla um 1870 errichtet, um einen
Besprechungsraum zu haben und darin ungestört seinen biologischen Studien nachgehen zu können. |
Fotos / Dokumente
Historische
Ansichten
von
Oberdischingen |
 |
 |
| |
Historische Ansichtskarte von
Oberdischingen mit einem Blick
in den Schlosshof. Friedrich Kaulla hatte
von der Familie
Schenk von Castell das Rittergut am Ort erworben.
(Quelle: Sammlung Hahn) |
Blick in den Schlosspark
mit dem früheren
Kavalierbau des Schlosses
(Quelle: Museumsverein Oberdischingen)
|
| |
|
|
| Neuere Fotos |
 |
 |
| |
Der Schlossplatz in
Oberdischingen
(Quelle: Gemeinde Oberdischingen) |
|
| |
|
|
Tauf- und
Sterbeeintrag
zu Friedrich Kaulla
Hinweis: Das Pfarramt Ersingen (heute Stadtteil von Erbach)
war für die Protestanten in Oberdischingen zuständig |
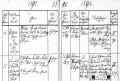 |
 |
| |
Taufeintrag im
Kirchenbuch Pfarramt Ersingen (IV 317): Friedrich Kaulla,
getauft
am 1. September 1892 in Ersingen durch Pfarrer Maier; als einer der
Taufzeugen ist
Emil Hohenemser eingetragen, Landwirt und Königlich Sächsischer
Sekondelieutenant
der Reserve (aus Frankfurt am Main, wohnhaft in
Oberdischingen) |
Sterbeeintrag von
Friedrich Kaulla, gest. 6. Januar 1895
in Oberdischingen, Trauergottesdienst war am 9. Januar 1895
im Haus am Sarge; auf dem Friedhof an der Gruft hielt
Pfarrer Maier noch eine Rede, ein Gebet und eine
Einsegnung. |
| |
|
|
Taufeintrag
zu
Clara Maria Catharina Kaulla |
 |
| |
Taufeintrag
für Clara Sara Agnes Catharina Kaulla (nach der Konversion: Clara
Maria Catharina Kaulla);
Taufe in Ersingen am 17. Oktober 1878 durch
Pfarrer Seuffer |
| |
|
|
Fotos mit
Friedrich Kaulla
(Fotos: Archiv Museumsverein Oberdischingen e.V.) |
 |
 |
| |
Friedrich Kaulla,
rechts vom Bierfass sitzend,
inmitten der Sängergruppe Oberdischingen (um 1890)
|
Friedrich Kaulla -
umgeben von Soldaten (um 1890);
Kaulla initiierte nach 1870/71 die Einrichtung
eines Soldatengenesungsheimes |
| |
|
|
Die Grabstätte
der Familie Kaulla (1973),
1976 abgebrochen
(Fotos: Archiv Museumsverein Oberdischingen e.V.) |
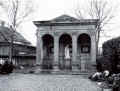
 |
 |
| |
Ansichten der
Grabstätte im nordöstlichen Teil
des Oberdischinger
Friedhofes |
Statue, die auch
seit dem Abbruch 1976
verschwunden ist |
| |
|
|
Die von der
Familiengruft Kaulla nach
deren Zerstörung 1976 geretteten Gedenktafeln
(im jüdischen Friedhof Laupheim) |
 |
 |
| |
Tafel für
Herrmann Michael Kaulla "geb. zu Stuttgart d. 28. Septbr.
1845, gest. zu Meran [Tyrol] d. 16. März 1882. Er lebte seinem
Berufe
als Mitbesitzer der Herrschaft Oberdischingen, nachdem er im Jahre
1870/71 den Feldzug gegen Frankreich als Dragoner Fähnrich
freiwillig
mitgemacht und sich d. 28.October 1880 vermählte." |
Tafel für
"Frau Luise Kaulla geb. Pfeiffer, geb.
zu Stuttgart am 26. Januar 1829, gest. dahier am 6. Juli 1888.
Inhaberin des kgl. württb. Olgaordens, des kgl. preuss.
Luisen-Ordens und der Kriegsdenkmünze 1870/71. R.I.P."
|
| |
|
|
Vorfahren von
Friedrich Kaulla
vgl. Zusammenstellung von Rolf Hofmann:
Vorfahren
und Bruder von Friedrich Kaulla (pdf-Datei) |
 |

 |
| |
Friedrichs Großmutter:
Madame Kaulla (geboren als Chaile bat Raphael)
(geb. 1739 in Buchau, gest. 1809 in Hechingen),
Hof-Faktorin an verschiedenen
Fürstenhöfen, ab 1770 für den württembergischen Herzog Carl
Eugen,
1802 Mitbegründerin der Württembergischen Hofbank in
Stuttgart |
Die Grabmäler der
Eltern von Friedrich Kaulla -
Wolf von Kaulla und Eva Kaulla geb. Bing
im israelitischen Teil des
Hoppenlau-Friedhofes in Stuttgart
(Fotos von 1987, Sammlung Hahn) |
| |
|
|
| Beziehungen
der Familie |
 |
 |
|
Friedrich von
Kaullas Tochter Paula Luise Friederike Mathilde Kaulla
heiratete am 28. Januar 1872 Oscar von Sarwey von Ludwigsburg
(1837-1912), vgl. Wikipedia-Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Oscar_von_Sarwey
|
Friedrich von
Kaullas Tochter Clara Maria Catharina Kaulla heiratete am 3.
Oktober 1880 in Oberdischingen Ludwig Heinrich Ebers aus Berlin,
Sohn des Bankiers Georg Moritz Ebers und seiner Frau Franziska (Fanny)
geb. Levysohn. In der Neuen Pinakothek München findet sich ein Ölgemälde
von Fanny Ebers (1826). Die Familie Ebers war jüdischen Glaubens, ist
dann konvertiert. |
| |
|
vgl. Beitrag von
Rolf Hofmann: "Die
Bankiersgattin Fanny Ebers - Gemälde von Wilhelm Schadow - merkwürdige
familiengeschichtliche Aspekte" (doc-Datei) |
 |

 |
Links: Von der Bedeutung
der oben genannten Familie Ebers zeugt bis heute
das "Palais
Ephraim" in Berlin, von dem zumindest die Fassade erhalten
ist
(links Gemälde von Heinrich Zille; Druck des Gemäldes und
Foto rechts davon aus der Sammlung von Rolf Hofmann)
zu Familie Ebers: Rolf Hofmann: Vorfahren
von Ludwig Heinrich Ebers
(= Ahnenreihe Familien Ephraim + Ebers in Berlin; pdf-Datei)
vgl. zum Vorfahr Veitel
Heine Ephraim (Wikipedia-Artikel);
vgl. zum Bruder von Ludwig Heinrich Ebers:
Georg Ebers
(Wikipedia-Artikel) |
Das Gemälde von
Carl Kretschmar zeigt Moritz Ebers
(© Jüdisches Museum Berlin) |
Das "Palais
Ephraim" - um 1920
(Zille-Gemälde) und heute |
|
| |
|
|
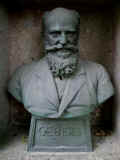 |


 |
 |
Oben: Das
Grab des Ägyptologen Georg Ebers
(Sohn von Fanny) und seiner Gattin befindet
sich in Position 149 Mauer rechts
auf dem Nordfriedhof München.
|
Das Ebers-Erbbegräbnis in Berlin im Dreifaltigkeitsfriedhof II
in der Bergmannstraße in Kreuzberg - unmittelbar neben
dem Oppenfeld-Mausoleum. Außer Fanny und Moritz Ebers sind
dort noch weitere Familienangehörige begraben.
|
Der Bruder des o.g.
Ludwig Heinrich Ebers bzw. der Schwager von
Clara Maria Catharina Kaulla war Martin Ebers, der mit
Caroline geb. von Le Monnier verheiratet war, einer Tochter
des Wiener Polizeidirektors Anton Ritter von Le Monnier;
oben das Familiengrab in Wien |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
Der
Privatfriedhof Steiner
Fotos: Veit Feger, Aufnahmen vom 11.10.2017) |

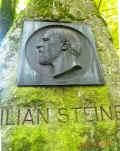 |
 |
| Grabmal
für den Geheimen Kommerzienrat Kilian von Steiner (geb. Laupheim
9. Oktober 1833, gest. Stuttgart 25. September 1903) und seiner Frau Clotilde
geb. Bacher (geb. Hechingen 6. Juli 1833, gest. Laupheim 20. Februar
1919). Das Grab befindet sich in dem Privatfriedhof Steiner bei
Oberdischingen, im Wald oberhalb des Ortes, zu erreichen über den
Parkplatz, der dort für die christliche Gebetsstätte Christmarienau
angelegt wurde. Über Kilian von Steiner siehe Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Kilian_von_Steiner.
Der Friedhof wird dominiert durch ein Kreuz, weil Steiner, wie einige
andere Verwandte aus der jüdischen Gemeinde Laupheim, Christ geworden
war. Der Friedhof, in dem sich etwa ein Dutzend Grabsteine befinden,
gehört der gräflichen Familie Leutrum. |
| |
|
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Nathanja Hüttenmeister: Der jüdische Friedhof Laupheim. 1998.
S. 546-547. |
 | Beiträge des Museumsvereins Oberdischingen e.V.
von 2016 zu
Friedrich Kaulla und zur Grabstätte Kaulla auf dem Friedhof Oberdischingen:
Beiträge
zusammengestellt als pdf-Datei. |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|