|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Bayerisch Schwaben"
Ederheim (Kreis
Donau-Ries)
Jüdische Geschichte / Synagoge
(Seite erstellt unter Mitarbeit von Kurt Kroepelin,
Ederheim)
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Ederheim bestand eine jüdische Gemeinde bis zu
ihrer Auflösung 1874. Die Entstehung der Gemeinde geht in das 16./17.
Jahrhundert zurück. 1503 werden die Juden Leo und Jäcklin am Ort genannt.
1507 erfolgte allerdings eine Vertreibung der Juden Ederheims. Nach 1525 konnten unter dem
Ortsherrn Nikolaus von Jaxheim wieder Juden zuziehen. 1537 verzogen sie wieder
aus Ederheim. Danach schweigen die Quellen.
Zu vermuten ist auf Grund dieser Quellenangaben, dass die Entstehung der
Ederheimer Gemeinde mit der Vertreibung der Juden aus Nördlingen (1499)
zusammenhängen wird. Dies wird auch bereits in einer frühen Darstellung zur
Geschichte der Juden im Ries angenommen:
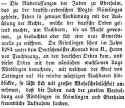 Aus
einem Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10.
September 1842; "Die Niederlassungen der Juden zu Ederheim,
das zu der deutsch-ordenschen Vogtei Reimlingen gehörte, stehen in
genauer Verbindung mit der Ausübung der Rechte, welche der deutsche Orden
geltend machte, um Nachbarn, die an Macht gewonnen, zu beobachten oder
sich eine neue Erwerbsquelle zu eröffnen. Da Reimlingen schon im Jahre
1283 unter dem Deutschmeister Konrad dem II., Herrn von Feuchtwang, an den
deutschen Orden kam, und dieser Orden mit dem nämlichen wachsamen Auge
Nördlingen betrachtete, mit welchem der Graf von Oettingen auf die minder
mächtigen Nachbarn hinblickte, so lässt sich mit großer
Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die Juden nach der zweiten Vertreibung
aus Nördlingen in Reimlingen und Ederheim freundliche Aufnahme
fanden." Aus
einem Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10.
September 1842; "Die Niederlassungen der Juden zu Ederheim,
das zu der deutsch-ordenschen Vogtei Reimlingen gehörte, stehen in
genauer Verbindung mit der Ausübung der Rechte, welche der deutsche Orden
geltend machte, um Nachbarn, die an Macht gewonnen, zu beobachten oder
sich eine neue Erwerbsquelle zu eröffnen. Da Reimlingen schon im Jahre
1283 unter dem Deutschmeister Konrad dem II., Herrn von Feuchtwang, an den
deutschen Orden kam, und dieser Orden mit dem nämlichen wachsamen Auge
Nördlingen betrachtete, mit welchem der Graf von Oettingen auf die minder
mächtigen Nachbarn hinblickte, so lässt sich mit großer
Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die Juden nach der zweiten Vertreibung
aus Nördlingen in Reimlingen und Ederheim freundliche Aufnahme
fanden." |
Ob zwischen 1537 und der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg
Juden am Ort lebten, ist nicht bekannt. Erst
1674 werden urkundlich wieder jüdische
Einwohner in Ederheim genannt. In den folgenden beiden Jahrhunderten lebten kontinuierlich
jüdische Familien am Ort. 1726 waren Juden sogar theoretische Besitzer von
"Kirchenstühlen" - der Besitz eines "Kirchenstuhls" stand
im Zusammenhang mit dem Hausbesitz am Ort.
Relativ stark wuchs die Zahl der jüdischen Einwohner bis zur ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts. 1834 waren etwa 25 Häuser in Ederheim von jüdischen
Familien bewohnt. Mittelpunkt des jüdischen Wohngebietes war der "Judenbuck"
auf dem sich auch die jüdischen Einrichtungen befanden (siehe unten; Teil der
heutigen Dorfstraße).
Die Namen der jüdischen Familien im Zeitraum 1835/40 waren nach den
damaligen Haushaltsvorständen (in Klammern werden - soweit feststellbar - die Adressen der Häuser nach dem
Verzeichnis von 1993 s. Lit. angegeben; ein "?" markiert nicht mehr
bestehende Häuser
beziehungsweise unbekannte Adressen): Emanuel Altmeier (?), Löw Abraham
Einstein (Dorfstraße 24), Samuel Wolf Ettinger, nach 1833 Löw Abraham Einstein
(Dorfstraße
21), David Einstein (Dorfstraße 17), Judas Oettinger (?), Mendl Bär Kitzinger
(Dorfstraße
13), Jakob Hirsch Weiler (?), Moises Aron Altmeyer (Dorfstraße 11), Hirsch
Einstein (Dorfstraße 8), Jakob Hirsch Bößwenger (Dorfstraße 1), Moses Abraham
Einstein (?), Elias Neuburger (Hauptstraße 17), Joseph Levi Sonnenberger (Hauptstraße 19), Abraham Ephraim Ettinger
(Hauptstraße 34), Samson Altmayer (Hauptstraße 40), Abraham Ephraim Ettinger
(Hauptstraße 44), Seligmann Salomon Ball (Hauptstraße 46), Ephraim Levi Ettinger
(Dorfstraße 39), Loew Einstein (Dorfstraße 40;
Gebäude gehörte seit 10.10.1833 der jüdischen Gemeinde), Isak Wolf
Schweisheimer (?), Seligmann Hartstein (?), Hirsch Moises (?), Salomon Moses
Ettenheimer (Dorfstraße 34), Abraham Rosenberger (Dorfstraße 34), Abraham Sternglanz
(Dorfstraße 32), Seligmann Sternglanz (?), Jakob Hirsch Weiler (Dorfstraße 30),
Moses Braunschweiger (Hauptstraße 43), Samson Löw Rosenberger (?), Samson
Altmeyer (Hauptstraße 37).
Die jüdische Gemeinde hatte an Einrichtungen eine Synagoge (s.u.), eine
israelitische Schule (seit 1828) und ein rituelles Bad. Die Toten der
Gemeinde wurden auf dem jüdischen Friedhof in Harburg beigesetzt. Die
zum Rabbinatsbezirk Wallerstein
gehörende Gemeinde hatte einen
Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schächter angestellt war (u.a.
bis 1806 Nathan Löb). Nachdem in den 1860er-Jahren die Zahl der jüdischen Gemeindeglieder
durch Aus- und Abwanderung schnell zurückging, wurde 1867 vermutlich letztmals die Stelle des Schächters
besetzt, damals bereits gemeinsam mit der ebenfalls klein gewordenen jüdischen
Gemeinde in Kleinerdlingen und in
Verbindung mit der neu entstehenden Gemeinde in Nördlingen
(vgl. Ausschreibung der Stelle unten).
1862 waren noch 17 jüdische Familien mit zusammen 62 Personen gezählt
worden, darunter 13 Kinder. In den folgenden Jahren haben die meisten der
jüdischen Familien Ederheim verlassen.
Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts verzogen einzelne jüdische Familien in
Orte, in denen eine Niederlassung bereits möglich war und in denen es bessere
Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten gab. So wurden 1806 in Esslingen
die Brüder Samuel und Nathan Löb aus Ederheim aufgenommen. Sie nannten sich
bald nach ihrer Aufnahme mit Familiennamen "Ederheimer". Nathan Löb
Ederheimer war bereits in Ederheim als Vorsänger, Schächter und Lehrer tätig
gewesen. Bis 1834 konnte er in der Esslinger jüdischen Gemeinde dieselben Funktionen
übernehmen, wurde dann jedoch auf Grund von Neuregelungen in Württemberg als
"ungeprüfter" Vorsänger aus dem Dienst entlassen.
Am 26. April 1874 fasste die Gemeinde den Beschluss, sich aufzulösen und sich
mit der in Nördlingen bestehenden Gemeinde zu vereinigen. Ein Teil der
jüdischen Familien aus Ederheim war bis dahin nach Nördlingen verzogen.
Von den in Ederheim geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Hina Einstein geb.
Schweisheimer (1859), Moritz Heilbronner (1861), Eugen Schweisheimer (1858),
Julius Schweisheimer (1863), Moritz Schweisheimer
(1862).
Berichte / Anzeigen aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Ausschreibung der Stelle des Schächters für Kleinerdlingen und Ederheim 1867
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1867: "Anzeigen. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. Juli 1867: "Anzeigen.
In den beiden Orten
Kleinerdlingen und Ederheim, verbunden mit
Nördlingen, Rabbinats Wallerstein, ist die Stelle eines Schächters
provisorisch zu besetzen. Die Erträgnisse belaufen sich auf 450 Gulden fixe
Besoldung, das Übrige an Erträgnissen der Schechitah selbst. Bewerber streng
religiöser Richtung wollen ihre Anmeldung unter Vorlage ihrer Zeugnisse binnen
14 Tagen an den Kultusvorstand dahier einsenden.
Kleinerdlingen bei Nördlingen,
den 24. Juni 1867. Der Kultusvorstand L.B. Köhler". |
Über ein Beth HaMidrasch (Talmud-Tora-Schule) in Ederheim (Bericht von 1866)
 Aus
einem Artikel über die religiösen Verhältnisse in Bayerische Schwaben
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1866:
"Ederheim, wo ein Beit HaMidrasch existiert, das ein Gemeindemitglied
durch Fondierung einiger tausend Gulden zu dem Zwecke gegründet, dass
für die abfallenden Interessen ein Toragelehrter mit Schülern Mischnajot
und Gemara lernen soll." Aus
einem Artikel über die religiösen Verhältnisse in Bayerische Schwaben
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1866:
"Ederheim, wo ein Beit HaMidrasch existiert, das ein Gemeindemitglied
durch Fondierung einiger tausend Gulden zu dem Zwecke gegründet, dass
für die abfallenden Interessen ein Toragelehrter mit Schülern Mischnajot
und Gemara lernen soll." |
Rätselhafte Erscheinung an einer jüdischen Frau
(1852)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1852:
"Ein Kuriosum muss ich aus einem württembergisch-bayerischen
Grenzorte berichten. In Ederheim, Rabbinats Wallerstein, ist der
Kopf einer jüdischen Frau förmlich in Brand geraten, aus dem Haupthaar
sprühen glühende Funken, die zünden. Die ganze medizinische Welt ist
über dieses Phänomen in Alarm gebracht. Die Frau glaubte sich von
Dämonen geplant, die in ihrem Innern hausen und Funken sprühen. Ein
Rabbiner von hyperorthodoxer Richtung hat mit Amuletten die Dämonen
vertreiben wollen; aber Dämonen lieben gewöhnlich wertvolle Kameen, sie
sind nicht gewichen. Dem Arzte aber war die gehorsamer, er ließ die
Kopfhaare abrasieren, das Haupt mit Lehmumschlägen bedecken und das Feuer
ist gestillt. In der Literatur der Sch'T (?) kommt ein derartiger
Fall nicht vor, selbst Liebig hat ihn bis jetzt nicht
gekannt." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 1. Januar 1852:
"Ein Kuriosum muss ich aus einem württembergisch-bayerischen
Grenzorte berichten. In Ederheim, Rabbinats Wallerstein, ist der
Kopf einer jüdischen Frau förmlich in Brand geraten, aus dem Haupthaar
sprühen glühende Funken, die zünden. Die ganze medizinische Welt ist
über dieses Phänomen in Alarm gebracht. Die Frau glaubte sich von
Dämonen geplant, die in ihrem Innern hausen und Funken sprühen. Ein
Rabbiner von hyperorthodoxer Richtung hat mit Amuletten die Dämonen
vertreiben wollen; aber Dämonen lieben gewöhnlich wertvolle Kameen, sie
sind nicht gewichen. Dem Arzte aber war die gehorsamer, er ließ die
Kopfhaare abrasieren, das Haupt mit Lehmumschlägen bedecken und das Feuer
ist gestillt. In der Literatur der Sch'T (?) kommt ein derartiger
Fall nicht vor, selbst Liebig hat ihn bis jetzt nicht
gekannt." |
Weiteres Dokument
Brief
aus New York
an Mingele Oettinger (1887)
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller,
Kirchheim / Ries) |
 |
|
Der Brief aus New York an Mingele Oettinger
wurde versandt am 5. Juli 1887. Mingele (Minkele) Oettinger war die Tochter von Emanuel Braunschweig und seiner Frau Melga aus Ederheim.
Minkele Braunschweig wurde ca. 1801 in Ederheim geboren und starb am 25. Februar 1888 in Nördlingen.
Am 6. November 1817 heiratete sie den Eisenhändler Ephraim Oettinger von Ederheim.
Das Ehepaar verzog nach 1870 nach Nördlingen und schenkte elf Kindern das Leben.
Hendel, genannt Helena, geboren am 31. März 1831 heiratet Maier Altmaier und wandert später nach New York.
Vermutlich war der Brief aus New York von Hendel. Der Absender Altmayer Brothers lässt zumindest darauf schließen. |
Zur Geschichte der Synagoge
1688 wurde von der Ortsherrschaft den Juden in Ederheim
gestattet, "dass sie sich des Platzes, den sie auf einem Boden mit Brettern
beschlagen lassen, zu einer Schul gebrauchen dürften". Mit der
"Schul" ist eine Synagoge gemeint. Vermutlich wurde damals
alsbald eine erste Synagoge eingerichtet.
Eine neue Synagoge wurde 1736 (nicht wie früher hier angegeben: 1726) erbaut.
Hinweis: Die Jahreszahl 1736 findet sich - nach Auskunft von Gerhard Beck vom
10.3.2014 - in einem Aktenbündel zur den Ederheimer Juden im
Fürstlich-Oettingen-Wallerstein'schen Archiv auf der Harburg (FÖWAH) unter der
Nummer III.18.7 c-2.
Die 1736 erbaute Synagoge wurde bis um 1870 genutzt. Danach
wurde das Gebäude verkauft. Es ist zu einem nicht bekannten Zeitpunkt in sich
zusammengefallen oder wurde teilweise abgebrochen. Ende der 1920er-Jahre war das
Synagogengrundstück nach Zeitzeugenberichten ein verwaister Platz. Es standen
damals noch Mauerreste. Kinder nutzten das Gelände zum Spielen. Spätestens
Anfang der 1950er-Jahre wurden auch die Reste des Synagogengebäudes vollends
beseitigt. Heute ist auf dem Grundstück eine Garage bzw. der Garagenvorplatz
und die Zufahrt zum Wohnhaus Dorfstraße 36.
Das neben der Synagoge stehende Gebäude der "Judenschule"
wurde 1950/52 vollständig abgebrochen. Das Grundstück wurde neu mit einem
Gebäude für die Feuerwehr, Poststelle und Mietwohnungen (für
Heimatvertriebene) bebaut (eingeweiht ca. 1954, Dorfstraße 40/42).
Adresse/Standort der Synagoge: neben Dorfstraße 40
(ehem. "Judenbuck" = Judenberg): die Nordwand der ehemaligen Synagoge
stand am heutigen Giebel des Gebäudes Dorfstraße 40 (Feuerwehrhaus) und
erstreckte sich auf die heutige Plan-Nr. 7 (siehe unten aktueller
Katasterplan).
Fotos
(Pläne und aktuelle Fotos vom "Judenbuck" zur
Verfügung gestellt von Kurt Kroepelin; historische Fotos zur Verfügung gestellt von Georg Spielberger,
Ederheim: Neuere Fotos: Manuela Hofmann-Scherrers, Nördlingen; die Eintragung
der ehemaligen Synagoge in den aktuellen Katasterplan wurde von Herrn Doesel vom
Vermessungsamt in Donauwörth vorgenommen)
Links und Literatur
Links / ergänzende
Materialien
Genealogische Informationen
Literatur:
 | L. Müller: Aus fünf Jahrhunderten. Beiträge zur
Geschichte der jüdischen Gemeinden im Riess. In: Zeitschrift des
Historischen Vereins für Schwaben und Neuburg. Jg. 26 1899 S. 81-183. Zu
Ederheim: S. 177. |
 | Doris Pfister (Hg. von Peter Fassl): Dokumentation zur
Geschichte und Kultus der Juden in Schwaben. Augsburg 1993. Bd. II
Hausbesitz um 1835-40 S. 29-33 (zu Ederheim) |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. 1988 S. 238. |
 | Joachim Hahn: Jüdisches Leben in Esslingen.
Geschichte, Quellen und Dokumentation. Esslinger Studien. Sigmaringen 1994.
Schriftenreihe Band 14. S. 234-237 (zu den Familien Ederheimer). |
 | Bernhard Uttenweiler: Stammen die Vorfahren des
jüdischen Juweliers Elias S. Ettenheimer aus Rochester, USA, ursprünglich
aus Ettenheim? In: Die Ortenau. Zeitschrift des Historischen Vereins für
Mittelbaden. Bd. 99 2019 S. 353-356. Anmerkung: die Vorfahren stammen
nicht aus Ettenheim, sondern aus
Ederheim. |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|