|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"
Zur Übersicht
"Synagogen im Kreis Marburg-Biedenkopf
Momberg (Stadt
Neustadt/Hessen, Kreis Marburg-Biedenkopf)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Momberg bestand eine jüdische
Gemeinde (Filialgemeinde zu Neustadt)
bis nach 1933. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts
zurück. 1690 gab es noch keine Juden am Ort. 1731 wird ein jüdische Einwohner
genannt, seit 1733 zwei (vermutlich mit Familien); 1747 werden insgesamt 13 jüdische Einwohner am Ort
gezählt (vermutlich in zwei oder drei Familien).
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie
folgt: 1801 49 jüdische Einwohner, 1861 49 (in neun Familien; 6,5 % von
insgesamt 753 Einwohnern), 1905 48. 1858 wurden als Gewerbebetriebe im
Besitz jüdischer Familien am Ort festgestellt: Spezereihandel und Metzgerei (1
Familie), Metzgerei, Tuch- und Nothandel (1 Familie), Nothandel (1 Familie).
An eigenen Einrichtungen in Momberg bestand seit Mitte des 19.
Jahrhunderts eine Synagoge (s.u.) sowie - zumindest Anfang des 19. Jahrhunderts
- auch ein rituelles Bad (1825 im Haus von Michael Spier). Ansonsten wurden die
Einrichtungen in Neustadt mitbenutzt
(Schule,
rituelles Bad, Friedhof). Die
Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk Oberhessen mit Sitz in Marburg.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Gefreiter Isaak
Blumenfeld (geb. 24.9.1893 in Momberg, gef. 8.1.1915), Moritz Blumenfeld (geb.
16.3.1887, gef. 12.12.1914; vgl. zu den beiden Genannten den Bericht unten)
sowie Moritz Moses Blumenfeld (geb. 28.9.1887 in Momberg, gef. 21.6.1916).
Außerdem sind gefallen: Moritz Spier (geb. 25.10.1880 in Momberg, vor 1914 in
Einbeck wohnhaft, gef. 9.7.1917) und Jakob Weinstein (geb. 26.6.1878 in Momberg,
vor 1914 in Felsberg-Gensungen wohnhaft, gef. 23.9.1914) .
1925 wurden 34 jüdische Einwohner in Momberg gezählt (3,8 % von
insgesamt 895 Einwohnern). 1932 war S. Alexander aus Momberg 2. Vorsitzender
der jüdischen Gemeinde Neustadt.
1933 lebten noch 31 jüdische Personen (in sieben Familien) am Ort. In
den folgenden Jahren ist ein Teil von ihnen auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,
der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert (12 Personen in die USA,
eine Familie nach Südafrika). Beim Novemberpogrom 1938 wurde die
Inneneinrichtung der Synagoge zerstört (s.u.). Die letzten elf jüdischen Personen wurden
1941/42 aus Momberg deportiert.
Von den in Momberg geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Frieda Blumenfeld
(1911), Hugo Blumenfeld (1882), Ida S. Blumenfeld geb. Stern (1878),
Julius Blumenfeld (1885), Julius Blumenfeld (1910), Kurt Blumenfeld
(1921), Dina Heldenmuth geb. Blumenfeld (1871), Karoline Höxter geb.
Blumenfeld (1857), Fanny Katzenstein geb. Bickardt (1868), Ludwig Lion (1909),
Lina Nathan geb. Spier (1892). Franziska Oppenheim geb. Blumenfeld (1870),
Pauline Pohly geb. Reizkin (1914), Günter Rosenberg (1925), Karoline Sommer
geb. Spier (1874), Isaak Spier (1875), Johanna Spier geb. Rothschild (1878),
Manfred Spier (1925), Sida Spier geb. Blumenfeld (1896), Siegfried Spier (1887),
Nanny Stern geb. Blumenfeld (1878), Emma Wetterhahn geb. Blumenfeld
(1892).
Ruth Lion geb. Spier (geb. 1909 in Momberg) musste mit ihrem Ehemann Ludwig Lion
(geb. 1909) 1941 die Deportation in das Ghetto Riga antreten. Sie überlebte.
Auf dem Friedhof von Momberg ließ sie einen Gedenkstein für zehn
deportierte frühere jüdische Einwohner Mombergs aufstellen (oben kursiv
markiert).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Berichte aus dem jüdischen
Gemeindeleben
Das Kriegerehrenmal wird unter jüdischer Beteiligung
eingeweiht (1931)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. November 1931: "Momberg (Kreis
Kirchhain). Die stattgefundene Einweihung des Kriegerehrenmales stand im
Zeichen des konfessionellen Friedens, wie man ihn in dieser schweren Zeit
und bei der heutigen Verhetzung selten findet. Als erster Redner gab Herr
Kuratus Roßmann seiner Freude über das harmonische Zusammenleben
zwischen Juden und Christen in der Gemeinde Ausdruck. Als zweiter Redner
sprach Herr Rabbiner Dr. Cohn (Marburg).
Als letzter sprach Lehrer Blumenfeld gegen die antisemitische
Hetze. Die Worte der beiden jüdischen Redner, besonders aber die des
Herrn Rabbiner Dr. Cohn, wurden von der ganzen bei dieser Feier anwesenden
Bevölkerung mit großem Beifall
aufgenommen." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 13. November 1931: "Momberg (Kreis
Kirchhain). Die stattgefundene Einweihung des Kriegerehrenmales stand im
Zeichen des konfessionellen Friedens, wie man ihn in dieser schweren Zeit
und bei der heutigen Verhetzung selten findet. Als erster Redner gab Herr
Kuratus Roßmann seiner Freude über das harmonische Zusammenleben
zwischen Juden und Christen in der Gemeinde Ausdruck. Als zweiter Redner
sprach Herr Rabbiner Dr. Cohn (Marburg).
Als letzter sprach Lehrer Blumenfeld gegen die antisemitische
Hetze. Die Worte der beiden jüdischen Redner, besonders aber die des
Herrn Rabbiner Dr. Cohn, wurden von der ganzen bei dieser Feier anwesenden
Bevölkerung mit großem Beifall
aufgenommen." |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der Gemeinde
Goldene Hochzeit von Kaufmann Joseph Spier und Sara
geb. Stern (1904)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 25. Mai 1904: "Momberg, Kreis Kirchhain, 16.
Mai (1904). Der Kaufmann Joseph Spier und dessen Ehefrau Sara
geb. Stern dahier, feierten heute in seltener körperlicher
Rüstigkeit und geistiger Frische das Fest ihrer goldenen Gochzeit. Herr Provinzialrabbiner
Dr. Munk aus Marburg hielt in der
Synagoge im Anschlusse an Psalm 92 und 129 eine wirkungsvolle Ansprache,
an deren Schluss er die von Seiner Majestät dem Könige gestiftete
Ehejubiläumsmedaille überreicht. Die weitere Feier fand im engsten
Familienkreise statt. Das Jubelpaar, welches 80 bzw. 76 Jahre alt ist,
erfreut sich in all seinen Bekanntenkreisen der größten Wertschätzung
und Beliebtheit." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 25. Mai 1904: "Momberg, Kreis Kirchhain, 16.
Mai (1904). Der Kaufmann Joseph Spier und dessen Ehefrau Sara
geb. Stern dahier, feierten heute in seltener körperlicher
Rüstigkeit und geistiger Frische das Fest ihrer goldenen Gochzeit. Herr Provinzialrabbiner
Dr. Munk aus Marburg hielt in der
Synagoge im Anschlusse an Psalm 92 und 129 eine wirkungsvolle Ansprache,
an deren Schluss er die von Seiner Majestät dem Könige gestiftete
Ehejubiläumsmedaille überreicht. Die weitere Feier fand im engsten
Familienkreise statt. Das Jubelpaar, welches 80 bzw. 76 Jahre alt ist,
erfreut sich in all seinen Bekanntenkreisen der größten Wertschätzung
und Beliebtheit." |
Die beiden Söhne der Familie G. Blumenfeld sind im
Krieg gefallen (1915)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 29. Januar
1915: "Momberg, Kreis Kirchhain. Von einem schweren Verlust
wurde die Familie G. Blumenfeld betroffen. Zwei hoffnungsvolle Söhne
erlitten beide den Heldentod fürs Vaterland. Beide haben sich durch
hervorragende Tapferkeit vor dem Feinde ausgezeichnet, der älteste hat
einen Schwerverwundeten unter größter Lebensgefahr aus dem furchtbarsten
Granatfeuer getragen. Der jüngste stand zuletzt als Lehrer in Petershagen
a. Weser. Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 29. Januar
1915: "Momberg, Kreis Kirchhain. Von einem schweren Verlust
wurde die Familie G. Blumenfeld betroffen. Zwei hoffnungsvolle Söhne
erlitten beide den Heldentod fürs Vaterland. Beide haben sich durch
hervorragende Tapferkeit vor dem Feinde ausgezeichnet, der älteste hat
einen Schwerverwundeten unter größter Lebensgefahr aus dem furchtbarsten
Granatfeuer getragen. Der jüngste stand zuletzt als Lehrer in Petershagen
a. Weser.
Bei dem gestrigen Sabbatgottesdienst hielt Lehrer Wertheim aus Neustadt zu
Ehren der gefallenen Helden eine herrliche Ansprache, die auf alle
Zuhörer einen tiefen Eindruck ausübte." |
Der Viehhändler Abraham Blumenfeld wird vermisst und
tot aufgefunden (1931)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 4. September 1931: "Momberg. Seit dem 25.
August wird der Viehhändler Abraham Blumenfeld vermisst. Er war an
diesem Tage zum Viehmarkt nach Gießen gefahren und ist dann mit dem
Erlös von über 1000 Mark am gleichen Tage nach Frankfurt gefahren, um
dort weitere Geschäfte zu tätigen. Trotz polizeilicher Nachforschung
fehlt von hier aus jede Spur. Anscheinend ist Blumenfeld einem Verbrechen
zum Opfer gefallen." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 4. September 1931: "Momberg. Seit dem 25.
August wird der Viehhändler Abraham Blumenfeld vermisst. Er war an
diesem Tage zum Viehmarkt nach Gießen gefahren und ist dann mit dem
Erlös von über 1000 Mark am gleichen Tage nach Frankfurt gefahren, um
dort weitere Geschäfte zu tätigen. Trotz polizeilicher Nachforschung
fehlt von hier aus jede Spur. Anscheinend ist Blumenfeld einem Verbrechen
zum Opfer gefallen." |
| |
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 11. September 1931: "Momberg. Wie wir
berichteten, wurde der Viehhändler A. Blumenfeld seit dem 25.
August, seit dem Viehmarkt in Gießen, vermisst. Die Polizeibehörde
Wiesbaden hat den Angehörigen Blumenfelds gemeldet, dass die Leiche aus
dem Rhein bei Schierstein geländet
worden ist. Ob ein Unfall oder ein Verbrechen vorliegt, müssen die
polizeilichen Ermittlungen ergeben. Freitod scheint nach den
wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen ausgeschlossen. Den
Angehörigen bringt man die größte Teilnahme
entgegen." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 11. September 1931: "Momberg. Wie wir
berichteten, wurde der Viehhändler A. Blumenfeld seit dem 25.
August, seit dem Viehmarkt in Gießen, vermisst. Die Polizeibehörde
Wiesbaden hat den Angehörigen Blumenfelds gemeldet, dass die Leiche aus
dem Rhein bei Schierstein geländet
worden ist. Ob ein Unfall oder ein Verbrechen vorliegt, müssen die
polizeilichen Ermittlungen ergeben. Freitod scheint nach den
wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen ausgeschlossen. Den
Angehörigen bringt man die größte Teilnahme
entgegen." |
Familiennachrichten (1934)
 Mitteilungen
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1934: "Momberg,
8. Oktober (1934). Herr Heinemann Blumenfeld hier feierte heute
seinen 80. Geburtstag und wird am 22. dieses Monats mit seiner Frau
Karoline geb. Katzenstein das Fest der Goldenen Hochzeit begehen. Alles
Gute bis 120 Jahre. Mitteilungen
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1934: "Momberg,
8. Oktober (1934). Herr Heinemann Blumenfeld hier feierte heute
seinen 80. Geburtstag und wird am 22. dieses Monats mit seiner Frau
Karoline geb. Katzenstein das Fest der Goldenen Hochzeit begehen. Alles
Gute bis 120 Jahre.
Momberg, 9. Oktober (1934). Frau Bertha Blumenfeld geb.
Alexander, begeht am 16. Oktober ihren 75. Geburtstag. Alles
Gute bis 120 Jahre." |
Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Werbung der Nudelfabrik Joseph Spier für
koschere Nudeln (1922)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. August 1922:
"Koscher - Nudeln - Koscher. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. August 1922:
"Koscher - Nudeln - Koscher.
Referenz Rabbiner Dr. Cohn Marburg. Spezialität Hausmacher-Eiernudeln.
Beste Bezugsquelle für Restaurations und Speiseanstalten.
Wiederverkäufer gesucht.
Nudelfabrik Joseph Spier, Momberg, Kreis Kirchhain." |
Rabbiner Dr. Cohn hat die Aufsicht
über die Mazzenfabrik Josef Spier in Momberg (1925)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Februar 1925:
"Zur gefälligen Kenntnisnahme! Meiner Aufsicht unterstehen auch in
diesem Jahre folgende Mazzosbäckereien: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Februar 1925:
"Zur gefälligen Kenntnisnahme! Meiner Aufsicht unterstehen auch in
diesem Jahre folgende Mazzosbäckereien:
Firma Josef Spier in Momberg,
Firma Steinfeldt Witwe in Josbach,
Firma Hilker & Schmalz in Kassel (Letztere unter Mitaufsicht des Herrn
Landrabbiner Dr. Walter).
Provinzial-Rabbiner Dr. Cohn - Marburg." |
Verlobungsanzeige für Betty Poritzky und Ephraim Lipsker (1925)
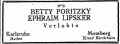 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Oktober 1925: "Gott
sei gepriesen. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Oktober 1925: "Gott
sei gepriesen.
Betty Poritzky - Ephraim Lipsker. Verlobte.
Karlsruhe Baden - Momberg Kreis Kirchhain". |
Sonstiges
Briefumschlag
von Joseph Spier
aus Momberg (1923)
(aus der Sammlung von
Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries) |
 |
|
|
Es handelt sich um einen an Dr. Willi Wertheim,
Rechtsanwalt in Marburg adressierten Briefumschlag, versandt von Joseph Spier aus Momberg am 9.1.1923.
Der Absender Joseph Spier besaß in Momberg eine Nudelfabrik (siehe oben
die Anzeige In der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. August 1922 und vom 26. Februar 1925).
Am 16. Mai feierten der Kaufmann Joseph Spier und seine Frau Sara geb. Stern
ihre Goldene Hochzeit (siehe Bericht oben). Die Familie Spier zählte zu den alt eingesessenen jüdischen Familien in Momberg. Bereits zu Anfang des 19. Jahrhunderts befand
sich im Haus von Michael Spier ein rituelles Bad (1825). Joseph Spier
ist am 8. April 1824 in Momberg geboren als Sohn des Michael Spier und seiner Frau
Sprinz geb. Spier. Er war verheiratet mit Sara (Sarchen) geb. Stern
aus Reichensachsen. Joseph Spier war Handelsmann, Seifensieder und Bäcker.
Er starb am 8. Juni 1914. Joseph Spier und seine Frau Sara liegen begraben auf dem jüdischen Friedhof in
Neustadt-Hessen.
Der Briefempfänger war Dr. Willi Wertheim, geboren am 28. Januar
1892 in Hatzbach als Sohn von Meier und Juliana Wertheim. Nach
einem unterbrochenem Studium wegen Kriegsteilnahme im Ersten Weltkrieg promovierte er anschließend im Studienfach Jura und
eröffnete 1919 seine erste Praxis als Rechtsanwalt, ab 1925 in Gemeinschaftspraxis mit Hermann Reis. Nach dem
Berufsverbot für Anwälte floh Willy Wertheim 1933 nach Frankreich. 1937
wurde ihm in Abwesenheit die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt. Am 21. Februar 1943
wurde er ins Sammellager Drancy bei Paris eingeliefert. Am 4. März 1943
wurde er nach Lublin / Majdanek deportiert und ermordet.
Quellen: http://www.geschichtswerkstatt-marburg.de/projekte/werth.php
http://elisabethschule.de/de/schule/publikationen/experiment-sonderheft.html
http://www.lagis-hessen.de/de/subjects/gsrec/current/3/sn/juf?q=neustadt+joseph+spier
. |
Zur Geschichte der Synagoge
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts besuchten die Momberger Juden
die Synagoge in Neustadt. Eine eigene Synagoge in Momberg wurde erbaut, nachdem es
um 1850 in der Synagoge in Neustadt
zu eng wurde. Zunächst war 1857 in Neustadt auf
Grund von Plänen des Kirchhainer Landbaumeisters eine Erweiterung der Synagoge geplant,
jedoch wurde schließlich nur eine Reparatur vorgenommen, nachdem die in Momberg lebenden
jüdischen Familien eine eigene Synagoge erbauen und nicht mehr zu den
Gottesdiensten nach Neustadt kommen wollten. Am 19. April 1858 konnte der
Momberger Gemeindeälteste Blumenfeld dem Marburger Vorsteheramt mitteilen, der
Betsaal sei zur Abhaltung von Gottesdiensten soweit hergerichtet.
Bei der Momberger Synagoge handelt es sich um ein von drei Seiten freistehendes
Gebäude, unmittelbar neben einem Bauernhof, an dessen Wohnhaus angegliedert.
Nach der Überlieferung am Ort wurde eine ehemalige Scheune aus dem
Ebsdorfergrund abgebaut, nach Mombert gebracht und zu einer Synagoge umgebaut. Der Toraschrein war im Bereich des späteren Scheunentores (nach 1945). In der
Momberger Synagoge gab es 40 Plätze für Männer, 22 für Frauen. Die Decke der
Synagoge war teilweise mit einem Sternenhimmel bemalt.
Vermutlich wurde die Synagoge Anfang des 20. Jahrhunderts grundlegend umgebaut,
worauf einige Ungereimtheiten in der noch erhaltenen Inneneinrichtung und
Veränderungen in der Bemalung hinweisen.
Beim Novemberpogrom 1938 wurden die gesamte Inneneinrichtung und alle
Kultgegenstände restlos zerstört. Das gleichfalls beschädigte
Synagogengebäude wurde wenig später an einen Landwirt verkauft, der das
äußere Erscheinungsbild des Gebäudes stark veränderte und dieses danach als
Scheune verwendete. Später war das Gebäude Abstellraum (mindestens seit Anfang
der 1980er-Jahre).
Adresse/Standort der Synagoge: Burggasse
10 (früher: Haus
Nr. 58)
Fotos
(Quelle: Altaras 1988 S. 105; 2007 S. 70; Fotos von 1984
und 1999).
 |
 |
 |
| Die ehemalige
Synagoge in Momberg; im Bereich des Scheunentores (rechts) befand sich
einst der Toraschrein. |
| |
|
|
| |
 |
 |
| |
Wandbemalung über den
Toraschrein |
Deckenbemalung |
| |
|
|
| |
 |
 |
| |
Teil eines Wandfrieses -
charakteristische Schablonenmalerei |
Rundbogenfenster im
Obergeschoss -
nur von innen zu sehen |
| |
|
|
| |
Aktuelle Fotos
werden noch erstellt; über Zusendungen freut sich der Webmaster der
"Alemannia Judaica"; Adresse siehe Eingangsseite. |
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Besuche von Gisela
Spier-Cohn aus Momberg - Schulbesuch in der Elisabethschule Marburg Lahn
(Quelle: Website
der Elisabethschule) |
 Gisela Spier-Cohen wieder zu Besuch.
Wie schon in den vergangenen Jahren besuchte auch dieses Jahr Gisela Spier-Cohen aus Momberg, heute wohnhaft in Toronto, die Elisabethschule und erzählte am Dienstag, 8. März 2005, vor den Schülern der Klasse 10a aus ihrem Leben. Gisela Spier-Cohen wieder zu Besuch.
Wie schon in den vergangenen Jahren besuchte auch dieses Jahr Gisela Spier-Cohen aus Momberg, heute wohnhaft in Toronto, die Elisabethschule und erzählte am Dienstag, 8. März 2005, vor den Schülern der Klasse 10a aus ihrem Leben.
Als Organisatoren danken Frau Kraatz und Frau Neumann der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und der Ernst-Ludwig-Chambré-Stiftung, die diese Veranstaltung erst ermöglicht haben.
Bericht der Klasse 10a: Wir sprechen in Geschichte gerade über die Zeit von 1933 bis 1945. Deshalb luden wir Frau Spier-Cohen zu uns ein.
Geboren am 29.11.1929 in Momberg bei Neustadt erlebte sie als Tochter einer angesehenen jüdischen Familie die NS-Zeit. Erst durch die "Kristallnacht" wurde ihr bewusst, in welch schrecklicher Welt sie lebte. Für sie bedeutete das: Die
Mazzen-Fabrik ihres Vaters wurde zerstört, die örtliche Synagoge ausgeraubt. Sie selbst durfte ein Jahr nicht zur Schule gehen. Ab 1939 musste sie in der unbekannten Großstadt Frankfurt in eine jüdische Schule gehen, musste den Judenstern tragen und wurde auf der Straße beschimpft. 1942 wurde sie mit ihrem Bruder und ihren Eltern ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Dort bedrückte sie besonders, dass es ihren Eltern immer schlechter ging, weil sie zu wenig zu essen bekamen. Sie selbst lebte in einer Kindergruppe, musste aber in der Landwirtschaft arbeiten. Im Oktober 1944 wurde sie nach Auschwitz deportiert. Sie folgte freiwillig ihren Eltern, weil sie versprochen hatte, sich um sie zu kümmern. Durch die Trennung von ihren Eltern und deren sofortige Vergasung unmittelbar nach der Ankunft verlor sie ihren Lebenswillen. Sie selbst wurde in ein Arbeitslager verschleppt und musste in einer Maschinenfabrik in Sachsen schuften. Dort bekam sie zu wenig zu essen:
"Zu wenig zum Leben und zuviel zum Sterben". Als sie im Mai 1945 in Mauthausen befreit wurde, wog sie im Alter von 16 Jahren noch 45 Pfund.
Die Erzählung von Frau Spier Cohen war sehr eindrucksvoll, nur "Kälte und Hunger kann man mit Worten nicht wiedergeben". |
| |
| |
Hinweis:
Videokassetten - Zeitzeugen-Interviews auf DVD - Fritz Bauer Institut
- VIdeokasette zu Gisela Spier-Cohen: Gisela Spier-Cohen.
Erinnerungen an Jugend und Konzentrationslager
Gisela Spier-Cohen, geboren 1928 in Momberg (Hessen)
Interview: Gottfried Kößler, Kamera: Christof Heun
Schnitt: Bernd Zickert, Recherche: Regina Neumann
Copyright: © Gisela Spier-Cohen und Fritz Bauer Institut
Eine Produktion des Fritz Bauer Instituts in Zusammenarbeit mit dem ZMDI im HeLP, dem HeLP/Regionalstelle Marburg und dem Filmhaus Frankfurt
Frankfurt am Main 1999, VHS, 100 min (f), D
Das Video-Interview mit Gisela Spier-Cohen
liegt auch in einer für den Schulunterricht auf ca. 35 min gekürzten Fassung vor.
Bearbeitung: Klaus Heuer, Schnitt: Kristina Heun
Copyright: © Gisela Spier Cohen und Fritz Bauer Institut
Eine Produktion des Fritz Bauer Institut in Zusammenarbeit mit dem ZMDI im HeLP
Frankfurt am Main 1999/2001, VHS, 35 min (f), D. |
- Videokasette zu Ruth Lion:
Ruth Lion. Ein Leben zwischen Konzentrationslager und Dorfgemeinschaft.
Interview mit Ruth Lion aus Momberg, 1998
Ruth Lion, geboren 1909 in Momberg (Hessen), erzählt vom Zusammenleben in einem Dorf mit einer großen jüdischen Minderheit vor 1933, von der Erfahrung des Antisemitismus, der Deportation nach Riga und dem Überleben im Lager, von der Rückkehr in das Dorf und ihrem Leben dort von 1945 bis 2000.
Interview 1998
Interview: Monica Kingreen und Gottfried Kößler, Kamera: Christof Heun
Schnitt: Christina Heun, Bearbeitung: Klaus Heuer
Copyright: © Ruth Lion und Fritz Bauer Institut
Eine Produktion des Fritz Bauer Instituts in Zusammenarbeit mit dem ZMDI im HeLP
und dem HeLP/Regionalstelle Marburg
Frankfurt am Main 2013 (VHS 2000), DVD, 33 min, € 5,–. |
Links und Literatur
Links:
Quellen:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -
Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. II S. 124-126 (unter Neustadt) |
 | Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit
1945? 1988 S. 105-106. |
 | dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in
Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 90. |
 | dies.: Neubearbeitung der beiden Bücher. 2007. S.
70.90. |
 | Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1995 S. 159-160. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume
III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992
(hebräisch) S. 518 (im Anschluss an den Abschnitt zu Neustadt). |
 | Barbara Händler-Lachmann / Ulrich Schütt:
"unbekannt verzogen" oder "weggemacht". Schicksale der
Juden im alten Landkreis Marburg 1933-1945. Marburg 1992. |
 | Barbara Händler-Lachmann / Harald Händler
/Ulrich Schütt: 'Purim, Purim, ihr liebe Leut, wißt ihr was Purim
bedeut?' - Jüdisches Leben im Landkreis Marburg im 20. Jahrhundert. Marburg
1995. |
 | Gisela Spier-Cohen: Weggerissen. Erinnerungen an
Theresienstadt. Jonas Verlag. 2005. ISBN
10-3894453567. |
 |  Alfred Schneider: Die jüdischen Familien im
ehemaligen Kreise Kirchhain. Beiträge zur Geschichte und Genealogie der
jüdischen Familien im Ostteil des heutigen Landkreises Marburg-Biedenkopf
in Hessen. Hrsg.: Museum Amöneburg. 2006. Alfred Schneider: Die jüdischen Familien im
ehemaligen Kreise Kirchhain. Beiträge zur Geschichte und Genealogie der
jüdischen Familien im Ostteil des heutigen Landkreises Marburg-Biedenkopf
in Hessen. Hrsg.: Museum Amöneburg. 2006.
|
n.e.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|