|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
Synagogen in Bayerisch Schwaben
Buttenwiesen (Landkreis Dillingen an der Donau)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Es besteht eine weitere Seite
mit Texten zur jüdischen Geschichte in Buttenwiesen (interner
Link)
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
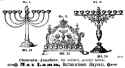 links:
Anzeige von Max Lamm, Buttenwiesen in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 12.11.1896. links:
Anzeige von Max Lamm, Buttenwiesen in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 12.11.1896.
In Buttenwiesen bestand eine jüdische Gemeinde bis 1940/42. Ihre Entstehung
geht in die Zeit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zurück. Die erste
urkundliche Nennung von Juden am Ort stammt aus dem Jahr 1599. Als
während dem Dreißigjährigen Krieg (1617/18) die Juden der österreichischen
Orte in der Markgrafschaft Burgau und im 18. Jahrhundert die Juden der Herrschaft
Pfalz-Neuburg ausgewiesen wurden, wurden jeweils mehrere Familien in
Buttenwiesen aufgenommen. 1790 wurden bereits 66 jüdische Familien am Ort
gezählt
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1807 298 jüdische Einwohner, 1811/12 352 (64,8 % von insgesamt 543
Einwohnern), 1824 81 jüdische Familien, 1840 63 Fam., 1856 78 Fam., 1867 344
jüdische Einwohner (42,7 % von 806), 1880 267 (32,3 % von 827), 1890 232 (29,5
% von 787), 1900 192 (25,5 % von 754), 1910 148 (17,9 % von 826).
Im 18./19. Jahrhundert war Buttenwiesen zeitweise
Rabbinatssitz: nach 1789 wirkte hier Rabbi Lammfromm. Nach seinem Tod
gehörte Buttenwiesen zum Rabbinat Binswangen,
bis von 1831 bis 1880 Rabbi Jonas (Jontof) Sänger das Rabbinat Buttenwiesen innehatte. Nach
seinem Tod wurde das Rabbinat Buttenwiesen aufgelöst und mit dem
Distriktsrabbinat Ichenhausen verbunden.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde u.a. eine Synagoge (s.u.),
eine israelitische Volksschule (Elementarschule) in einem 1906 renovierten
Schulhaus, ein rituelles Bad (Schulplatz 8, erstmals 1807 genannt; neues
Gebäude von 1860 erhalten) und einen Friedhof.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben war (im 19. Jahrhundert neben dem Rabbiner)
ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter (Kantor) und Schochet tätig
war.
Mehrere
jüdische Vereine entstanden: eine Chewra Kaddischa (Gemillus
Chessed,
Beerdigungsbruderschaft), ab 1843 eine Heilige Schwesternschaft (bzw.
Israelitischer Frauenverein), etwas später der Wohltätigkeitsverein Dower-Tow und
schließlich eine Ortsgruppe des Centralvereins
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens.
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Moritz Fuchs (geb.
27.10.1887 in Buttenwiesen, gef. 31.10./1.11.1916), Theodor M. Hummel (geb. 27.7.1990
in Buttenwiesen, gef. 22.3.1918) und Adolf Neuburger (geb. 3.3.1898 in
Buttenwiesen, gef. 20.9.1917). Ihre Namen stehen auf dem Kriegerdenkmal
für die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege auf dem Marktplatz in
der Mitte der Gemeinde (achteckiger Obelisk). In der Eingangshalle des neuen
Rathauses der Gemeinde Buttenwiesen am Marktplatz 4 wurde außerdem - unter
den aus der früheren Synagoge geborenen Tafeln mit den Zehn Geboten - die von
der ausgelöschten jüdischen Gemeinde gestiftete kupferne Gedenktafel für die
drei Gefallenen, Ebenfalls aus der einstige Synagoge stammend,
angebracht.
Um 1925, als noch 98 jüdische Gemeindeglieder gezählt wurden (12,1 %
von insgesamt 807 Einwohner), waren die Vorsteher der jüdischen Gemeinde: Leo
Reiter, Siegfried Luchs, Israel Lammfromm, Hermann Frank, Theodor Hummel, Karl
Reiter, Josef Neuburger. Als Lehrer, Kantor und Schochet war Moses Sonn
angestellt (geb. 1880 in Mainstockheim
als Sohn des Lehrers Jakob Sonn). Er unterrichtete damals an der jüdischen Volksschule 14 Kinder. 1932
war erster Vorsitzender der Gemeinde weiterhin Leo Reiter, 2. Vorsitzender und
Schatzmeister Siegfried Luchs, Schriftführer war Hugo Lammfromm. In der
Repräsentanz war 1. Vorsitzender Sigmund Luchs, 2. Vorsitzender Adolf Leiter.
1933 lebten noch 73 jüdische Personen in Buttenwiesen
(9,2 % von insgesamt 790 Einwohnern). Auf Grund der zunehmenden Repressalien und
der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts ist etwa die Hälfte der jüdischen
Einwohner in den folgenden Jahren vom Ort verzogen beziehungsweise
ausgewandert: Von den zwischen 1934 und 1941 vom Ort verzogenen Personen konnten
sechs in die USA, drei nach Südamerika, zwei nach Kuba und je einer nach
England und in die Tschechoslowakei emigrieren, 14 zogen in andere deutsche
Orte. Im April 1938 beging ein jüdischer Einwohner Selbstmord, nachdem Beamte
der NSDAP sein Haus durchsucht und seine Geschäftsbücher beschlagnahmt hatten.
Beim Novemberpogrom 1938 wurde in der Synagoge die Fenster eingeschlagen
und die gesamt Inneneinrichtung mit den Ritualien vernichtet (s.u.). Auch in den
jüdischen Häusern und Läden wurden die Fenster eingeschlagen und Wertsachen
geraubt. Das Ende der jüdischen Gemeinde kam mit der Deportation
der letzten 37 jüdischen Einwohner am 3. April 1942 nach Piaski bei
Lublin (Polen).
Von den in Buttenwiesen geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Brunhilde (Hilde) Ackermann geb. Luchs (1915), Henriette Bauer
(1867), Josef Bauer (1863), Meta Bauer (1917), Eduard Bernheimer (1908), Lina
(Leni) Bernheimer geb. Lammfromm (1859), Thekla Bernheimer geb. Bauer (1873),
Frieda Dampf (1899), Emma Einstein (1866), Isidor Einstein (1861), Jacob Einstein
(1861), Karoline Einstein (1872), Thekla Einstein (1887), Betty Epstein geb,
Lammfromm (1899), Klara Feibelmann geb. Einstein (1885), Ernst Frank (1908),
Fanny Frank geb. Fuchs (1890), Gerhard
Frank (1912), Hermann Frank (1875), Karl Frank (1904), Ludwig Frank (1912),
Therese Frank geb. Frank (1872), Emma Fromm geb. Stern (1889), Hilda (Hilde)
Goldstein geb. Einstein (1860), Ida Gutmann geb. Leiter (1876), Jette Hirsch
geb. Lammfromm (1870), Klara Hübner geb. Bauer (1866), Benno Hummel (1917), Fanny Hummel geb. Sänger
(1877), Leo Hummel (1883), Leopold Hummel (1886), Ludwig Hummel (1912), Paula Hummel geb.
Lang (1904), Theodor Hummel (1878), Therese Jakobsohn geb. Leiter (1879), Samuel
Kleiner (1870), Berthold Kreisle (1883), Louis Lamm (1870), Paula Lamm geb. Hummel (1912), Bella Lammfromm (1888), Berta
Lammfromm geb. Birnzweig (191), Elias Lammfromm (1869), Erwin Lammfromm (1934),
Frieda Lammfromm geb. Libmann (1883), Hans Jacob Lammfromm (1933), Hermann
Lammfromm (1891), Hugo Lammfromm (1902), Josef Lammfromm (1888), Kurt Lammfromm
(1937), Ludwig Lammfromm (1895), Paula Lammfromm geb. Hummel (1908), Selma
Lammfromm (1889), Siegfried Lammfromm (1921), Siegfriede Lammfromm geb. Neumann
(1905), Isidor F. Leiter (1894), Jakob Leiter (1893), Lazarus Leiter (1859), Herta Leven geb. Luchs (1902), Hedwig Lindemann
geb. Reiter (1879), Mathilde Lion geb. Hummel (1915), Amalie Löwenstein geb.
Neuburger (1890), Amalie Luchs geb. Luchs (1873), Ida Luchs geb. Bermann
(1888), Moritz Luchs (1865), Siegfried Luchs (1880), Rosa Maier geb. Leiter
(1888), Martha Metzger (1888), Nathan Metzger (1877),
Else Neuburger geb. Fleischmann (1884), Emma (Emmy) Neuburger geb. Wild (1896), Ilse
Neuburger (1926), Irma Neuburger (1922), Josef Neuburger (1891), Leo Neuburger
(1899), Ruth Neuburger (1927), Trude Neuburger (1921), Walter Neuburger (1932),
Ida Niedermaier geb. Fuchs (1866), Ida (Jette) Osenbrunner geb. Einhorn (1870), Hannelore Pless (1931),
Josef Pless (1895), Selma Pless geb. Kahn (1896), Fanny Reiter (1873), Frieda
Reiter geb. Hummel (1894), Fritz Reiter (1873), Ida
Reiter geb. Ullmann (1880), Josef Reiter (1869), Josef Reiter (1877), Kurt
Reiter (1923), Leo Reiter (1875), Frieda Reitzenstein geb. Einhorn (1875),
Hedwig Rödelsheimer geb. Dampf (1894), Frieda Rosenstiel geb. Reiter (1905),
Albert Rothschild (1867), Heinrich Rothschild (1861), Ida Rothschild geb. Weil (1869), Julius Rothschild
(1878), Gela Sänger geb. Hirsch (1871), Joel Sänger (1892), Max Sänger
(1878), Meier Sänger (1876), Willy Sänger (1893), Klothilde (Tilde) Schindler geb. Stern (1894),
Caroline (Lina) Schloss geb. Einstein (1864), Martin Schloss (1925), Siegfried Schloss
(1896), Amalie Sicherer geb. Schloss (1890), Berta Stern (geb. ?), Dora Stern
geb. Hauser (1882), Julius Stern
(1896), Karoline Stern geb. Schmid (1900), Sophie Stern (1902), Lia Sternberg
geb. Fleischmann (1878), Adolf Strauss (1885), Marta Weinmann geb. Leiter
(1881), Bertha Wolf geb. Ullmann (1872), Jenni Wolf geb. Löwenstein (1896).
Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge.
Eine erste Synagoge ist um 1630 erbaut worden. Sie wurde 1852
bei einem Brand erheblich beschädigt.
Danach ließ die jüdische Gemeinde 1856/57 eine neue Synagoge erbauen.
Sie entstand nach Plänen des Baumeisters Josef Kratzer aus Unterthürheim. Bei
der Einweihung am 20./21. Februar 1857 sprach Jontof (Jonas) Sänger, der
damalige Rabbiner am Ort das Weihegebet.
Die Einweihung der Synagoge (1857)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 23. März 1857:
"Aus
Schwaben, im März (1857). Freitag, den 20. Februar dieses Jahres wurde in Buttenwiesen
eine neue Synagoge feierlich eingeweiht. Nachmittags 1 Uhr setzte sich der
festliche Zug nach dem neuen Gotteshause in Bewegung; während desselben wurden
von der Schuljugend zwei Lieder aus dem Gesangbuche von Dr. Philippson unter
Blechmusikbegleitung gesungen. Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 23. März 1857:
"Aus
Schwaben, im März (1857). Freitag, den 20. Februar dieses Jahres wurde in Buttenwiesen
eine neue Synagoge feierlich eingeweiht. Nachmittags 1 Uhr setzte sich der
festliche Zug nach dem neuen Gotteshause in Bewegung; während desselben wurden
von der Schuljugend zwei Lieder aus dem Gesangbuche von Dr. Philippson unter
Blechmusikbegleitung gesungen.
Der eigentliche Einweihungsakt nach Eröffnung der Synagoge durch den
Königlichen Herrn Landrichter Rupprecht ging unter Leitung des Herrn Rabbiners
Sänger nach gewöhnlichem Zeremoniell und unter lautloser Stille würdevoll vor
sich.
Den Schluss bildete der Hallelujah in dem bezeichneten Gesangbuche, der, von
einem gemischten Chore unter Blechmusikbegleitung vorgetragen, so mächtig auf
die ganze Versammlung wirkte, dass ihn Schreiber dieses in jede Synagoge
eingeführt wissen möchte.
Der sabbatliche Abend- und Morgengottesdienst schloss sich dieser erhabenen
Feier, zu der sich eine große Anzahl Fremder aus der Nähe und Ferne
eingefunden hatte, würdig an. Die Wechselgebete wurden vom Vorbeter und Chore
unter Direktion des Herrn Lehrers Heilbronner mit vieler Würde
vorgetragen.
Was den Neubau selbst betrifft, so entspricht derselbe in allen seinen Teilen
seinem heiligen Zwecke, und haben einzelne Vereine und Personen durch wertvolle
Spenden die Kultusgemeinde zu hohem Danke sich verpflichtet.
Möge der, der über den Cherubim thront, segnend und schützend herabblicken
auf die fromme Kehilla (= Gemeinde), die, ihm zur Ehre, sich zum Heile, mit so
stiller, friedlicher Opferbereitwilligkeit einen so herrlichen Tempel gebaut!
|
Bisweilen erfährt man in den jüdischen Periodika in
den folgenden Jahrzehnten von besonderen Gottesdiensten in der Synagoge in
Buttenwiesen:
Gottesdienstliche Feier in der Synagoge zum 100jährigen Geburtstag von Sir
Moses Montefiore (1884)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. November 1884: "Buttenwiesen,
27. Oktober (1884). Gestern Abend, als dem Vorabend des 100jährigen
Geburtstages des großen Philanthropen Sir Moses Montefiore, wurde in
hiesiger, festlich beleuchteter Synagoge diese Feier unter zahlreicher
Beteiligung der jüdischen Einwohner abgehalten. – Nach dem Mincha-Gebet
wurden Psalm 100 und 13 rezitiert und vom Kantor die Verse Barchi
Nafschi etc. vorgetragen. Herr Lehrer Heilbronner bestieg sodann die
Kanzel und hob in warmen Worten die Bedeutung dieses Festes hervor und
schloss seinen Vortrag mit dem in Nr. 81 des ‚Israelit’ abgedruckten
Gebete. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. November 1884: "Buttenwiesen,
27. Oktober (1884). Gestern Abend, als dem Vorabend des 100jährigen
Geburtstages des großen Philanthropen Sir Moses Montefiore, wurde in
hiesiger, festlich beleuchteter Synagoge diese Feier unter zahlreicher
Beteiligung der jüdischen Einwohner abgehalten. – Nach dem Mincha-Gebet
wurden Psalm 100 und 13 rezitiert und vom Kantor die Verse Barchi
Nafschi etc. vorgetragen. Herr Lehrer Heilbronner bestieg sodann die
Kanzel und hob in warmen Worten die Bedeutung dieses Festes hervor und
schloss seinen Vortrag mit dem in Nr. 81 des ‚Israelit’ abgedruckten
Gebete.
Die ganze Feier machte auf alle Anwesenden einen sichtlich ergreifenden
Eindruck und jeder schied mit dem Wunsche im Herzen: ‚Möge der Allvater
diesen Jubelgreis noch lange zur Zierde Israels und der Menschheit im
Allgemeinen erhalten.’ R." |
Gottesdienst zur Goldenen Hochzeit von Baruch Fuchs und
Karoline geb. Bauer (1896)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Februar 1896: "Buttenwiesen,
5. Februar (1896). Ein Fest, wie es seit Menschengedenken, oder wohl noch
niemals in hiesiger Gemeinde gefeiert wurde, fand heute dahier statt –
das Fest einer goldenen Hochzeit. Die Jubilare sind Herr Baruch Fuchs und
seine Frau Karoline geb. Bauer, beide von hier gebürtig. Die Feier begann
mit einem Festgottesdienste in der Synagoge, welcher durch ein
hebräisches Chorlied (Psalm 150) eingeleitet wurde. Hierauf folgte die
Festpredigt von Herrn Rabbiner Dr. Kohn aus Ichenhausen. In meisterhafter
Rede schilderte der Herr Rabbiner das bisherige verdienstvolle Leben und
Wirken der beiden greisen Jubilare. Besonders wies der Redner darauf hin,
dass sich die Jubilare der größten Beliebtheit zu erfreuen haben, wovon
auch das Erscheinen nicht nur aller hiesigen Israeliten, sondern auch das
einer kolossalen Menge Nichtjuden, sowie auch der politischen
Gemeindeverwaltung in der Synagoge beredtes Zeugnis ablegten. Den Schluss
des Gottesdienstes bildete wiederum ein Chorlied. Bei dem später
stattgefundenen Festessen überreichte Herr Kultusvorstand Ullmann im
Namen der israelitischen Kultusverwaltung, deren Mitglied Herr Fuchs seit
18 Jahren ist, einen prachtvollen Becher. Begeistert wurde in die große
Zahl der auf das Jubelpaar ausgebrachten Toaste eingestimmt. Die Synagoge
sowohl als die Fest-Gäste waren dem Feste entsprechend sehr schön
dekoriert und wird die erhabene, seltene Feier in aller Teilnehmer
Erinnerung bleiben. K.M.N." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Februar 1896: "Buttenwiesen,
5. Februar (1896). Ein Fest, wie es seit Menschengedenken, oder wohl noch
niemals in hiesiger Gemeinde gefeiert wurde, fand heute dahier statt –
das Fest einer goldenen Hochzeit. Die Jubilare sind Herr Baruch Fuchs und
seine Frau Karoline geb. Bauer, beide von hier gebürtig. Die Feier begann
mit einem Festgottesdienste in der Synagoge, welcher durch ein
hebräisches Chorlied (Psalm 150) eingeleitet wurde. Hierauf folgte die
Festpredigt von Herrn Rabbiner Dr. Kohn aus Ichenhausen. In meisterhafter
Rede schilderte der Herr Rabbiner das bisherige verdienstvolle Leben und
Wirken der beiden greisen Jubilare. Besonders wies der Redner darauf hin,
dass sich die Jubilare der größten Beliebtheit zu erfreuen haben, wovon
auch das Erscheinen nicht nur aller hiesigen Israeliten, sondern auch das
einer kolossalen Menge Nichtjuden, sowie auch der politischen
Gemeindeverwaltung in der Synagoge beredtes Zeugnis ablegten. Den Schluss
des Gottesdienstes bildete wiederum ein Chorlied. Bei dem später
stattgefundenen Festessen überreichte Herr Kultusvorstand Ullmann im
Namen der israelitischen Kultusverwaltung, deren Mitglied Herr Fuchs seit
18 Jahren ist, einen prachtvollen Becher. Begeistert wurde in die große
Zahl der auf das Jubelpaar ausgebrachten Toaste eingestimmt. Die Synagoge
sowohl als die Fest-Gäste waren dem Feste entsprechend sehr schön
dekoriert und wird die erhabene, seltene Feier in aller Teilnehmer
Erinnerung bleiben. K.M.N." |
Eine besondere Feier stand Anfang Februar 1927
an, als das 50-jährige Bestehen der Synagoge mit einem feierlichen Gottesdienst
begangen werden konnte.
Feier zum 50jährigen Bestehen der Synagoge (1907)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar 1907: "Buttenwiesen,
20. Februar (1907). Am Freitag, den 8. Februar, beging die hiesige
jüdische Gemeinde die Feier des 50-jährigen Bestehens ihrer Synagoge.
Vor 50 Jahren war die alte Synagoge nach 200-jährigem Bestand einem Brand
zum Opfer gefallen und die gegenwärtige an ihrer Stelle errichtet worden.
Anlässlich der Feier war die Synagoge durch Herrn Lammfromm in sinniger
Weise geschmückt worden. Die gesamte jüdische Gemeinde sowie ein großer
Teil der katholischen Mitbürger versammelten sich in dem Gotteshaus, wo
nach einem Einleitungsgesang und dem Minchagebet Herr Rabbiner Dr. Cohn
– Ichenhausen die Festpredigt hielt, in der er die Bedeutung des Tages
würdigte. Nach Schabbatausgang (Samstagabend, 9. Februar)
vereinigte sich die Gemeinde zu einem Bankett, auf welchem Herr Lammfromm
in einer Ansprache einen Rückblick auf die Vergangenheit warf und Herrn
Dr. Cohn und dem bereits 30 Jahre amtierenden Herrn Vorsteher Sal. Ullmann
für ihr segensreiches Wirken dankte. Ein Telegramm, das man an den
Prinzregenten absandte, wurde in wohlwollender Weise erwidert. Herr
Pfarrer Helmstädt, der außer einigen anderen Herren noch das Wort
ergriff, drückte den Wunsch aus, dass die Eintracht zwischen den
Konfessionen wie bisher weiter erhalten bleiben möge, er werde hierzu
stets das Seinige Beitragen. Der unterhaltende
Teil der Veranstaltung, der dann folgte, hielt die Anwesenden bis in die
frühen Morgenstunden zusammen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. Februar 1907: "Buttenwiesen,
20. Februar (1907). Am Freitag, den 8. Februar, beging die hiesige
jüdische Gemeinde die Feier des 50-jährigen Bestehens ihrer Synagoge.
Vor 50 Jahren war die alte Synagoge nach 200-jährigem Bestand einem Brand
zum Opfer gefallen und die gegenwärtige an ihrer Stelle errichtet worden.
Anlässlich der Feier war die Synagoge durch Herrn Lammfromm in sinniger
Weise geschmückt worden. Die gesamte jüdische Gemeinde sowie ein großer
Teil der katholischen Mitbürger versammelten sich in dem Gotteshaus, wo
nach einem Einleitungsgesang und dem Minchagebet Herr Rabbiner Dr. Cohn
– Ichenhausen die Festpredigt hielt, in der er die Bedeutung des Tages
würdigte. Nach Schabbatausgang (Samstagabend, 9. Februar)
vereinigte sich die Gemeinde zu einem Bankett, auf welchem Herr Lammfromm
in einer Ansprache einen Rückblick auf die Vergangenheit warf und Herrn
Dr. Cohn und dem bereits 30 Jahre amtierenden Herrn Vorsteher Sal. Ullmann
für ihr segensreiches Wirken dankte. Ein Telegramm, das man an den
Prinzregenten absandte, wurde in wohlwollender Weise erwidert. Herr
Pfarrer Helmstädt, der außer einigen anderen Herren noch das Wort
ergriff, drückte den Wunsch aus, dass die Eintracht zwischen den
Konfessionen wie bisher weiter erhalten bleiben möge, er werde hierzu
stets das Seinige Beitragen. Der unterhaltende
Teil der Veranstaltung, der dann folgte, hielt die Anwesenden bis in die
frühen Morgenstunden zusammen." |
Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung der Synagoge und
die Ritualien vollständig zerstört.
Das Gebäude kam in den Besitz der
politischen Gemeinde Buttenwiesen, die es nach gründlichem Umbau von 1953 bis
1994 als Schule benutzte. Seitdem wird u.a. ein Raum im Erdgeschoss von der
evangelischen Kirchengemeinde genützt, andere Räume für kulturelle Zwecke von
der Gemeinde und Vereinen. Seit 1995 steht vor der ehemaligen Synagoge ein
Gedenkstein zur Erinnerung an die jüdische Gemeinde. Seit Ende 2009 befindet
sich in der ehemaligen Synagoge der "Freie Kindergarten Buttenwiesen"
(siehe Pressebericht unten).
In der Eingangshalle des neue Rathauses der Gemeinde Buttenwiesen am Marktplatz
4 sind die aus der früheren Synagoge geborgenen Tafeln mit den Zehn Geboten -
zusammen mit der aus der Synagoge stammenden Gefallenengedenktafeln des Ersten
Weltkrieges - angebracht.
Adresse der Synagoge:
Schulplatz 6.
Fotos
Historische Aufnahmen:
(Foto obere Zeile links: Dr. Ludwig Mayer, Augsburg 1935;
veröffentlicht in: Artikel "Jüdische Friedhöfe in Schwaben". In:
Jüdische Rundschau Nr. 97/1935 vom 3.12.1935 S. 6; das Foto ist einer Kopie der
Zeitung entnommen; ein Foto der Originalzeitung würde vermutlich eine bessere
Aufnahme ergeben!; Foto obere Zeile rechts veröffentlicht in: G. Römer, Schwäbische Juden
S. 269)
 |
 |
Blick vom Friedhof auf die
Synagoge 1935. Dr. Mayer schreibt dazu: "Interessant
der Stab mit der
Schlange über den mit hebräischen Inschriften versehenen
Gesetzestafeln
auf dem Dache der Synagoge". |
Innenansicht der
Synagoge
Buttenwiesen |
| |
| |
|

 |
 |
Zwei historische
Ansichten der Synagogen Buttenwiesen von der Westseite
(Quelle:
Fotosammlung United States Holocaust
Memorial Museum)
|
In der
Fotosammlung des United States Holocaust
Museums findet sich obige
Innenansicht der Synagoge Buttenwiesen |
| |
|
|
Historische
Ansichtskarten mit der
Synagoge (Ausschnittvergrößerungen)
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller,
Kirchheim/Ries; die Karte rechts findet
sich auch in der Sammlung der
Website www.judaica.cz ) |
 |
 |
| |
Ansichten
von Buttenwiesen |
Ausschnittvergrößerung:
Synagoge |
| |
|
|
(die
Mehrbildansichtskarte rechts
wurde am 25. Juli 1906 nach Lindau versandt) |
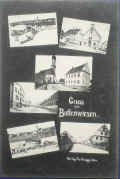 |
 |
| |
Ansichten von
Buttenwiesen |
Ausschnittvergrößerung:
Synagoge |
| |
|
|
Historische
Ansichtskarte -
Ansicht von Buttenwiesen
(aus der Sammlung von Peter Karl Müller,
Kirchheim/Ries) |
 |
 |
| |
Die
Karte wurde hier ergänzt, weil sie von dem jüdischen Einwohner Jakob
Sänger
unterschrieben ist (Ausschnitt rechts), der die Karte am 23. Juli
1905 von
Buttenwiesen nach Hamburg verschickte. Um welchen "Jacob
Sänger" es sich
handelte, ist nicht bekannt. |
| |
|
|
| |
|
|
Weiteres
Fotodokument
(Quelle: Sammlung G. Römer, Neusäß)
|
 |
Das Foto links
war zu sehen bei
der Sukkot-Ausstellung im
Jüdischen
Kulturmuseum in Augsburg
(Ausstellung vom 24.9.2008-14.12.2008;
www.jkmas.de) |
| |
Familie Lammfromm
vor der Laubhütte
ihres Hauses in Buttenwiesen,
Anfang 20. Jahrhundert |
|
Neuere Fotos:
(Fotos: Hahn; Aufnahmedatum 1.9.2004)
 |
 |
 |
Blick auf die
Westseite (Eingangsbereich) der ehemaligen Synagoge. Fenster und
Eingangsportal sind zugemauert, aber zu sehen. |
In der ehemaligen Synagoge
(Erdgeschoss)
erinnert ein Zimmer an die Verwendung des
Gebäudes als
Schule (bis 1994) |
| |
| |
|
 |
 |
 |
Ein weiterer Raum in der
ehemaligen
Synagoge (Erdgeschoss) wird als
Gottesdienstraum der
evangelischen
Kirchengemeinde verwendet. |
Hinweistafel am Gebäude |
Aufgang (Anfang der
1950er-Jahre)
zum 1. Stock auf die Höhe der
früheren Frauenempore
|
| |
| |
| |
|
|
| |
 |
|
| |
Neben der ehemaligen Synagoge:
Gebäude der ehemaligen Mikwe. |
|
| |
|
|
Im Rathaus
angebrachte Tafeln
(Quelle: Haus
der
Bayerischen Geschichte) |
 |
 |
| |
Gebotstafeln |
Gefallenengedenktafeln |
| |
|
|
Erinnerungsarbeit vor
Ort - einzelne Berichte
| September 2008:
Aktivitäten am "Europäischen Tag der jüdischen
Kultur" - Bericht über die Veranstaltungen im September 2008 |
Buttenwiesen erinnert an die jüdische Familie Bauer
-
Buttenwiesen/Binswangen (pm) - Auch in diesem Jahr veranstalten jüdische und nichtjüdische Organisationen am Sonntag, 7. September, gemeinsam den Europäischen Tag der jüdischen Kultur. In 30 europäischen Ländern - von Großbritannien bis Griechenland, von Spanien bis in die Ukraine - stehen an diesem Tag Kulturdenkmäler wie Synagogen, Friedhöfe, Schulhäuser, Ritualbäder, Museen und Gedenkstätten offen.
Wie seit mehreren Jahren beteiligt sich auch Buttenwiesen am Europäischen Tag der jüdischen Kultur. Der Zusamtalort verfügt über eine reichhaltige jüdische Geschichte. Von der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis zur Deportation der letzten Juden 1942 prägten jüdische Mitbürger wesentlich die Geschichte Buttenwiesens. Synagoge, jüdischer Friedhof, Ritualbad und die ehemaligen jüdischen Wohnviertel am Marktplatz und an der Donauwörther Straße zeugen bis zum heutigen Tag von der Bedeutung des ehemaligen Judendorfs Buttenwiesen.
Die diesjährige Veranstaltung steht ganz unter dem Zeichen der weitverzweigten jüdischen Familie Bauer. Mitglieder dieser Familie erwarben sich im 19. und 20. Jahrhundert als Vorstände der Israelitischen Kultusgemeinde große Verdienste um ihren Heimatort. Zum Beispiel Raphael Bauer: Nachdem Juden jahrhundertelang keine Häuser besitzen durften, durchbrach Raphael Bauer 1806 dieses Tabu und erwarb das ehemalige Vogteihaus (Wertinger Straße 7). Sein Sohn Tobias Bauer fungierte lange Zeit als Vorstand der Kultusgemeinde und zählte zu den Hauptverantwortlichen des Synagogenneubaus 1857.
Nach ihm ist auch der sogenannte "Tobiaswinkel" benannt, eine ehemalige Freifläche am Ortsrand, die zum Vogthaus gehörte. Tobias Bauer ließ darauf in enger Bebauung einige Häuser errichten, woraus sich die heutige Straßenbezeichnung Im Winkel entwickelte.
Diese und weitere interessante Geschichten über die wichtigsten Persönlichkeiten der Familie Bauer erzählt der Buttenwiesener Heimathistoriker Franz Xaver Neuner in einem Rundgang durch das jüdische Buttenwiesen. Die Führung beginnt am Sonntag, 7. September 2008, um 13.30 Uhr am Rathaus Buttenwiesen (Marktplatz 4). Der Eintritt ist frei.
Die Buttenwiesener Führung lässt sich gut mit dem Veranstaltungsprogramm in Binswangen kombinieren. Die dortige Synagoge kann von 11 bis 16 Uhr besichtigt werden. Diese zählt zu den schönsten jüdischen Kultbauten Deutschlands. Um 11 Uhr wird die Ausstellung "Erinnerung und Zukunft" mit Werken von J. Paul Menz eröffnet. Um 15.30 Uhr findet ein Rundgang über den jüdischen Friedhof Binswangen statt (Eingang: Am Judenberg, Wertingen). Den Höhepunkt bildet um 17 Uhr in der Synagoge das Konzert "Serenata Española" mit musikalischen Kostbarkeiten aus Spanien für Violoncello und Gitarre. |
| |
Sommer 2009:
Neuerscheinung zur jüdischen
Geschichte
- Vorstellung am "Europäischen Tag der jüdischen Kultur" am 6.
September 2009 |
 Dazu
ein Artikel aus der "Augsburger Allgemeinen" vom 1. September
2009: Dazu
ein Artikel aus der "Augsburger Allgemeinen" vom 1. September
2009:
"Neues über Buttenwiesens jüdische Kultur.
Buttenwiesen (pm) - Der Ort Buttenwiesen besitzt zahlreiche Zeugnisse der jüdischen Vergangenheit: Synagoge, Ritualbad, Friedhof, jüdische Wohnhäuser. Dank der neuen Broschüre
'Jüdisches Buttenwiesen. Einladung zu einem Rundgang', können Einheimische und Besucher das jüdische Erbe nun vor Ort
kennenlernen.
Idealer Begleiter für Rundgang. Das 40-seitige Heft im Taschenformat mit Ortsplan und zahlreichen Bildern stellt die wichtigsten Gebäude, Persönlichkeiten und Ereignisse der jüdischen Geschichte Buttenwiesens vor. Es ist der ideale Begleiter für einen Rundgang durch das jüdische Erbe des
Zusamtaldorfs.
Die Realisierung dieses Heftes ist eine Buttenwiesener Gemeinschaftsleistung: Spenden von Firmen und Einzelpersonen sowie ein Zuschuss der Gemeinde haben die Finanzierung ermöglicht. Die Mitglieder des Arbeitskreises
'Jüdische Geschichte' haben die Broschüre in zahllosen ehrenamtlichen Arbeitsstunden erstellt.
Die öffentlichen Präsentation der Broschüre findet im Rahmen des Europäischen Tags der Jüdischen Kultur am Sonntag, 6. September, um 13.30 Uhr auf dem Schulplatz Buttenwiesen (vor der ehemaligen Synagoge, Schulplatz 6) statt. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen (keine Voranmeldung erforderlich, Eintritt frei).
Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit, an einer Führung des Buttenwiesener Heimathistorikers Franz Xaver Neuner durch das jüdische Buttenwiesen teilzunehmen. Ein zweiter Rundgang startet um 14.30 Uhr auf dem Schulplatz.
Die Broschüre kann an diesem Tag vor Ort gekauft werden (Kaufpreis: drei Euro). Danach ist sie im Rathaus (Marktplatz 4) und im Schreibwarengeschäft Rothstift (Marktplatz 6) erhältlich."
Link zum Verlag: http://www.medien-und-dialog.de/
(mit Bestellmöglichkeit) |
| |
| Januar 2010:
In der ehemaligen Synagoge ist ein "Freier
Kindergarten" eingezogen |
 Artikel
von Rosmarie Gumpp in der "Augsburger Allgemeinen" vom 10.
Januar 2010 (Artikel): Artikel
von Rosmarie Gumpp in der "Augsburger Allgemeinen" vom 10.
Januar 2010 (Artikel):
"Ab heute ist der Bienenkorb geöffnet.
Buttenwiesen Strahlende Gesichter, überall gute Laune, kein Wunder: Nach gut einem Jahr Vorbereitungszeit konnte am vergangenen Samstag die Segnung des
'Freien Kindergartens Buttenwiesen' durch Pfarrer Markus Maiwald vollzogen werden. Mit der feierlichen und offiziellen Eröffnung durch den Vorstand der
'Waldorf-Initiative Buttenwiesen' und dem Bürgermeister der Gemeinde Buttenwiesen, Norbert Beutmüller, kann der Freie Kindergarten zum 11. Januar 2010 nun seinen Betrieb aufnehmen.
Anstrengendes Vorbereitungsjahr. Sandra Rohrlack-Gärtner, die 1. Vorsitzende der
'Waldorf-Initiative Buttenwiesen', freute sich über die zahlreichen Gäste, blickte in ihrer kurzen Ansprache auf ein anstrengendes Vorbereitungsjahr mit Höhen und Tiefen zurück und gab schließlich auch noch stolz den Namen des neuen Kindergartens preis:
'Bienenkorb' - Freier Kindergarten Buttenwiesen.
Auch Bürgermeister Norbert Beutmüller war über das erweiterte pädagogische Angebot seiner Gemeinde erfreut.
'Wir haben jetzt in der Großgemeinde zwei Kinderkrippen, einen kirchlichen Kindergarten, zwei gemeindeeigene Kindergärten und mit dem Bienenkorb ein weiteres sinnvolles pädagogisches Angebot, aus dem die Eltern aus freier Entscheidung heraus wählen können'. Pfarrer Markus Maiwald aus Meitingen segnete die neuen Räume in der ehemaligen Synagoge Buttenwiesen und hatte auch für jedes Kind den Segen Gottes mitgebracht. Mit seiner Gitarre lud er alle Anwesenden zum Singen und Mitmachen ein.
Geborgenheit und Ruhe. Dem Kindergarten kommt in der Waldorfpädagogik eine große Bedeutung zu. Mit Geborgenheit und Achtsamkeit, Ruhe und Rhythmus sollen die ersten Schritte des Kindes außerhalb der Familie begleitet werden. In der Waldorfpädagogik - frei nach Rudolf Steiner - wird ein ganz besonderes Augenmerk auf die frühkindliche Entwicklung gelegt, insbesondere auf die Bedeutung von Vorbild und Nachahmung, die Pflege der Sinne, die Bewegungs- und Sprachentwicklung und die Bildung der rhythmischen, musikalischen und künstlerischen Fähigkeiten und Anlagen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung sozialer Fähigkeiten, Orientierung in Raum und Zeit über Ordnung, Verlässlichkeit und Rhythmus. Auch eine frühe Grundlagenbildung der mathematischen und naturwissenschaftlichen Erkenntnisse aufgrund direkten Erlebens sind Bestandteil des Kindergartentages. Für die fünf Buben, die am Montag den
'Bienenkorb' belagern werden, stehen die Erzieherinnen Eva Bertold und Alexandra Kiederle bereit, wertvolle Unterstützung erfahren sie durch die Kinderpflegerinnen Sabine Schülein und Melitta Wiesenmeier. Ein besonderer Höhepunkt der Einweihungsfeierlichkeiten war der Auftritt der Erzählbühne Biberbach, die mit dem Stück
'Sterntaler' die kleinen und die großen Gäste erfreute. Für die Zuschauer sichtbar erzählte Evelyn Lebold hinter der Bühnenlandschaft und führte die Figuren mit der Hand. Auf verschiedensten Instrumenten wurde sie dabei von ihrem Mann Fritz Lebold-Nagel begleitet, der das Geschehen mit eigenen Kompositionen bereicherte. Durch die besondere Art des Stehpuppenspiels konnten die Zuschauer mühelos in die Bildwelt der Märchen eintauchen. Die klare Gestaltung der Bühne und der Figuren ließ viel Raum für die Fantasie. Auf diesem Wege viel Freude im neuen Kindergarten für Jeremia, Valentin, Johannes, Cem und
Atay.
Info Es sind noch Plätze im neuen Kindergarten frei: Bei Interesse wenden sich die Eltern an den Trägerverein unter
www.waldorf-buttenwiesen.de)" |
| |
| Juni 2010:
Buttenwiesen soll im Bereich der ehemals
jüdischen Gebäude am Schulplatz aufgewertet werden |
 Foto
links von Brigitte Bunk: Die ehemals jüdischen Gebäude am Schulplatz könnten im Rahmen einer Ortskernsanierung eine neue Nutzung bekommen. Im Mohleshaus (links) könnte ein Museum mit einer jüdischen Sammlung eingerichtet werden, in der Synagoge (Mitte) ein
'Haus der Religionen'. Ein Arbeitskreis beschäftigt sich derzeit mit dem Thema.. Foto
links von Brigitte Bunk: Die ehemals jüdischen Gebäude am Schulplatz könnten im Rahmen einer Ortskernsanierung eine neue Nutzung bekommen. Im Mohleshaus (links) könnte ein Museum mit einer jüdischen Sammlung eingerichtet werden, in der Synagoge (Mitte) ein
'Haus der Religionen'. Ein Arbeitskreis beschäftigt sich derzeit mit dem Thema..
Artikel von Hertha Stauch in der "Augsburger Allgemeinen" vom 4.
Juni 2010 (Artikel):
"Buttenwiesen soll aufgewertet werden.
Buttenwiesen. Mit der Aufwertung des Ortskerns von Buttenwiesen beschäftigt sich derzeit die
'Ideengruppe Ortskern Buttenwiesen', die in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates die vorläufigen Ergebnisse ihrer Arbeit vorstellte. Wie Bürgermeister Norbert Beutmüller eingangs erklärte, erfüllt Buttenwiesen seine Mittelpunktsfunktion bisher nur in beschränktem Umfang. Leer stehende Gebäude in der Ortsmitte, sanierungsbedürftige Bausubstanz, keine hochwertige und dauerhafte Nutzung städtebaulich prägnanter Gebäude und wenig gesellschaftliches Leben - diese Missstände sollen mit Hilfe des Städtebauförderprogramms der Regierung von Schwaben nach und nach beseitigt werden. Ein Förderprogramm steht dafür ab 2011 in Aussicht, wie Beutmüller erklärte. Ziel sei es, die Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sanierungsgebiet sowie die Verkehrsverhältnisse, die Versorgungsfunktion und die sozialen und kulturellen Aufgaben zu verbessern.
Deshalb wurde vor einem Jahr die Ideengruppe gegründet, die sich - politisch unabhängig - mit der Nutzung leer stehender Gebäude in der Ortsmitte befassten und ihre Ideen jetzt dem Gemeinderat präsentierten. Eine große Rolle spielen dabei die Gebäude der ehemaligen jüdischen Gemeinde in Buttenwiesen, die in ihrer Grundstruktur noch erhalten sind und als Ensemble ein
'Alleinstellungsmerkmal' sind, wie es Dr. Johannes Mordstein als Mitglied der Ideengruppe formulierte. Mordstein schlug vor, die
frühere Synagoge am Schulplatz 6 als ein 'Haus der Religionen' zu nutzen, mit der Darstellung der Geschichte der Weltreligionen.
Im ehemaligen Ritualbad der Juden, einem Häuschen am Schulplatz 8, will Mordstein ein erlebnispädagogisches Konzept verwirklicht wissen:
'Wir könnten dort zeigen, wie die Juden dort ihre rituellen Waschungen vollzogen
haben.' Im sogenannten Mohleshaus, Schulplatz 10, in dem früher eine Metzgerei untergebracht war, soll nach Vorstellung Mordsteins ein Museum zur Geschichte Buttenwiesens entstehen, ein jüdisches Museum und Dokumentationszentrum jüdischer Geschichte mit der heimatkundlichen Sammlung Neuner.
Johanna Wech wollte als weiteres Mitglied der Ideengruppe die Synagoge anders nutzen und deren ursprünglichen Hallenbau wieder rekonstruieren und so der ehemals jüdischen Gemeinde ein Denkmal setzen. Der Bau könnte genutzt werden als Konzertsaal oder für andere Veranstaltungen. Deshalb müssten sanitäre Anlagen und eine Küche eingebaut werden. Michael Hahn wollte den Buttenwiesener Bürgersaal aufwerten und dort mehr Platz für Veranstaltungen - Sitzungen, Vereinsaktivitäten, Ausstellungen - schaffen. Hans Kaltner dachte an ein Gesundheitszentrum im Ort mit Sanitätshaus, Physiotherapie und Betreutem Wohnen in Nähe der Arztpraxis im Weberhaus, in dem 20 Wohneinheiten geschaffen werden könnten. Betreiber könnte ein privater Investor sein, meinte Kaltner. Maria Hagl hielt
'ein Café im Ortskern für dringend notwendig als Begegnungsstätte'. Hier könnten auch Patienten der Arztpraxis oder des Gesundheitszentrums ihre Wartezeit verbringen, war ihre Idee.
Städteplaner beauftragt. Bürgermeister Beutmüller freute sich über die Vorschläge der Ideengruppe, die es Wert seien, sie zu konkretisieren. Vor einer Umsetzung seien jedoch noch viele weitere Schritte notwendig, wie die Beauftragung eines professionellen Städteplaners, Prüfung der Finanzierungsmöglichkeiten und vieles mehr. Voraussetzung für eine förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes seien vorbereitende Untersuchungen, wie sie das Baugesetz vorschreibt.
Einstimmig beschloss der Gemeinderat dann den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen zur Sanierung des Ortskerns. Die Auftragsvergabe an ein Städteplanungsbüro erfolgte im nicht öffentlichen Teil der Sitzung." |
| |
| September 2010:
Erinnerung an den Heimatchronisten Israel Lammfromm |
Pressemitteilung der Gemeinde Buttenwiesen
vom 2. September 2010 (Artikel):
"Buttenwiesen würdigt Heimatchronisten Israel Lammfromm. Vortrag und Führung am Sonntag, 5. September 2010.
Die Gemeinde Buttenwiesen würdigt am Europäischen Tag der jüdischen Kultur (Sonntag, 5. September 2010) den Heimatchronisten Israel Lammfromm (1863-1930). Auch 80 Jahre nach seinem Tod haben die ehrenvollen Worte im Nachruf der Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung nicht ihre Gültigkeit eingebüßt: "Der Verstorbene hat sich in hingebungsvoller Treue dem Dienst für die Gemeinde gewidmet und sich dadurch unauslöschlichen Dank erworben."
(vgl. Quelle)
Israel Lammfromm war in vielfacher Weise für Buttenwiesen engagiert, u.a. als langjähriges Mitglied in der Vorstandschaft der Israelitischen Kultusgemeinde, als Zeugwart der Freiwilligen Feuerwehr und als Festredner und Organisator mehrerer Feste. Sein Hauptverdienst stellt die 1911 im Eigenverlag erschienene "Chronik der Markt-Gemeinde Buttenwiesen" dar – bis heute das Standardwerk zur Geschichte Buttenwiesens. In 32 Kapiteln beschreibt Lammfromm zuverlässig, akribisch und informativ die Geschichte des Zusamtaldorfs von der ersten urkundlichen Erwähnung im Mittelalter bis zum Erscheinungsjahr 1911.
Gemeindearchivar Dr. Johannes Mordstein beleuchtet in einem Vortrag die Biographie Lammfromms sowie dessen Verdienste um das Gemeinwohl. Im Anschluss daran führt Heimathistoriker Franz X. Neuner durch das jüdische Buttenwiesen, wobei er besonders auf die Wohnhäuser und Grabstätten der Familie Lammfromm eingehen wird.
Der Vortrag beginnt am Sonntag, 5. September 2010, um 10 Uhr im Rathaus Buttenwiesen (Marktplatz 4). Der anschließende Rundgang endet spätestens um 12 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen: Tel. 08274/9999-13." |
| |
Pressemitteilung der Gemeinde Buttenwiesen
vom 6. September 2010 (Artikel):
"Buttenwiesen: Gläubiger Jude und für das Gemeinwohl engagierter Buttenwiesener.
Heimatchronist Israel Lammfromm personifiziert Integration
Anlässlich des 80. Todestags ehrte die Gemeinde Buttenwiesen am Europäischen Tag der jüdischen Kultur den Heimatchronisten Israel Lammfromm (1863-1930), der sich große Verdienste um seinen Heimatort erworben hat.
Bürgermeister Norbert Beutmüller zeigte sich bei der Begrüßung im vollbesetzten Sitzungssaal des Rathauses erfreut über den regen Zuspruch. Nach seinen Worten ist die Gemeinde Buttenwiesen bestrebt, der Verantwortung aus dem reichhaltigen jüdischen Erbe gerecht zu werden.
Gemeindearchivar Dr. Johannes Mordstein beleuchtete in einem Vortrag die Biographie Israel Lammfromms, der aus einer alteingesessenen Buttenwiesener jüdischen Familie stammte. In seinem Wohnhaus (heute Marktplatz 7) betrieb er eine Geschäft für Haushaltswaren und landwirtschaftliche Geräte sowie eine Eisenhandlung.
Lammfromm engagierte sich außerordentlich für das Gemeinwohl: Fast 30 Jahre fungierte er als Vorstandschaftsmitglied der israelitischen Kultusgemeinde, davon viele Jahre als deren Sekretär. Über fünf Jahrzehnte war er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Buttenwiesen, bei der er auch die verantwortungsvollen Positionen des Zeugwarts und des Zugführers ausübte. Auch als Festredner und Organisator von Jubiläumsveranstaltungen war er aus dem gesellschaftlichen Leben seiner Zeit nicht wegzudenken.
Sein Engagement für die Kultusgemeinde und die Gesamtgemeinde zeigt, so Mordstein, den harmonischen Zweiklang in Lammfromms Leben: Er war gläubiger Jude und überzeugter Buttenwiesener, der seine Heimat liebte. Er personifiziert somit die Integration der Juden in die Gesamtgesellschaft des zu Ende gehenden 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts.
Lammfromms Hauptverdienst ist die 1911 erschienene "Chronik der Markt-Gemeinde Buttenwiesen", die bis heute das Standardwerk zur Geschichte Buttenwiesens darstellt. "Auch heute noch ist die Chronik wegen ihrer Informationsfülle und ihrer Zuverlässigkeit lesenswert. Über viele Aspekte der Buttenwiesener Geschichte wissen wir nur Bescheid, weil Lammfromm darüber berichtet", betonte Mordstein in seinem Vortrag. Da Lammfromms Arbeit seit vielen Jahren vergriffen ist, plant die Gemeinde Buttenwiesen für das kommende Jahr eine Neuauflage der "Chronik". Unverbindliche Vorbestellungen unter Tel. 08274/9999-13.
In seiner "Chronik" legte Lammfromm besonders großen Wert auf das einträgliche Zusammenleben von Christen und Juden zum Gesamtwohl des gesamten Dorfs. Moderne Entwicklungen wie Lokalbahn, Straßenbeleuchtung, Wasserleitungen, Telefon und Telegraphenstation konnten nur realisiert werden, weil beide Glaubensgruppen "gemeinsam in Eintracht zum Wohle der Gesamtgemeinde" zusammenarbeiteten. Voller Stolz fügt Lammfromm an: "An der modernen Entwicklung von Buttenwiesen nahmen die Israeliten ganz hervorragenden Anteil".
Im anschließenden Rundgang führte Heimathistoriker Franz X. Neuner die Besucher durch das jüdische Buttenwiesen. Besondere Beachtung schenkte er den Wohnhäusern der Familie Lammfromm sowie den Grabsteinen der Familie auf dem jüdischen Friedhof." |
| |
| Oktober 2010:
Erinnerung an die Schule in der ehemaligen Synagoge |
Pressemitteilung der Gemeinde Buttenwiesen
vom 28. Oktober 2010 (Artikel):
"Buttenwiesen: Die alte Schule besucht.
Klassentreffen der Jahrgänge 1945 bis 1947 in Buttenwiesen.
Sie gehörten zu den ersten Jahrgängen, die die 1952 neu eröffnete Volksschule Buttenwiesen besuchten. Nach fast 60 Jahren kehrten die Jahrgänge 1945 bis 1947 nun im Rahmen eines Klassentreffens in ihre alte Schule zurück.
Das Jahrgangstreffen begann zunächst im Buttenwiesener Rathaus. Bürgermeister Norbert Beutmüller begrüßte seine zum Teil aus großer Entfernung angereisten Gäste und stellte ihnen die aktuellen Entwicklungen in Buttenwiesen und seinen Ortsteilen vor. Auf besonderes Interesse stieß das heutige Rathaus, das den Besuchern noch als Gastwirtschaft in Erinnerung war.
Gemeindearchivar Dr. Johannes Mordstein führte die ehemaligen Klassenkameraden durch ihre frühere Schule am Schulplatz. Er berichtete von den
drei Leben des Gebäudes, das 1856/57 als Synagoge der israelitischen Kultusgemeinde errichtet worden war. Von 1952 bis 1994 diente es als Volksschule, heute ist dort der Freie Kindergarten Buttenwiesen untergebracht. Die evangelische Kirchengemeinde feiert Gottesdienste in einem der ehemaligen Schulsäle.
Besondere Freude rief das Wiedersehen mit einem alten Bekannten hervor: Vor der Schule war bis 1988 ein achteckiger und
ein Meter hoher Stein aufgestellt, der in den Pausen gerne zum Bockspringen genutzt wurde. Nachdem er einige Jahre verschollen gewesen war, befindet er sich heute wieder im Besitz der Gemeinde Buttenwiesen. Neu war für die Zuhörer die Vorgeschichte des Steins:
Auf ihm war Siebenarmige Leuchte der Synagoge montiert." |
| |
| April 2012:
Gedenken zum 70. Jahrestag der Deportation |
Pressemitteilung der Gemeinde Buttenwiesen
vom 10. April 2012: "Buttenwiesen: 70. Jahrestag der Deportation.
Binswangen und Buttenwiesen gedenken der Opfer.
Die Namensliste der Opfer wollte kein Ende nehmen. Mehrere Minuten dauerte es, bis Johann Urban und Michael Hahn die Namen der 48 jüdischen Mitbürger aus Binswangen und Buttenwiesen verlesen hatten, die vor 70 Jahren zwangsdeportiert wurden. In einer bewegenden und eindrucksvollen Gedenkstunde erinnerten der Förderkreis Synagoge Binswangen und die Gemeinde Buttenwiesen an das Leid der Opfer. Windlichter, die im Halbrund auf dem Buttenwiesener Schulplatz vor der ehemaligen Synagoge aufgestellt waren, symbolisierten die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
In seiner Rede blickte Bürgermeister Norbert Beutmüller auf die Ereignisse vor 70 Jahren zurück. Am 1. April 1942 –
'einer der schlimmsten Tage in der Geschichte unserer Dörfer', so Beutmüller – wurden 41 Binswanger und Buttenwiesener Juden unter Zwang zum Bahnhof geführt und von dort in das Zwangsghetto Piaski in Polen (bei Lublin) verschleppt. In Piaski herrschten katastrophale Zustände. Ernährung, Unterbringung und hygienische Verhältnisse waren völlig unzureichend. Viele der Zwangsdeportierten starben in dieser
'Hölle', wie es einer der Überlebenden nannte. Die verschleppten Juden aus Binswangen und Buttenwiesen lebten nur wenige Monate in Piaski. Dann wurden sie in den Gaskammern der benachbarten Vernichtungslager ermordet.
Im Laufe des Jahres 1942 wurden die sieben verbliebenen jüdischen Mitbürgern aus den beiden schwäbischen Dörfern in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Von diesen überlebte nur Thekla Lammfromm aus Buttenwiesen den Holocaust.
Mit einem klaren Bekenntnis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus beendete Beutmüller seine Rede:
'Die rechtsextremen Verächter unserer Demokratie (so Bundespräsident Joachim Gauck) werden in Binswangen und Buttenwiesen nicht das Sagen haben. Unsere bürgerliche Solidargemeinschaft stärkt das Miteinander aller Bürgerinnen und Bürger, egal welcher Hautfarbe, welcher Religion und aus welchem Herkunftsland.' Er bedankte sich bei allen Teilnehmern – der Schulplatz war mit ca. 200 Besuchern gut gefüllt – für ihr Kommen und für ihr Zeichen gegen Rechtsextremismus.
In Vertretung von Landrat Leo Schrell berichtete der Dillinger Altoberbürgermeister Hans-Jürgen Weigl von einer Israel-Reise vor 15 Jahren. Der Besuch der Holocaust-Gedenkstätte mit dem
'Tal der untergegangenen Gemeinden' habe ihn damals erschüttert: 'Und
plötzlich stand ich vor einer Steinwand mit den Namen der schwäbischen
Gemeinden und mit dem Namen Buttenwiesen.' Weigl bedankte sich bei den Gemeinden Binswangen und Buttenwiesen und beim Förderkreis Synagoge Binswangen für ihr Engagement, das Gedächtnis an die jüdische Geschichte wach zu halten.
'Denn nur, wer die Namen nicht nur kennt, sondern sie auch benennt, entreißt die Opfer auch nach 70 Jahren noch der Vergessenheit,' so Weigl.
Als Vertreter der Israelitischen Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg sprach Marjan Abramovitsch anschließend das hebräische Kaddisch-Gebet, das traditionelle jüdische Totengebet. In einem eindrucksvollen Zug begaben sich die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung danach zum ehemaligen Bahnhof Buttenwiesen, wo die Juden den Deportationszug besteigen mussten. Die Windlichter wurden dabei von Vertretern des öffentlichen Lebens getragen.
Auf dem Bahnhofsplatz sprachen Gerlinde Schindler-Schneller als Vertreterin der Evangelischen Kirchengemeinde Wertingen, Pfarrer Rupert Ostermayer (Katholische Pfarreiengemeinschaft Wertingen) und Pater Thomas Schilling (Katholische Pfarreiengemeinschaft Unterthürheim) Gebete zur Erinnerung an die Opfer. Mit Dank- und Schlussworten von Anton Kapfer, dem Vorsitzenden des Förderkreises Synagoge Binswangen, klang die beeindruckende Gedenkstunde aus, die vom Männerensemble Binswangen-Höchstädt und von der Musikkapelle Hans Fischer – Zusamtaler Musikanten Buttenwiesen musikalisch umrahmt wurde."
Übernommen aus Pressemeldung-Bayern.de |
| |
|
September 2016:
Europäischer Tag der jüdischen
Kultur - Programm in Binswangen und
Buttenwiesen |
Artikel von Siegfried P.
Rupprecht in der "Stadtzeitung.de" vom 4. August 2016: "Angesehen,
entrechtet, ermordet.
Den 'Europäischen Tag der jüdischen Kultur' nutzen die Gemeinden Binswangen
und Buttenwiesen, um auf ihre langjährige Vergangenheit jüdischer Mitbürger,
aber auch auf die zahlreichen Einrichtungen der damaligen jüdischen
Gemeinschaft aufmerksam zu machen. Heuer findet die Erinnerung dazu am
Sonntag, 4. September, statt.
Der Förderkreis Synagoge Binswangen
hat dazu ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt. Von 14 bis 16.30
Uhr steht der jüdische Friedhof am
Judenberg in Wertingen zur Besichtigung offen. Im gleichen Zeitraum ist
auch die Synagoge in Binswangen geöffnet. Um 15 Uhr kommt dort der Film 'Die
Schul‘ bewahren …' zur Aufführung. Der Streifen ist eine Dokumentation über
die Geschichte der Juden in Binswangen und Schwaben sowie über die örtliche
Synagoge. Um 17 Uhr steht eine literarische Stunde mit Texten jüdischer
Schriftsteller an. Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt...
Plünderndes Rollkommando. Die Gemeinde Buttenwiesen lädt am
'Europäischen Tag der jüdischen Kultur' von 14 bis 15.30 Uhr zu einem
Rundgang durch die jüdische Kommune vor Ort ein. Er wird von
Gemeindearchivar Dr. Johannes Mordstein durchgeführt. 'Wie kaum ein anderer
Ort wird Buttenwiesen bis zum heutigen Tag von der jüdischen Geschichte
geprägt', betont er. Davon legen Synagoge, Friedhof, Ritualbad, jüdisches
Wohnviertel und Schule Zeugnis ab. Die Teilnahme am Rundgang ist kostenlos.
Treffpunkt ist beim Rathaus am Marktplatz 4..."
Link zum Artikel |
| |
| September 2016:
neues Nutzungskonzept für die ehemalige Synagoge
und das jüdische Badhaus |
Artikel von Hertha Stauch in der
"Augsburger Allgemeinen" vom 3. September 2016: "Zukunftsprojekt im Unteren Zusamtal.
Die jüdische Kultur bekommt wieder ein Gesicht in Buttenwiesen
Die Gemeinde möbelt ihre Plätze neu auf. Eine neue Nutzung für die Synagoge und das jüdische Badhaus gehören zum Gesamtkonzept. Das muss noch diskutiert werden
'Die nächsten zehn bis 15 Jahre wird sich Buttenwiesen deutlich verändern.' Derzeit amtierender Bürgermeister Christian Knapp ist sich sicher, dass auch das jüdische Buttenwiesen darin eingeschlossen ist. Der neue Bürgermeister – Hans Kaltner wird im Oktober als Nachfolger von Norbert Beutmüller sein Amt antreten –
'hat die Synagoge im Focus', weiß Knapp. Derzeit befindet sich die Ortsmitte im Umbruch. Unter Regie von Norbert Beutmüller wurde die Umgestaltung der Plätze geplant, neue Pläne für den Marktplatz und den Schulplatz geschmiedet und diese im Städtebauförderprogramm aufgenommen.
Rund um diese Plätze hatte sich bis vor dem Zweiten Weltkrieg das jüdische Leben in Buttenwiesen abgespielt, die alte Synagoge und das jüdische Badhaus dahinter zeugen heute noch davon. Diese beiden Bauwerke rücken nun beim
'Tag der jüdischen Kultur' am morgigen Sonntag wieder ins Bewusstsein. Die Synagoge wurde in der Nachkriegszeit zur Schule umgebaut und als solche bis 1994 genutzt. In jüngster Zeit hatte dort der freie Kindergarten
'Bienenkorb' seine Bleibe, derzeit dient das Haus der evangelischen Kirchengemeinde für Versammlungen und Gottesdienste. Zudem unterhält der Heimatverein dort ein Depot für seine Ausstellungsstücke.
'Die neuen Pläne erfordern nun eine politische Entscheidung', erklärt Dr. Johannes Mordstein, Gemeindearchivar und Experte für die jüdische Geschichte in Buttenwiesen. Das Sanierungskonzept für die Plätze und jüdisch-historischen Gebäude müsse im Gemeinderat und mit dem neuen Bürgermeister diskutiert werden, die künftige Nutzung der Synagoge sei darin beinhaltet..."
Link
zum Artikel |
| |
Dezember 2016:
Das jüdische Badhaus (Mikwe) wird 2017 saniert
Anmerkung: das Badhaus wurde in den vergangenen Jahren durch
Denkmalpfleger untersucht, das Tauchbad wurde ausgegraben. Nun soll das
Gebäude 2017 saniert und für museale Zwecke hergerichtet werden. Das
Gebäude ist im Besitz der Gemeinde Buttenwiesen. Es wurde 1860 erbaut und
gilt als herausragendes Kulturdenkmal von überregionaler Bedeutung, da
vor allem Tauchbecken und Wassersammelbecken im Originalzustand erhalten
sind. Im Wassersammelbecken wurde Regenwasser gesammelt und in das Becken
geleitet. Für eine höhere Wassertemperatur wurde Wasser in einem Ofen
erhitzt und mit dem gesammelten - koscheren - Regenwasser gemischt. Bei
den Untersuchungen wurden auch Wandbemalungen gefunden. Originale
Zimmertüren aus der Mitte des 19. Jahrhunderts sind erhalten. Die Höhe
der Sanierungskosten wird auf 245.000 Euro geschätzt, dazu 20.000 Euro
für die museale Einrichtung. In Buttenwiesen ist die unmittelbare Nähe
zwischen Synagoge, Mikwe und dem Friedhof ein einmaliges
Ensemble. |
siehe Artikel von Hertha Stauch in der
"Augsburger Allgemeinen" vom 14. Dezember 2016: "Das jüdische Badhaus wird noch im nächsten Jahr saniert
Einzigartiges Zeugnis der Vergangenheit soll musealen Zwecken dienen..."
Link
zum Artikel |
| |
|
Mai 2019:
Der Schulplatz wird zum
"Louis-Lamm-Platz" |
Artikel von Hertha Stauch in der "Augsburger
Allgemeinen" vom 6. Mai 2019: "Buttenwiesen. Der Schulplatz wird zum
Louis-Lamm-Platz
Die Gemeinde Buttenwiesen rückt mit der Umbenennung einen bedeutenden
jüdischen Bürger in den Mittelpunkt. Das ist Teil eines größeren Projekts.
Die Gemeinde Buttenwiesen setzt ein Zeichen und wertet die jüdische
Vergangenheit des Ortes weiter auf. Nachdem die ehemalige Mikwe, das in
Süddeutschland einmalig erhaltene jüdische Badhaus, nun saniert und zu einem
kleinen Dokumentationszentrum ausgebaut wurde – die Eröffnung ist im
September vorgesehen – wird der Schulplatz vor der Synagoge umbenannt und
einem bedeutenden jüdischen Bürger gewidmet. Es ist Louis Lamm, über dessen
Leben und Wirken Gemeindearchivar Dr. Johannes Mordstein in der jüngsten
Sitzung des Gemeinderats Auskunft gab.
Ein bedeutender jüdischer Mitbürger Buttenwiesens. Louis Lamm lebte
von 1872 bis 1943 und zählt zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der
Buttenwiesener Geschichte. Als Sohn des Buttenwiesener Synagogendieners Max
Lamm verbrachte er seine Kindheits- und Jugendjahre in der Gemeinde. In
Berlin gründete er 1903 einen Verlag mit Buchhandlung und Antiquariat, der
sich zu einem der führenden Verlage für jüdische Literatur in Deutschland
entwickelte. Louis Lamm hat sich laut Dr. Mordstein auch große Verdienste um
die Heimatgeschichte erworben. In zahlreichen Publikationen erforschte er
die Geschichte Schwabens. 'Auch über die Buttenwiesener Geschichte schrieb
er einige Abhandlungen, die bis heute grundlegende Bedeutung haben',
informierte Mordstein. Während der NS-Zeit emigrierte Lamm nach Amsterdam,
wo er weiter als Verleger tätig war. 1943 wurde er von den
Nationalsozialisten deportiert und in einem Vernichtungslager im Osten
ermordet. In Buttenwiesen sei bislang keine Straße nach Lamm benannt.
Angesichts seiner historischen Bedeutung, seiner Wurzeln in Buttenwiesen,
seiner Verdienste und seines Lebensschicksals zähle er zu den
Persönlichkeiten, die für eine Ehrung durch eine Straßenbenennung in Frage
kommen, erklärte Mordstein vor dem Gemeinderat. Zentraler Punkt des
jüdischen Geschehens in Buttenwiesen war einstmals die Synagoge. Nach dem
Zweiten Weltkrieg und der Vertreibung der jüdischen Bevölkerung wurde sie
als Schule genutzt, der Platz davor als 'Schulplatz' benannt. Da die Schule
seit 1994 nicht mehr in der Synagoge untergebracht ist, gebe es keinen Bezug
mehr auf die vorhandenen Gegebenheiten, meinte Mordstein. Er schlug deshalb
vor, den Schulplatz umzubenennen in Louis-Lamm-Platz. Die Gemeinderäte
schlossen sich dem Vorschlag Mordsteins einstimmig an.
Louis Lamm verbrachte in Buttenwiesen seine Kindheit. Die ehemalige
Synagoge wird derzeit nicht genutzt. Nur die evangelische Gemeinde hat hier
einen Raum, und es lagern heimatkundliche Gegenstände im Haus. Die Gemeinde
plant, im Rahmen der städtebaulichen Veränderungen in Buttenwiesen auch die
Synagoge zu sanieren und einer neuen Nutzung zuzuführen. Genaue
Vorstellungen gibt es hierzu noch nicht, ein Bürgerzentrum mit einem
Kulturraum ist in Verbindung mit einem neben der Synagoge liegenden Gebäude
angedacht. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Synagoge befinden sich die
Mikwe und der jüdische Friedhof. Durch diese einmalige Konstellation kommt
der Gemeinde Buttenwiesen eine besondere Bedeutung unter den ehemaligen
jüdischen Gemeinden in Bayern zu. Die Gemeinde ist sich dessen bewusst und
pflegt eine Erinnerungsarbeit, 'die als vorbildlich betrachtet wird', wie
Dr. Mordstein erklärte."
Link zum Artikel |
| |
|
Juli 2019:
Das jüdische Badhaus (Mikwe) ist
fast fertig saniert |
Artikel von Brigitte Bunk in der "Augsburger
Allgemeinen" vom 31. Juli 2019: "Buttenwiesen. Aus dem Buttenwiesener
Ritualbad wird ein Kleinod
Das einstige jüdische Badhaus in Buttenwiesens Zentrum war in einem sehr
schlechten Zustand. Anfang September wird die Mikwe eröffnet und den
Besuchern zugänglich sein.
Die Mikwe, zwischen der Synagoge und dem jüdischen Friedhof in Buttenwiesen
gelegen, wurde restauriert. Wo die meisten noch ein heruntergekommenes
Anwesen im Gedächtnis haben, ist nun ein schmuckes Häuschen mit gepflegtem
Vorgarten zu sehen. Bürgermeister Hans Kaltner gab in der Ratssitzung am
Montag freudig bekannt, dass die Restaurierung fast abgeschlossen ist. Am 1.
September soll sie, anlässlich des Tags der jüdischen Kultur, um 11 Uhr mit
einem kleinen Festakt eröffnet werden.
'Das wird ein Kleinod', verspricht Kaltner. Vor allem sei in Deutschland das
Ensemble Synagoge, Mikwe und jüdischer Friedhof etwas Einmaliges. Auf dem
Schild, das momentan noch neben der Eingangstür lehnt, ist die Geschichte zu
lesen: 'Das ehemalige Ritualbad der jüdischen Gemeinde Buttenwiesen diente
nicht der Hygiene, sondern der rituellen Reinigung, der sich die gläubigen
Juden bei gewissen Anlässen zu unterziehen hatten. (…) Das Gebäude wurde
kurz nach der Synagoge 1857 errichtet, es gehört zu den wenigen in
Deutschland heute noch erhaltenen und eigens zu diesem Zweck gebauten
Ritualbädern. In den 1940er Jahren erfolgte ein Umbau zum Wohnhaus. Derzeit
steht es leer. Die Gemeinde Buttenwiesen plant die Einrichtung eines
Museums.'
Was von außen ganz unscheinbar wirkt, zeigt im Innern jüdische Geschichte
auf. In dem Badhaus befindet sich ein Tauchbecken, welches ein Zimmer
einnimmt und noch komplett erhalten ist. Hier führten die Buttenwiesener
Juden früher ihre Waschungen durch – nur im Zustand ritueller Reinheit
dürfen gläubige Juden an vielen religiösen Bräuchen teilhaben. Frauen
mussten diese in dem Bad etwa während der Menstruation wieder herstellen.
Archivar Dr. Johannes Mordstein vermutet, dass die Mikwe schon einige Zeit
vor der Machtergreifung der Nazis nicht mehr genutzt wurde. Viele Juden
hätten sich solche rituellen Becken zuhause eingerichtet – vielen behagte es
wohl nicht, diese Bräuche in der Öffentlichkeit auszuführen. Das Gebäude
befand sich in einem sehr schlechten Zustand. Es gab praktisch keinen
Bereich, der nicht überarbeitet werden musste. Umso mehr freut es
Bürgermeister Kaltner, dass die Renovierung nun dem Ende entgegen geht. 'Wir
sind sehr, sehr weit.'"
Link zum Artikel |
| |
|
November 2019:
Der "Louis-Lamm-Platz" wird
offiziell so benannt (vgl. oben Artikel vom April 2019)
|
Artikel von Birgit Alexandra
Hassan in der "Augsburger Allgemeinen" vom 11. November 2019: "Buttenwiesen
setzt Zeichen gegen Antisemitismus
Indem die Gemeinde dem Platz vor der ehemaligen Synagoge einen neuen Namen
verleiht, erinnert sie an einen ihrer berühmtesten Bürger, Louis Lamm. Die
87-jährige Charlotte Knobloch kam dafür extra aus München angereist.
Ein blaues Tuch verhüllt die Standtafel vor der ehemaligen Synagoge im
Ortskern von Buttenwiesen. Gemeinsam ziehen am Sonntagabend Bürgermeister
Hans Kaltner und Charlotte Knobloch das Tuch weg und machen damit die
Umbenennung des ehemaligen Schulplatzes in Louis-Lamm-Platz offiziell. Die
ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland und
amtierende Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und
Oberbayern war dafür extra angereist..."
Link zum Artikel (gebührenpflichtig) |
| |
Beiträge aus dem "Rathausbrief
- Informations- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Buttenwiesen" (zum
Lesen bitte Textabbildungen anklicken; Quelle
www.buttenwiesen.de)
links aus Nr. 349 November 2019 S. 7: "Charlotte Knobloch und Dr. Ludwig
Spaenle zu besuch in Buttenwiesen - Erinnerung an Reichspogromnacht und
Holocaust"
Mitte aus Nr. 350 Dezember 2019 S. 1: aus dem Vorwort des 1.
Bürgermeisters Hans Kaltner
rechts aus Nr. 350 Dezember 2019 S. 14: "Umbenennung des Schulplatzes
Buttenwiesen in Louis Lamm Platz". |
 |
 |
 |
| |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Gernot Römer: Der Leidensweg der Juden in
Schwaben. Schicksale von 1933-1945 in Berichten, Dokumenten und Zahlen. Augsburg
1983. |
 | ders.: Schwäbische Juden. Leben und Leistungen aus zwei Jahrhunderten,
Augsburg 1990. |
 | Baruch Zvi Ophir: Pinkas Hakellit. Encyclopedia of
Jewish Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
vol. Bavaria. Hg. von Yad Vashem Jerusalem 1972 (hebräisch) S. 608-610. |
 | Baruch Z. Ophir und Falk Wiesemann: Die
jüdischen Gemeinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung. 1979
S. 463-464. |
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in
Bayern. Eine Dokumentation der Bayerischen Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit. A 85. München 1988 S. 238-239. |
 | Michael Trüger: Der jüdische Friedhof in
Fellheim / Schwaben. In: Der Landesverband der Israelitischen
Kultusgemeinden in Bayern. 11. Jahrgang Nr. 74 vom Oktober 1997 S. 24. |
 | Sabine Ullmann: Nachbarschaft und Konkurrenz: Juden
und Christen in Dörfern der Markgrafschaft Burgau 1650 bis 1750.
Vandenhoeck und Ruprecht Göttingen. 563 Seiten. 1999. 64.50 €. ISBN
10-3525354665. |
 | 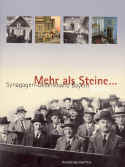 "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band I:
Oberfranken - Oberpfalz - Niederbayern - Oberbayern - Schwaben.
Erarbeitet von Barbara Eberhardt und Angela Hager. Hg.
von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.
Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und
herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu. (mit umfassenden Quellen- und
Literaturangaben) "Mehr als
Steine...." Synagogen-Gedenkband Bayern. Band I:
Oberfranken - Oberpfalz - Niederbayern - Oberbayern - Schwaben.
Erarbeitet von Barbara Eberhardt und Angela Hager. Hg.
von Wolfgang Kraus, Berndt Hamm und Meier Schwarz.
Reihe: Gedenkbuch der Synagogen in Deutschen. Begründet und
herausgegeben von Meier Schwarz. Synagogue Memorial Jerusalem. Bd. 3:
Bayern. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg im
Allgäu. (mit umfassenden Quellen- und
Literaturangaben)
ISBN 978-3-98870-411-3.
Abschnitt zu Buttenwiesen S. 423-430.
|
 |  "Ma
Tovu...". "Wie schön sind deine Zelte, Jakob..." Synagogen
in Schwaben. Mit Beiträgen von Henry G. Brandt, Rolf Kießling,
Ulrich Knufinke und Otto Lohr. Hrsg. von Benigna Schönhagen.
JKM Jüdisches Kulturmuseum Augsburg-Schwaben. 2014. "Ma
Tovu...". "Wie schön sind deine Zelte, Jakob..." Synagogen
in Schwaben. Mit Beiträgen von Henry G. Brandt, Rolf Kießling,
Ulrich Knufinke und Otto Lohr. Hrsg. von Benigna Schönhagen.
JKM Jüdisches Kulturmuseum Augsburg-Schwaben. 2014.
Der Katalog erschien zur Wanderausstellung "Ma Tovu...".
"Wie schön sind deine Zelte, Jakob..." Synagogen in Schwaben des
Jüdischen Kultusmuseums Augsburg-Schwaben und des Netzwerks Historische
Synagogenorte in Bayerisch-Schwaben.
|
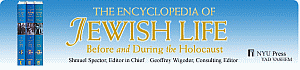
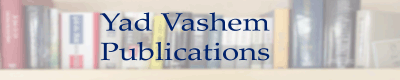
Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Buttenwiesen. Swabia. An organized
community existed in the first half of the 17th century. A cemetery was
consecrated in 1633 and additional Jews, expelled from the principality of
Pfalz-Neuburg, arrived in the 1740s. A Jewish public school enrolled 116
children in 1846, and in 1857 a new synagogue was opened. The Jewish population
stood at 344 in 1867 (total 806), afterwards declining steadily to 73 in 1933.
On Kristallnacht (9-10 November 1938), the synagogue and cemetery were
damaged along with Jewish homes and stores. Twenty-seven Jews left Buttenwiesen
in 1934-41, 13 of them emigrating. The last 37 were deported to Piaski (Poland)
via Munich on 3 April 1942.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|