|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht der Synagogen
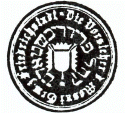 links:
Siegel der jüdischen Gemeinde Friedrichstadt links:
Siegel der jüdischen Gemeinde Friedrichstadt
Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland,
Schleswig-Holstein)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Es besteht eine weitere Seite
mit Texten zur jüdischen Geschichte in
Friedrichstadt
(interner Link)
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Friedrichstadt bestand eine jüdische Gemeinde seit dem 17. Jahrhundert.
Erstmals konnte sich 1675 ein jüdischer Händler namens Moses Marx in der Stadt niederlassen.
Seit 1708 war Friedrichstadt im Bereich der Herzogtümer Schleswig und Holstein
der einzige Orte, wo Juden leben konnten. Ihre Anzahl war nicht beschränkt, sie
durften Grundbesitz erwerben und ohne Einschränkungen Handel treiben.
In der ersten Hälfte des Jahrhunderts entwickelte sich die
jüdische Gemeinde zur zweitgrößten Glaubensgemeinschaft Friedrichstadt (in
der Stadt lebten in seltener Toleranz bis zu dreizehn verschiedene Konfessionen
zusammen: insbesondere Remonstranten, Mennoniten, Katholiken, Lutheraner,
Quäler, Socinianern).
Die Zahl der jüdischen Einwohner entwickelte sich im 19. Jahrhundert wie
folgt: 1803 187 jüdische Einwohner (in 47 Familien), 1835 375 jüdische
Einwohner (ca. 17 % der Bevölkerung), 1845 421 (in 99 Familien), 1871 193, 1905
117. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ging die Zahl der jüdischen Einwohner durch Ab- und
Auswanderung jüdischer Familien schnell zurück. Der Schleswig-Holsteinische
Krieg (1848-1851) trug zur Abwanderung der Familien bei.
Die jüdischen Haushaltsvorsteher waren bis weit ins 19. Jahrhundert fast ausschließlich
als Händler tätig: 1803 werden 38 Handelsleute genannt, die mit ihren Waren
über Dörfer, Städte und Märkte im gesamten Gebiet der Herzogtümer Schleswig
und Holstein zogen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts eröffnete zahlreiche
jüdische Handels- und Kaufleute offene Handlungen und Läden in der
Stadt.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (siehe
unten), eine jüdische Schule, ein rituelles Bad und einen Friedhof. Zur
Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt
("Kultusbeamter"), der
zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war; zeitweise war neben dem Lehrer
ein Schochet angestellt. Die Gemeinde gehörte zum Oberrabbinat
Schleswig-Holstein mit Sitz in Altona, seit 1928 war Friedrichstadt selbst
Rabbinatssitz (s.u.).
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Josef Hilbrecht
(geb. 1893 in Friedrichstadt, gef. 1917), Gefreiter David Levy (geb. 1883 in
Friedrichstadt, gef. 1915) und Gefreiter Martin Meier (geb. 1893 in
Friedrichstadt, gef. 1918).
Um 1924, als zur Gemeinde noch etwa 40 Personen gehörten (von insgesamt
1.800 Einwohnern), war Gemeindevorsteher Israel Behrend. Damals bestanden
noch zwei jüdische Vereine: der Männer-Beerdigungsverein (bzw. Männer-Chewro,
1924/32 unter Leitung von Julius Wolff, Westermarktstraße 17 mit sechs
Mitgliedern; Zweck und Arbeitsgebiet: Unterstützung Hilfsbedürftiger und
Kranken, Bestattungswesen) und der Frauenverein (1924 unter Leitung von
Fr. N. D. Levy mit gleichfalls sechs Mitgliedern, 1932 unter Leitung von Frau
Riekchen Heymann, Prinzenstraße 23 mit 13 Mitgliedern; Zweck und
Arbeitsgebiete: Unterstützung Hilfsbedürftiger und Kranker, Bestattungswesen).
Zur jüdischen Gemeinde in Friedrichstadt gehörten auch die wenigen in Heide
lebenden jüdischen Personen (1924 5 Personen).
1932 wurden 35 jüdische Einwohner gezählt. Die Gemeindevorsteher waren
Israel Behrend (1.Vors., Prinzenstraße 31), Adolf Heymann (2. Vors.,
Prinzenstraße 23) und Leopold Meier (3. Vors., Am Markt 6). Zur Gemeinde
gehörten nun auch die in Flensburg (44
jüdische Einwohner, Kappeln (9) und Heide
(3) lebenden jüdischen Personen. Seit 1928 (bis 1938) war Dr. Benjamin Cohen
Bezirksrabbiner von
Friedrichstadt-Flensburg mit Sitz in Friedrichstadt (wohnt seit 1929 in der
Westermarktstraße 24, direkt neben der Synagoge; er erteilte den
Religionsunterricht in Friedrichstadt (im Schuljahr 1931/32 zusammen 17 Kinder; seit 1934
hielt er Religionsunterricht auch in Flensburg und Rendsburg).
1933 lebten noch 32 jüdische Personen in der Stadt. Noch fünf Geschäfte
in der Stadt gehörten jüdischen Besitzern. Gegen sie richteten sich der
"Juden-Boykott" der Nationalsozialisten. Im Herbst 1938 lebten noch
etwa 20 jüdische Personen in der Stadt. Beim Novemberpogrom 1938 wurde
die Inneneinrichtung der Synagoge zerstört (siehe unten), die wenigen
jüdischen Geschäfte und Wohnungen wurden - insbesondere durch SA- und SS-Leute
- demoliert und geplündert. Die jüdischen Einwohner wurden verhaftet und nach
Flensburg verbracht. Einige von ihnen wurden in das KZ Sachsenhausen
verschleppt. Nach den Ereignissen im November 1938 versuchten die letzten
jüdischen Einwohner Friedrichstadt zu verlassen; 1940 verließ der letzte
jüdische Einwohner Friedrichstadt. Mehrere Friedrichstädter Juden ließen sich
in Hamburg nieder (seit 1937 war hier auch die Rabbinerfamilie Dr. Cohen; Dr.
Cohen wurde nach dem Novemberpogrom 1938 in das KZ Sachsenhausen verschleppt;
seit Ende 1938 war die Familie in Amsterdam, von hier deportiert), um von dort
ab 1942 deportiert zu werden.
Von den in Friedrichstadt geborenen und/oder längere Zeit am Ort
wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Hendel (Henny) Behrend
geb. Heymann (1873), Israel Behrend (1864), Rosa Behrend geb. Seligmann (1874),
Wilhelm Benjamin (1858), Flora Buttermann geb. Selig (1896), Rabbiner Dr. Benjamin
Cohen
(1895), Bertha Cohen geb. Malina (1895), Mirjam Cohen (1923), Johanna Hämpel geb. Heymann (1880), Marianne
(Mirjam) Häusler geb. Simon (1854), Flora Hasenberg (1888), Bertha (Pesche)
Heinssen geb. Salomon (1866), Adolph Heymann (1873), Heinz Heymann (1907), Kurt
Heymann (1912), Rika (Rieckchen) Heymann geb. Rosenthal (1873), Rudolf Heymann
(1910), Frieda (Fradche) Hirsch geb. Heymann (1874), Rosa Hirsch (1886), Alfred
(Abraham) Jacobsohn (1870), Cäsar Jacobsohn (1874), Ivan (Juan) Jacobsohn
(1875), Julius Jacobsohn (1877), Oskar (Ascher) Jacobsohn (1871), Clara (Klara)
Jacoby geb. Levy (1894), Clara Jaffé geb. Simon (1877), Henny Josias (1890),
Lippmann (Leo) Josias (1883), Rosa Josias (1888), Willy (Josua) Josias (1886),
Mendel (Josua) Josias (1891), Henny (Hindelchen) Karp geb. Simon (1873), Moritz
Katz (1882), Henriette (Clara) Krause geb. Levy (1885), Adelheid Levy geb.
Heymann (1867), Jacob Meyer Levy (1880), Meyer Nathan Levy (1874), Philipp
(Meyer Feiwes) Levy (1870), Recha (Rosa) Levy (1883), Jacob Meier (1872),
Leopold Meier (1893), Rolf Meier (1921), Therese Meier (geb. Levin 1899), Ella
Meyer geb. Selig (1879), Hanne Pilatus geb. Levy (1898), Selma Rosenberg geb.
Levy (1899), Ernst Selig (1922), Isidor Selig (1890), Jakob Selig (1856),
Salomon Herbert Selig (1902), Werner Adolf Selig (1921), Friedrich Levy Simon
(1885), Sigmund Simon (1879), Sophie Simon geb. Goldschmidt (1884), Berta Wolff
geb. Schloß (1890), Gutchen Wolff (1857), Henny Wolff (1911), Julius Wolff
(1887), Michael Wolff (1854), Willy Wolff
(1891).
Für mehrere der genannten Personen wurden seit 2003 in Friedrichstadt sog.
"Stolpersteine" verlegt: 2003 für Mirjam Cohen
(Westermarktstraße 24), 2004 für Henny Behrend geb. Heymann
(Gartenstraße 2), Johanna Hämpel geb. Heymann (Prinzenstraße 6), Adelheid
Levy geb. Heymann (Prinzenstraße 16), Adolf Heymann und Rieckchen Heymann geb.
Rosenthal (Prinzenstraße 23), Israel Behrend und Rosa Behrend geb. Seligmann
(Prinzenstraße 31), Ella Meyer geb. Selig (Prinzenstraße 34), Heinz Heymann
und Kurt Heymann (Kirchenstraße 2), Marjanne Häusler geb. Simon
(Ostermarktstraße 1), Leopold Meier und Rolf Meier und Therese Meier geb. Levin
(Am Markt 6), Rosa Hirsch (Westerhafenstraße 10), Willi Wolff
(Westerhafenstraße 14), Henny Josias und Lipmann Josias (Westerhafenstraße
19), Werner Selig und Isidor Selig (Am Binnenhafen 20), Wilhelm Benjamin (Am
Westersielzug 9), Auguste Wolff und Julius Wolff und Michael Wolff
(Westermarktstraße 17).
Pdf-Datei
"Verlegung von Stolpersteinen in Friedrichstadt".
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst wurden die Gottesdienste in einer Betstube in einem
Hinterhaus abgehalten. 1734 kaufte die jüdische Gemeinde das
Haus Ecke Fürstenburgwall/Binnenhafen, um hierin eine Synagoge
einzurichten. In ihr wurden bis zur Einweihung der neuen Synagoge (1847) Gottesdienste
abgehalten. Am 28. Dezember 1847 fand ein Abschiedsgottesdienst vor Einweihung
der neuen Synagoge statt (siehe Bericht unten).
1845 hatte die jüdische Gemeinde 421 Mitglieder. Der Neubau einer
Synagoge war bereits längere Zeit dringend notwendig. Er konnte bis zur Einweihung am 28. Dezember 1847
durchgeführt werden. Links und rechts der Synagoge waren die jüdische Schule
und das Rabbinat.
Die Einweihung der Synagoge hatte Rabbiner Jakob
Ettlinger aus Altona vorgenommen. Der Synagogenbau war durch einen Geldbetrag
aus dem Vermächtnis des am 4. August 1839 in Hamburg verstorbenen Isaac
Hartwig möglich geworden. Hartwig hatte in seinem Testament bestimmt: den
"jüdischen Gemeinden in Elmshorn, Rendsburg und Friedrichstadt vermache
ich einer jeden die Summe von fünfzehntausend Mark Courant zum Behufe eines auf
meinen Namen, und nach Art der Altonaer Synagoge auszuführenden neuen
Synagogenbaus. Es sollen jedoch zuförderst nach meinem Tode diese 45.000 Ct der
Israelitischen Gemeinde in Altona zugestellt werden, welche diese Gelder respektive
so lange für die drei erwähnten Gemeinden zu verwalten hat, bis eine jede
derselben einen Plan des beabsichtigten Baues eingesandt, und dieser Plan die
Genehmigung des Herrn Oberrabbiners und der Herren Vorsteher der Altonaer
Gemeinde erhalten hat. Ich hoffe und wünsche auch, dass diese genannten Herren
für die Ausführung des Baues Sorge tragen mögen und behalte es mir vor, für
eine jede Synagoge eine passende Inschrift vorzuschreiben; im Entstehungsfalle
aber, der Herr Oberrabbiner in Altona um Anfertigung einer solchen Inschrift
gebeten wird."
(zitiert nach: Harald Kirschninck: Die Geschichte der Juden in Elmshorn Band 1:
1685-1918 S. 236)
In die Stiftung Hartwigs erinnerte gemäß seinem im Testament formulierten
Willen eine gusseiserne Tafel über dem Eingang
in die Synagoge mit der hebräischen Inschrift (übersetzt:) "Groß sei
dieses Hauses Ehre, das zu des Weltenkönigs Ehre vermöge einer Gabe des
wacheren Mannes Isaak, Sohn von Herz Essen, im Jahre 5607 (1847) erbaut und
seiner Bestimmung übergeben wurde".
Die Einweihung der Synagoge (1847)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 4. Januar 1848:
"Schleswig. Friedrichstadt, den 28. Dezember 1847. Geehrter
Herr Redakteur! Heute feierten wir hier die Einweihung einer neuen
Synagoge, zu deren Erbauung der verstorbene Herr Isaac Hartwig in Hamburg,
welcher bekanntlich zu vielen anderen religiösen Zwecken bedeutende
Summen gespendet, ein Vermächtnis bestimmt hatte. Die Synagoge selbst
ist, wenn auch einfach, doch recht geschmackvoll gebaut und drücken wir
unsern besten Dank allen denen aus, die keine Mühe und Kosten scheuten,
dieses schöne Gotteshaus zur Vollendung zu bringen. Die Feier war eine
ansprechende und ging dem dazu gegebenen Programme gemäß in größter
Ordnung vor sich. In der alten Synagoge hielt Herr Direktor Gotthold einen
Vortrag, worin derselbe den Zweck und vielseitigen Genuss, welchen uns das
Gotteshaus verliehen, trefflich auseinander setzte; er nahm sodann in
gefälliger Sprache Abschied von den alten Räumen, um mit dem Panier
Israels, der Tora, in den neuen Tempel des Herrn einzuziehen. Artikel
in der Zeitschrift "Der treue Zionswächter" vom 4. Januar 1848:
"Schleswig. Friedrichstadt, den 28. Dezember 1847. Geehrter
Herr Redakteur! Heute feierten wir hier die Einweihung einer neuen
Synagoge, zu deren Erbauung der verstorbene Herr Isaac Hartwig in Hamburg,
welcher bekanntlich zu vielen anderen religiösen Zwecken bedeutende
Summen gespendet, ein Vermächtnis bestimmt hatte. Die Synagoge selbst
ist, wenn auch einfach, doch recht geschmackvoll gebaut und drücken wir
unsern besten Dank allen denen aus, die keine Mühe und Kosten scheuten,
dieses schöne Gotteshaus zur Vollendung zu bringen. Die Feier war eine
ansprechende und ging dem dazu gegebenen Programme gemäß in größter
Ordnung vor sich. In der alten Synagoge hielt Herr Direktor Gotthold einen
Vortrag, worin derselbe den Zweck und vielseitigen Genuss, welchen uns das
Gotteshaus verliehen, trefflich auseinander setzte; er nahm sodann in
gefälliger Sprache Abschied von den alten Räumen, um mit dem Panier
Israels, der Tora, in den neuen Tempel des Herrn einzuziehen. |
 Zum
Texte hatte der Redner Jesaja 1,12 gewählt, welche Worte ihrem Zwecke
aufs Vollkommenste entsprachen. Einige hiesige junge Männer sangen vor
und nach der Rede mehrere passende Psalmen ab, und hierauf bewegte sich
der Zug in regelmäßiger Folgereihe zur neuen Synagoge hin. Beim
Eintritte in dieselbe wurden wiederum mehrere Psalmen harmonisch
vorgetragen, und Vorsänger und Orchester wirkten nach Kräften, die Feier
zu verschönern. Die wahre Weihe indes gab dem Ganzen die in vollem Maße
ansprechende, phantasiereiche Rede des Herrn Oberrabbiners Ettlinger,
welche zum Texte 1. Könige 8,27-30 gewählt hatte. Viele Anschauungen aus
dem Reiche der Natur waren blumenreich im Laufe der Rede hineingeflochten
und sinnreiche Bilder aus dem Leben des Menschen verband der Redner in
Parabeln, mit der Anpreisung des Genusses, den uns ein Gotteshaus in so
reichem Maße bietet. Alle Anwesenden, darunter der hiesige Präsident,
Bürgermeister und Rat, wie auch mehrere Geistliche, waren herzlich
ergriffen von den eindringlichen Worten des allverehrten Redners. - Zum
Texte hatte der Redner Jesaja 1,12 gewählt, welche Worte ihrem Zwecke
aufs Vollkommenste entsprachen. Einige hiesige junge Männer sangen vor
und nach der Rede mehrere passende Psalmen ab, und hierauf bewegte sich
der Zug in regelmäßiger Folgereihe zur neuen Synagoge hin. Beim
Eintritte in dieselbe wurden wiederum mehrere Psalmen harmonisch
vorgetragen, und Vorsänger und Orchester wirkten nach Kräften, die Feier
zu verschönern. Die wahre Weihe indes gab dem Ganzen die in vollem Maße
ansprechende, phantasiereiche Rede des Herrn Oberrabbiners Ettlinger,
welche zum Texte 1. Könige 8,27-30 gewählt hatte. Viele Anschauungen aus
dem Reiche der Natur waren blumenreich im Laufe der Rede hineingeflochten
und sinnreiche Bilder aus dem Leben des Menschen verband der Redner in
Parabeln, mit der Anpreisung des Genusses, den uns ein Gotteshaus in so
reichem Maße bietet. Alle Anwesenden, darunter der hiesige Präsident,
Bürgermeister und Rat, wie auch mehrere Geistliche, waren herzlich
ergriffen von den eindringlichen Worten des allverehrten Redners. -
Wie in dem übrigen Sprengel der Herrn Oberrabbiners Ettlinger, herrscht
auch in unserer Gemeinde der echte Sinn für alles Altherkömmliche und
dass der Gottesdienst nach orthodoxem Ritus abgehalten wird, versteht sich
von selbst. Möge daher dieses Gotteshaus der Ort sein, wo jeder in seiner
besondern Lage, Lob, Dank und Bitte zu seinem Schöpfer emporsendet, und
möge hinfort jeder beruhigt und beglückt dasselbe verlassen.
D." |
50-jähriges Jubiläum der Synagogeneinweihung
(1898)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 3. Februar 1898: "Friedrichstadt
(Schleswig-Holstein), 27. Januar (1898). Am Schabbat Paraschat Schemot
(Schabbat mit der Toralesung Schemot = 2. Mose 1,1 - 6,1 - 21.
Tewet; sc. 50 Jahre zuvor war der 21. Tewet am 28. Dezember 1847),
den 15. Januar, waren es 50 Jahre, dass das hiesige Beth HaKnesset (Synagoge)
durch den damaligen Oberrabbiner [unser Lehrer, der Herr, unser
Meister Rabbi] Jakob Ettlinger [das Andenken an den Gerechten und Heiligen
ist zum Segen] aus Altona eingeweiht wurde. Beim
Frühgottesdienst wurde dieser Feier durch den Kultusbeamten S. Montag in
einer Rede gedacht und sprach derselbe den Wunsch aus, dass das Gotteshaus
durch das tägliche andächtige mit Minjan verrichtete Gebet in
demselben, diese Weihe nie verlieren möge, und dass hierzu jedes Mitglied
der Gemeinde beitragen möchte. - Die Synagoge über 100 Sitze fassend,
ist ein Geschenk von Rabbi Isaak Ben Rabbi Herz Essen, Vorsteher der
Gemeinde Hamburg, dessen man hier auch bei jeder Seelengedenkfeier
erinnert. Am Abend dieser 50-jährigen Jubiläumsfeier gab der Präses
der Chewra Kabranim, Herr Emanuel Wolf dahier, ein Festessen, wobei
verschiedene Reden und Toaste ausgebracht wurden. Möge der Ewige -
gepriesen sei er - den Segen Mischeberach, den der Präses der
Gemeinde Herr N. D. Levy durch den Kultusbeamten aussprechen ließ, in
reichlichem Maße in Erfüllung gehen lassen.
Amen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 3. Februar 1898: "Friedrichstadt
(Schleswig-Holstein), 27. Januar (1898). Am Schabbat Paraschat Schemot
(Schabbat mit der Toralesung Schemot = 2. Mose 1,1 - 6,1 - 21.
Tewet; sc. 50 Jahre zuvor war der 21. Tewet am 28. Dezember 1847),
den 15. Januar, waren es 50 Jahre, dass das hiesige Beth HaKnesset (Synagoge)
durch den damaligen Oberrabbiner [unser Lehrer, der Herr, unser
Meister Rabbi] Jakob Ettlinger [das Andenken an den Gerechten und Heiligen
ist zum Segen] aus Altona eingeweiht wurde. Beim
Frühgottesdienst wurde dieser Feier durch den Kultusbeamten S. Montag in
einer Rede gedacht und sprach derselbe den Wunsch aus, dass das Gotteshaus
durch das tägliche andächtige mit Minjan verrichtete Gebet in
demselben, diese Weihe nie verlieren möge, und dass hierzu jedes Mitglied
der Gemeinde beitragen möchte. - Die Synagoge über 100 Sitze fassend,
ist ein Geschenk von Rabbi Isaak Ben Rabbi Herz Essen, Vorsteher der
Gemeinde Hamburg, dessen man hier auch bei jeder Seelengedenkfeier
erinnert. Am Abend dieser 50-jährigen Jubiläumsfeier gab der Präses
der Chewra Kabranim, Herr Emanuel Wolf dahier, ein Festessen, wobei
verschiedene Reden und Toaste ausgebracht wurden. Möge der Ewige -
gepriesen sei er - den Segen Mischeberach, den der Präses der
Gemeinde Herr N. D. Levy durch den Kultusbeamten aussprechen ließ, in
reichlichem Maße in Erfüllung gehen lassen.
Amen." |
Gottesdienst zur Dreihundertjahrfeier der Gründung
von Friedrichstadt (1921)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 6. Oktober 1921: "Friedrichstadt (Eider), 22. September
(1921). Anlässlich der Dreihundertjahrfeier der Gründung Friedrichstadts
veranstaltete die hiesige jüdische Gemeinde am Schabbat Paraschat Ekew
(Schabbat mit der Toralesung Ekew, d.i. 5. Mose 7,12 - 11,25;
das war am 27. August 1921) einen Festgottesdienst in der Synagoge, der
auf die Gemüter aller Teilnehmer einen nachhaltigen Eindruck gemacht hat.
Das Stadtkollegium, die Geistlichkeit aller Konfessionen mit ihren
Gemeindevorständen wohnten diesem Gottesdienste bei. Nach Verrichtung des
Minchagebetes durch Herrn Lehrer Lubinski bestieg Herr Oberrabbiner Dr.
Lerner - Altona die Kanzel zu einer Festrede. Er entwickelte in großen
Zügen die Verhältnisse er entrechteten Juden in 17. Jahrhundert, und
zeigte, wie Friedrichstadt eine religiöse Freistadt für alle Verfolgten
wurde, auch für Juden. So komme es, dass noch heute 5 verschiedene
Konfessionen in dieser kleinen Stadt wohnen, die sich gegenseitig Achtung
entgegenbringen. Judenhass und Unduldsamkeit sind hier unbekannte Dinge
geblieben. Der Deutsche lebt friedlich mit dem Juden, der Lutheraner
begegnet dem Katholiken, Remonstranten, Mennoniten in Eintracht. Redner
betonte, dass Nächstenliebe eine alte Forderung der jüdischen Lehrer und
insbesondere für unsere heutige Zeit eine wichtige Eigenschaft sei. Die
Rede machte auf alle Hörer einen tiefen Eindruck. Ein Schlussgesang von Vorbeter
und Gemeinde endete diesen imposanten Gottesdienst." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 6. Oktober 1921: "Friedrichstadt (Eider), 22. September
(1921). Anlässlich der Dreihundertjahrfeier der Gründung Friedrichstadts
veranstaltete die hiesige jüdische Gemeinde am Schabbat Paraschat Ekew
(Schabbat mit der Toralesung Ekew, d.i. 5. Mose 7,12 - 11,25;
das war am 27. August 1921) einen Festgottesdienst in der Synagoge, der
auf die Gemüter aller Teilnehmer einen nachhaltigen Eindruck gemacht hat.
Das Stadtkollegium, die Geistlichkeit aller Konfessionen mit ihren
Gemeindevorständen wohnten diesem Gottesdienste bei. Nach Verrichtung des
Minchagebetes durch Herrn Lehrer Lubinski bestieg Herr Oberrabbiner Dr.
Lerner - Altona die Kanzel zu einer Festrede. Er entwickelte in großen
Zügen die Verhältnisse er entrechteten Juden in 17. Jahrhundert, und
zeigte, wie Friedrichstadt eine religiöse Freistadt für alle Verfolgten
wurde, auch für Juden. So komme es, dass noch heute 5 verschiedene
Konfessionen in dieser kleinen Stadt wohnen, die sich gegenseitig Achtung
entgegenbringen. Judenhass und Unduldsamkeit sind hier unbekannte Dinge
geblieben. Der Deutsche lebt friedlich mit dem Juden, der Lutheraner
begegnet dem Katholiken, Remonstranten, Mennoniten in Eintracht. Redner
betonte, dass Nächstenliebe eine alte Forderung der jüdischen Lehrer und
insbesondere für unsere heutige Zeit eine wichtige Eigenschaft sei. Die
Rede machte auf alle Hörer einen tiefen Eindruck. Ein Schlussgesang von Vorbeter
und Gemeinde endete diesen imposanten Gottesdienst." |
Spendenaufruf für den Umbau der kleinen Synagoge
(1928)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 22. März 1928: "Friedrichstadt (Eider), 15. März (1928).
Unsere kleine Gemeinde besitzt seit einigen Jahren eine zweite Synagoge,
die jünger und kleiner als die Hauptsynagoge ist. Erstere wird aber im
Winter benutzt wegen ihrer Heizbarkeit. Das Innere dieser kleinen Synagoge
war aber bisher wenig ansprechend. Nach längerem Bemühen ist es unserem
Lehrer, Herrn Jankelowitz, gelungen, die Gemeinde für einen Umbau zu
interessieren. Dieser Umbau ist nach seinen Anleitungen vor kurzem
vorgenommen worden und bietet der kleine Raum sich jetzt dem Besucher in
freundlichster Weise dar. Die Mittel für diesen Umbau wurden von einem
Friedrichstädter zum Andenken an seiner verstorbene Mutter
gestiftet." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 22. März 1928: "Friedrichstadt (Eider), 15. März (1928).
Unsere kleine Gemeinde besitzt seit einigen Jahren eine zweite Synagoge,
die jünger und kleiner als die Hauptsynagoge ist. Erstere wird aber im
Winter benutzt wegen ihrer Heizbarkeit. Das Innere dieser kleinen Synagoge
war aber bisher wenig ansprechend. Nach längerem Bemühen ist es unserem
Lehrer, Herrn Jankelowitz, gelungen, die Gemeinde für einen Umbau zu
interessieren. Dieser Umbau ist nach seinen Anleitungen vor kurzem
vorgenommen worden und bietet der kleine Raum sich jetzt dem Besucher in
freundlichster Weise dar. Die Mittel für diesen Umbau wurden von einem
Friedrichstädter zum Andenken an seiner verstorbene Mutter
gestiftet." |
In der Pogromnacht im November 1938 wurde das Gebäude von SA-Angehörigen
aus Husum und weiteren Nationalsozialisten im Innern zerstört. Noch während
des Krieges wurde das Gebäude zu einem Wohnhaus umgebaut.
2001/02 wurde das
Gebäude zu einer Kultur- und Gedenkstätte umgestaltet. Am 27. Januar 2003
wurde das Gebäude seiner neuen Bestimmung übergeben. Auf der ehemaligen Frauenempore wird
eine Ausstellung zur Geschichte der Friedrichstädter Juden gezeigt. Daneben
gibt es einen Dokumentationsraum. Der Saal wurde räumlich rekonstruiert und
bietet Platz für Sonderausstellungen, Konzerte, Vorträge, Lesungen usw.
Am Gebäude selbst kann man die Spuren seiner Geschichte ablesen. Die
Westfassade wurde in den Zustand vor 1938 zurückversetzt, die Nord- und Südseite
zeigt die Situation nach dem Umbau zum Wohnhaus mit Fenstern auf beiden Etagen.
Vorgehängte Rahmen in Form der ursprünglichen großen Rundbogenfenster deuten
auf die einstige Nutzung als sakrales Gebäude hin.
Standort der ehemaligen Synagoge: Am Binnenhafen
17/Ecke Westermarktstraße.
Fotos
Historische Fotos:
(Quelle: H. Hansen s. Lit. S.41)
 |
Blick entlang der
Westermarktstraße um 1930. Am Ende der Straße liegt
die Synagoge; das
kleine Haus davor war das Rabbinat |
Fotos nach 1945/Gegenwart:
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum: 20.8.2003)
 |
 |
 |
Dieselbe Perspektive wie das
historische Foto von ca. 1930 |
Die Synagoge an der
Westermarktstraße.
Die vorgehängten Rahmen zeigen die Form
der
ursprünglichen Rundbogenfenster |
Rechts der Synagoge war in dem
kleinen Haus das Rabbinat (seit 1929
Wohnhaus der Rabbinerfamilie Cohen) |
| |
| |
|
|
 |
 |
 |
Eingangsseite von der
Straße
"Binnenhafen" |
Hinweisschild
am Eingang |
Gedenkstein mit
Inschrift* |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Blick in den Betsaal von der
Frauenempore |
Blick zum Platz des
Toraschreines |
Blick zur ehemaligen
Frauenempore |
| |
|
|
 |
 |
|
Blick aus der Synagoge auf
den
Gedenkstein |
Aufgang zur
ehemaligen
Frauenempore |
|
| |
|
|
*Inschrift des Gedenksteines: "Hier gegenüber befanden
sich einst die Synagoge (Am Binnenhafen 17), die Judenschule (Am Binnenhafen 18)
sowie das Rabbinat (Westermarktstr. 24) der jüdischen Gemeinde. Die Synagoge,
zu der im Jahre 1845 - im Jahre 5606 jüdischer Zeitrechnung - der Grundstein
gelegt worden war, wurde in der Frühe des 10. November 1938 von Nationalsozialisten
im Innern zerstört - Lebende seid tolerant und allzeit wachsam!"
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| März 2010:
Vorstellung einer neuen Studie zur jüdischen
Geschichte Friedrichstadts |
Artikel von Bernd Philpsen in der Website shz.de
(Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag, Artikel)
vom 12. April 2010:
"Dorothea Parak - Berliner Historikerin beleuchtet jüdisches Leben in Friedrichstadt.
Friedrichstadt beherbergte in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine der größten jüdischen Gemeinden des Nordens. Historikerin Dorothea Parak hat dazu eine Studie verfasst.
Der Kaufmann Simon Benjamin hat Geschichte geschrieben: Er war der erste jüdische Bürger Friedrichstadts überhaupt, dem es ermöglicht worden war, ein öffentliches Amt zu bekleiden. Zunächst Deputierter, wurde er 1871 zum Stadtverordneten gewählt. Damit saß erstmals ein Jude im Magistrat jener Stadt, die sich als Ort religiöser Vielfalt und Toleranz einen Namen gemacht hatte.
Gestützt auf eine breite Quellenbasis, beleuchtet die aus Bayern stammende und jetzt in Berlin lebende Historikerin Dorothea Parak in ihrer in der ehemaligen Synagoge von Friedrichstadt vorgestellten faktenreichen Untersuchung das alltägliche Leben und die Religiosität der Juden und die Beziehungen der jüdischen Minorität zur christlichen Mehrheitsgesellschaft. Jahrzehntelang lebten hier Lutheraner, Remonstranten, Mennoniten, Katholiken, Juden und zeitweise auch Quäker und Sozinianer miteinander. Mitte des 19. Jahrhunderts stellte die jüdische Gemeinschaft nach den Lutheranern die zweitgrößte religiöse Gruppe: Von den 2472 Friedrichstädtern waren 421, also bemerkenswerte 17 Prozent, Juden. Die jüdische Gemeinde von Friedrichstadt zählte damit in Relation zur gesamten Einwohnerschaft zu den größten Gemeinden Norddeutschlands.
Das 1621 von Herzog Friedrich III. gegründete 'Holländerstädtchen' war lange Zeit der einzige Ort im Herzogtum Schleswig, an dem sich Juden ohne besondere Privilegien ansiedeln konnten. So übte er auf diesen Personenkreis eine starke Anziehungskraft aus. In ihrer Blütezeit verfügte die jüdische Gemeinde über eine Infrastruktur, die weit über die Stadtgrenzen hinausstrahlte: Dazu zählten Synagoge, Ritualbad, Friedhof, Rabbinat, Schule und Schächter. Mit der christlichen Umwelt gab es vielfältige institutionelle und private Kontakte, so dass die Juden bald einen wichtigen Bestandteil des Alltagslebens darstellten.
Besonders präsent waren sie im Handelsleben. Doch bestimmte bürgerliche Institutionen blieben ihnen lange verschlossen, beispielsweise die traditionellen Gilden. Auch die Möglichkeit der Mitwirkung an der Kommunalpolitik ließ auf sich warten - bis um 1864 die Gleichstellungsgesetze ihre Wirkung entfalteten. Die Folge: 1870 wurde mit Simon Benjamin zum ersten Mal ein Jude zum deputierten Bürger bestimmt und damit Angehöriger eines städtischen Beschlussgremiums; ein Jahr darauf wurde er zum Stadtvertreter gewählt. Die Juden Friedrichstadts waren nun auch in der Politik
'angekommen'. Doch ihre Partizipation am politischen Leben war nur von kurzer Dauer. Denn der vordringende Antisemitismus machte auch vor der Stadt an der Eider und der hier praktizierten christlich-jüdischen Koexistenz nicht Halt. Wohin diese um sich greifende Ideologie schließlich führte, verdeutlichen 20 in den Straßen Friedrichstadts verlegte
'Stolpersteine' zur Erinnerung an Opfer des Holocaust." |
| |
 Informationen
zum Buch von Dorothea Palak: Informationen
zum Buch von Dorothea Palak:
"Juden in Friedrichstadt an der Eider. Kleinstädtisches Leben im 19. Jahrhundert.
Mit der Gründung Friedrichstadts an der Eider durch den gottorfschen Herzog Friedrich III. entstand ein im 17. Jahrhundert ungewöhnlicher
'Ort der Toleranz". In den Jahrzehnten nach der Gründung erhielten sieben verschiedene Religionsgemeinschaften die Niederlassungserlaubnis und Religionsfreiheit in Friedrichstadt. Neben Lutheranern, Katholiken und Remonstranten waren darunter auch Juden, deren Gemeinde in Friedrichstadt insbesondere im 19. Jahrhundert bedeutend an Größe gewann und zur zweitgrößten Glaubensgemeinschaft der Friedrichstädter Bevölkerung heranwuchs.
Mit ihrer lokalhistorischen Studie 'Juden in Friedrichstadt an der Eider. Kleinstädtisches Leben im 19.
Jahrhundert' veranschaulicht Dorothea Parak die jüdische Lebenswelt in einer christlich geprägten Umwelt.
Im Rahmen ihrer Forschung zeichnet Parak zunächst die Entwicklung Friedrichstadts und seiner territorialen, rechtlichen und administrativen Verhältnisse nach. Anschließend erfolgt eine eingehende Betrachtung der jüdischen Sozialstruktur in Friedrichstadt im 19. Jahrhundert, die Parak anhand der jüdischen Migration, Erwerbstätigkeit und Arbeitsbeziehungen aufzeigt. In einem dritten Schwerpunkt der Studie setzt sich Parak mit dem alltäglichen jüdischen Leben in Friedrichstadt bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts auseinander. Wesentliche Aspekte sind hier die Praxis der jüdischen Religion, das gesellschaftliche Leben vor allem in Vereinen, die politischen Handlungsmöglichkeiten von Juden, das Bildungs- und Schulwesen und der mit diesen Aspekten im Zusammenhang stehende Kontakt zwischen jüdischen und christlichen Friedrichstädtern.
In der historischen Forschung beschäftigten sich Studien zum Thema Judentum lange Zeit insbesondere mit dem jüdischen Leben in der Stadt sowie mit den Juden zum Zeitpunkt der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus. Die lokalhistorische Studie von Dorothea Parak leistet einen bedeutenden Beitrag im Forschungsbereich zu Land- und Kleinstadtjuden im 19. Jahrhundert. Parak stellt das Thema zusammenhängend und umfangreich dar und kann den persönlichen Werdegang einiger Friedrichstädter Juden im 19. Jahrhundert detailreich rekonstruieren. Ihre gründliche Recherche und logische Rückschlüsse ermöglichen eine allgemeine Vorstellung der Lebenswelt kleinstädtischer Juden vor dem Ersten Weltkrieg. Paraks Studie beinhaltet interessante Erkenntnisse, etwa die Verbürgerlichungstendenzen einiger kleinstädtischer Juden. Außerdem unterstützt sie ihre Studie mit Bildmaterial und verschiedenen Grafiken.
17 x 24 cm, 256 S., brosch.
Parak, Dorothea - Aus der Reihe: Quellen u. Studien zur Gesch. der Juden in S-H, Bd. 4 / zeit + geschichte, Bd. 12."
Bestellmöglichkeit
direkt über die Website des Wachholtz-Verlages. (www.wachholtz.de) |
| |
| |
| |
| |
| April 2013:
Pressebericht zur Geschichte der Synagoge
|
Artikel von "ume" in den "Huseumer
Nachrichten" vom 10. April 2013: "Friedrichstadt. Die alte
Synagoge ist heute ein Treffpunkt..."
Link
zum Artikel (auch eingestellt als pdf-Datei) |
| |
| Juli 2014:
Putzaktion der "Stolpersteine" |
Artikel in den "Husumer
Nachrichten" vom 3. Juli 2014: "Geputzte Erinnerungen : Stolpersteine auf Hochglanz poliert
Friedrichstädter Pfadfinder reinigen die Erinnerungstafeln für getötete Juden im Straßenpflaster des Holländerstädtchens. 25 Messingtafeln wurden seit dem Jahr 2003 vor den früheren Wohnhäusern der Juden verlegt.
2003 wurde der erste von ihnen in der Friedrichstädter Innenstadt als Erinnerung an Mirjam Cohen verlegt. Disem Friedrichstädter Stolperstein aus Messing folgten weitere 24. Gestaltet wurden sie von dem Kölner Künstler Gunter Demnig, der damit an die Opfer der NS-Zeit erinnern will. Mittlerweile liegen die Stolpersteine in mehreren Ländern Europas. „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, beschreibt Demning seine Motivation für die Steine..."
Link
zum Artikel |
| |
| September 2014:
Friedrichstädter Tage jüdischer Kultur |
Artikel in den "Husumer
Nachrichten" vom 14. September 2014: "Jüdische Kultur in Friedrichstadt : Besondere Premiere in der Synagoge
Die Friedrichstädter Tage jüdischer Kultur finden vom 17. bis zum 28. September statt. Neben Musik und Theater gibt es einen Hebräisch-Kursus. Besuchern soll ein Einblick in das reiche Kulturleben gegeben werden.
Von der jüdischen Kultur gibt es im Land nur noch wenige Zeugnisse. Brutal haben die Nazis zwischen 1933 und 1945 ihre Vernichtungspolitik durchgesetzt. Viele Juden wurden in den Konzentrationslagern ermordet, ihre Kulturdenkmäler zerstört oder zweckentfremdet. Eines ist die ehemalige Synagoge in Friedrichstadt, wo es bis in die 1930er Jahre eine jüdische Gemeinde gab. Viele Jahre wurde das Gebäude als Wohnhaus genutzt. Seit 2003 dient sie nun als Erinnerungsstätte und Kulturzentrum. Zahlreiche Veranstaltungen hat das Kuratorium der Kultur- und Gedenkstätte Ehemalige Synagoge im Laufe der Jahre auf die Beine gestellt. Nur der Wunsch, ein Festival der jüdischen Kultur zu veranstalten, konnte bislang nicht realisiert werden, weil es an finanzieller Unterstützung fehlte. Die ist nun da. Die Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten und das Kulturministerium haben 5000 Euro zur Verfügung gestellt, wie Kuratoriums-Mitglied Christiane Thomsen erklärt. Und am Mittwoch (17. September) beginnen die Friedrichstädter Tage der jüdischen Kultur. Bis Sonntag (28.) erwartet ein vielseitiges Programm.
'Uns ist es ein Anliegen, die jüdische Kultur der Gegenwart in Deutschland
vorzustellen', so Christiane Thomsen..."
Link
zum Artikel (mit Programm der Tage) |
| |
|
September 2015:
Zweite
Friedrichstädter Tage jüdischer Kultur
|
Artikel von Ullrich Meißner in den "Husumer
Nachrichten" vom 2. September 2015: "Festival im Holländerstädtchen. Tage
der jüdischen Kultur in Friedrichstadt. Eine Woche lang findet ein
Festival der jüdischen Kultur in Friedrichstadt statt, zum zweiten Mal. Ein
ehrenamtliches Kuratorium stellt das Programm zusammen, es reicht von Musik
über Vorträge bis zu Lesungen.
Zum zweiten Mal finden sie nun im September in Friedrichstadt statt, die
Tage der jüdischen Kultur. Organisiert wird das kleine Festival von einem
ehrenamtlich tätigen Kuratorium unter der Leitung des Friedrichstädter
Museums. Alle drei Monate trifft sich die Gruppe. Finanziert wird die
Veranstaltungsreihe durch das Kulturministerium und die Bürgerstiftung
Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten. 4000 Euro stehen so zur Verfügung, um
das Festival auf die Beine zu stellen, wie Christiane Thomsen vom Museum der
Stadt erläutert. Die Auswahl der Teilnehmer bestimmt das achtköpfige
Kuratorium. Dabei, erklärt Christiane Thomsen, sei das Angebot relativ groß,
denn wegen der Kultur- und Gedenkstätte Ehemalige Synagoge in
Friedrichstadt, würden viele Künstler bei ihr nach Auftrittsmöglichkeiten
anfragen, 'so dass wir schon eher die Qual der Wahl haben...'"
Link zum Artikel (mit Programm der Tage)
|
Links und Literatur,
Filmhinweis
Links:
Literatur:
 | 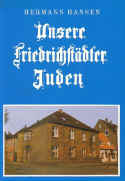 Hermann Hansen: Unsere Friedrichstädter Juden. Friedrichstadt
1976. Hermann Hansen: Unsere Friedrichstädter Juden. Friedrichstadt
1976.
Die Broschüre mit einem Foto der ehemaligen Synagoge in den 1970er-Jahren
war seinerzeit eine "Pionierarbeit"; sie ist schon längere Zeit
vergriffen. |
 | "...und bitten, die Würde des Platzes zu respektieren." Ein
Stadtrundgang zur Geschichte der Friedrichstädter Juden im 20. Jahrhundert.
Hg. vom Historischen Museum Friedrichstadt "Alte Münze". |
 | Christiane Thomsen: Friedrichstadt. Ein historischer
Stadtbegleiter. Heide 2001. |
 | dies.: Friedrichstadts Umgang mit der jüdischen
Vergangenheit. In: Fiete Pingel / Thomas Steensen (Hg.): Jüdisches
Leben und Judenverfolgung in den Frieslanden. Bräist/Bredstedt 2001 S.
131-140. |
 | Karl Michelson: Friedrichstadt in den Jahren 1933
bis 1941: über das Leben in der Stadt im 'Dritten Reich'. Friedrichstadt:
Gesellschaft für Frierichstädter Stadtgeschichte 1998. 550 S. |
 | Fiete Pingel / Thomas Steesen (Hrsg.):
Jüdische Leben und Judenverfolgung in den Frieslanden: Beiträge vom 4.
Historiker-Treffen des Nordfriisk Instituut. Bräist/Bredstedt.
2001. |
 | Gerhard Paul/Miriam Gillis-Carlebach (Hg.):
Menora und Hakenkreuz. Zur Geschichte der Juden in und aus
Schleswig-Holstein, Lübeck und Altona. Neumünster 1998. Darin
u.a.:
Bernd Philipsen: "...ein selbständiger Denker, erfahren in
Talmud und Halacha. Dr. Benjamin Cohen, Bezirksrabbiner von
Friedrichstadt/Flensburg" S. 107-119.
Fiete Pingel / Thomas Steensen: "Es gab einmal Juden in
Nordfriesland". Jüdisches Leben und Antisemitismus in Friedrichstadt
und im übrigen Nordfriesland. S. 297-315. |
 | Miriam Gillis-Carlebach (Hg.): Memorbuch zum
Gedenken an die jüdischen, in der Schoa umgekommenen Schleswig-Holsteiner
und Schleswig-Holsteinerinnen. Hrsg. vom Verein ehemaliger
Schleswig-Holsteiner in Israel. Hamburg 1996. |
 | Gerhard Paul/Bettina Goldberg: Matrosenanzug
– Davidstern. Bilder jüdischen Lebens aus der Provinz. Neumünster 2002. |
 | Marie-Elisabeth Rehn: Juden in Friedrichstadt -
Vorstandsprotokolle der Israelitischen Gemeinde von 1802 - 1860.
Hartung-Gorre-Verlag Konstanz 2001. Online
zugänglich |
 |  Dorothea
Parak: Juden in Friedrichstadt an der Eider: Kleinstädtisches Leben
im 19. Jahrhundert. 254 S. Wachholtz Verlag 2010. 24 € Dorothea
Parak: Juden in Friedrichstadt an der Eider: Kleinstädtisches Leben
im 19. Jahrhundert. 254 S. Wachholtz Verlag 2010. 24 €
Die Studie stellt erstmals jüdisches Leben in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein vor. Detailliert werden unterschiedliche Lebensbereiche wie Arbeit, Freizeit und Religion beschrieben. Auch private Beziehungen zwischen Juden und Christen werden beleuchtet. Das regionale Beispiel ist wohl gewählt: Das "Holländerstädtchen" Friedrichstadt ist bekannt für seine religiöse Vielfalt. Hier lebten neben evangelischen und katholischen Christen auch Remonstranten, Mennoniten und Juden. Die jüdische Gemeinde war im 19. Jahrhundert die zweitgrößte Religionsgemeinschaft in der Stadt und in Relation ihrer Mitglieder zur Gesamtbevölkerung eine der größten Gemeinden
Norddeutschlands. |
 | Weitere Literatur zur jüdischen Geschichte in Friedrichstadt und
Nordfriesland: hier
anklicken |
Hinweis
auf den Film von Heike Mundzeck
 "Wer wohnte in der Synagoge von Friedrichstadt?" -
Erinnerungen an eine Kindheit
"Wer wohnte in der Synagoge von Friedrichstadt?" -
Erinnerungen an eine Kindheit
Mehr als ein Jahr lang haben die Hamburger Filmemacherin Heike Mundzeck und der
Kameramann Holger Braack den Umbau der alten Synagoge in Friedrichstadt
(Schleswig-Holstein) zu einer Kulturellen Begegnungsstätte begleitet. Dabei
ging es nicht nur um das Konzept des Projektes, das wegen seiner ungewöhnlichen
Perspektive auf die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart mancherlei
Kontroversen aufwarf, sondern auch um den Blick zurück in jene Jahre, als die
Synagoge noch Teil des jüdischen Lebens in dieser Kleinstadt an der Treene war.
Und dann im November 1938 zerstört und noch im Krieg zu einem Wohnhaus umgebaut
wurde. Im Stadtarchiv fand die Autorin zahlreiche wohlgeordnete Unterlagen zur
Geschichte des 1845 erbauten Gotteshauses und seiner schändlichen Zerstörung
sowie seiner späteren Nutzung. Und mit Hilfe engagierter Friedrichstädter Bürgerinnen
und Bürger, die alte Fotos und persönliche Erinnerungen beitrugen, ließ sich
ein Stück Zeitgeschichte mit ihren Lebensumständen rekonstruieren, das nicht
in Vergessenheit geraten sollte.
Für die Autorin gab es für diesen Film jedoch auch noch ein besonderes Motiv:
sie selbst hat als sechsjähriges Mädchen etwas mehr als ein Jahr in der alten
Synagoge gewohnt, ist in Friedrichstadt eingeschult worden und hatte, bis zur
Entdeckung der Geschichte des Hauses als längst Erwachsene keine Ahnung, dass
es ihr Vater war, der damals den Umbau der zerstörten Synagoge vornehmen ließ,
um seine Familie aus dem Bombenhagel in Hamburg in Sicherheit bringen zu können.
Dem Schock folgte die Scham über diese Entweihung eines jüdischen
Gotteshauses, dann der Entschluss, das Stück eigener Biographie zum Anlass zu
nehmen, um an die Verantwortung zu erinnern, die wir nachfolgenden Generationen
haben.
Recherchen in Friedrichstadt: Wie denkt die Bevölkerung über das Haus und
seine Geschichte, wer kann noch etwas von früher erzählen? Gab es viele Nazis
hier? Und warum wurde die Schändung 60 Jahre fortgesetzt? Was schließlich ist
aus den Juden der Stadt geworden, sind welche zurückgekehrt?
Nicht alle Fragen lassen sich beantworten. Aber aus dem beteiligten Hinschauen
und Nachfragen, Wahrnehmen und Weitergeben kann etwas Neues wachsen. Das
attraktive Touristenstädtchen hat seine Vergangenheit angenommen mit diesem
Haus der Toleranz und Begegnung für alle, die Erinnerung für eine Form der
Versöhnung halten.
Der Film wurde auf den 46. Nordischen Filmtagen Lübeck 2004 vorgestellt.
Vorstellungstext (deutsch/englisch)." |
Kontaktanschrift:
Heike Mundzeck Luzifilm Hamburg Isestrasse 61 20149 Hamburg
Tel; 040/460 39 11 Fax: 040/46 53 77 E-Mail
Dazu: Artikel "Es
war ein Moment der Scham" - Die Hamburger Filmemacherin Heike Mundzeck
erinnert sich an ihre Kindheit. In: Hamburger Abendblatt vom 16. Mai 2005.
|
zur Seite über den alten jüdischen Friedhof in
Friedrichstadt, zur Seite über den
neuen jüdischen Friedhof in Friedrichstadt
Links zu Seiten anderer Orte in Schleswig-Holstein (bei "Alemannia Judaica"):
Bad Segeberg,
Elmshorn,
Oldenburg (Holstein),
Rendsburg
|