|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
Salach (Kreis
Göppingen)
Jüdische Geschichte
Übersicht:
Zur jüdischen Geschichte
in Salach
Vorbemerkung
In Salach gab es zu keiner Zeit eine jüdische
Gemeinde. Im 19./20. Jahrhundert lassen sich bei den Volkszählungen seit der
Mitte des 19. Jahrhunderts einzelne jüdische Personen feststellen, wobei es sich
teilweise um bei den Volkszählungen zufällig ortsanwesende und nicht
um ortsansässige Personen gehandelt haben kann. Im Einzelnen wurden gezählt:
1871 erstmals eine jüdische Person, 1875 vier, 1880 und 1885 je drei, 1890 und
1895 keine, 1900 und 1905 je drei, 1910, 1925 und 1933 je zwei jüdische Personen
am Ort.
Bei den 1875 bis 1885 genannten Personen ist die Familie von David Gebhard
(gest. 1888) mit seiner Frau Rosa geb. Neuburger und seiner Mutter (gest. 1879)
gemeint (siehe unten).
Die
Mechanische Weberei Salach, J. H. Neuburger GmbH.
Von 1870 bis um 1960 bestand in Salach die Mechanische Weberei
J. H. (= Jsaak Heinrich) Neuburger GmbH bzw.
Mechanische Weberei Salach.
Zur Geschichte der Firma von 1838 bis 1960 (zitiert aus Adolf Aich: Geschichte...
s. Lit. 1960 S. 162-164; zu den mit *) markierten Personen finden sich weitere
Informationen unten bei den familiengeschichtlichen Anmerkungen):
"Geschichte der Mechanischen Weberei Salach, J. H. Neuburger GmbH.
Die Mechanische Weberei Salach gehört zu den ältesten Firmen der
württembergischen Baumwollindustrie. Gegründet wurde dieselbe im Jahre 1838 von
Isaak Heinrich Neuburger* in
Dietenheim bei Laupheim als Handweberei. Sie stellte bunte Gewebe her.
Der Gründer wurde am 14. August 1814 in Buchau am
Federsee geboren. Schon im väterlichen Hause in Buchau standen
Handwebstühle. In seiner frühen Jugend erlernte er die Weberei; später ging er
auf Wanderschaft, um sich in der Fremde gründliche Kenntnisse zu erwerben. Er
heiratete Helene geb. Maier* aus Laupheim.
Um seinen Kindern eine gute Erziehung zu geben, scheute er die hohen Kosten
nicht, in seinem Hause gute Hauslehrer aufzunehmen.
Die Industrieausstellung in London 1851 zeigte unter verschiedenen schwäbischen
Erzeugnissen unter anderem gestickte Fenster- und Bettvorhänge aus Mousselin von
H. Neuburger Senior, Dietenheim (Anmerkung:
ist mit H. Neuburger Senior noch der Vater von Isaak Heinrich Neuburger gemeint?
Das wäre der in diesem Jahr am 12. Juni 1851 verstorbene Hirsch Michael
Neuburger* gewesen).
Die Jahre 1854/55 brachten die Verlegung des Betriebes nach
Ulm/Donau. Der Wegzug des rührigen und
strebsamen Fabrikanten wurde in
Dietenheim sehr bedauert, da er sich um das Wohl der Gemeinde verdient
gemacht hatte. In Ulm baute J. H. Neuburger am Marktplatz ein Wohnhaus, außerdem
erstellte er eine mechanische Buntweberei. In seinem Unternehmen, sowie als
Mitglied des Ulmer Bürgerausschusses und als Gewerberat entfaltete er eine rege
Tätigkeit zum Wohle der Stadt. Auf der Weltausstellung in Paris im Jahre 1867
und auf der schwäbischen Industrieausstellung in Ulm im Jahre 1871 wurden seine
Erzeugnisse mit Auszeichnungen bewertet. Ende der 1860er Jahre brannte bei einem
Großfeuer im Winter seine Mechanische Buntweberei bis auf die Grundmauern
nieder. Gerade am Brandtage war die Feuerversicherung erloschen, so dass die
Versicherung keine Entschädigung bezahlte. Infolge einer Erkrankung musste er in
den kalten Wintermonaten nach dem südlichen Meran. Dort ist er im November 1870
gestorben.
Vor dem Ableben von J.H. Neuburger* verlegte die Firma die Fabrik von Ulm nach
Salach. Nach seinem Tode übernahmen seine Frau (= Helene Neuburger
geb. Maier) und sein ältester Sohn Max Neuburger* (= Max J.
Neuburger) das Geschäft. Seine Erben erwarben am 7. Juli 1869 von den Erben
Borst in Göppingen die frühere Borst'sche Tuchfabrik nebst Kundenmühle in
Salach, einschließlich der dazugehörigen Wasserkraft am Kanal. In den
Fabrikräumen richteten die Erben Neuburger eine Mechanische Buntweberei ein. Die
alten Wasserräder der Kundenmühle ersetzte man durch neuzeitliche Turbinen,
außerdem richtete man eine Dampfkraftanlage ein. Die Leistungsfähigkeit der
Fabrik konnte damit gesteigert werden. Aus England und der Schweiz bezog die
Firma neue mechanische Webstühle. Die im Familienbesitz befindliche Firma H.
Neuburger Söhne in Stuttgart ist nach dem Tode des Seniors der Familie
Neuburger aufgelöst worden, Lager und Kontor verlagerten die Inhaber nach
Salach. Martin und Max R. Neuburger waren damals Teilhaber der Firma H.
Neuburger in Stuttgart.
Im Jahre 1881 übernahmen Max R. Neuburger*, Martin Neuburger* und Max J.
Neuburger* in Stuttgart das Fabrikanwesen in Salach. Max J. Neuburger* erhielt
vom württembergischen König in Anerkennung seiner Verdienste in Handel und
Gewerbe den Titel Kommerzienrat. Er starb im Jahre 1889 im Alter von erst 46
Jahren. Die Weberei wurde von 1881 bis 1891 mehrfach erweitert und ausgebaut. In
den Jahren 1904 bis 1905 erbaute die Firma eine Spulerei und Schlichterei, im
Jahre 1916 erfolgte der Ausbau der Schlichterei und schließlich musste für die
Jacquard ein moderner Shedbau erstellt werden.
Im Jahre 1913 sind die Söhne von Max R. Neuburger*, Hermann* und Emil*, sowie
Albert Neuburger*, der Sohn von Martin Neuburger*, als Teilhaber aufgenommen
worden. Diese erweiterten die Fabrik durch den Bau einer Färberei (1924) und
einer Bleicherei (1927). Durch die Initiative von Emil Neuburger* nahm die
Fabrik im Jahre 1929 auch noch die Fertigung von Kunstleder auf.
1938 musste das ganze Unternehmen infolge der Maßnahmen der damaligen Regierung
verkauft werden. Am 8. August 1938 ging das Fabrik Anwesen in den Besitz der
Firma Steiger & Deschler GmbH., Ulm-Söflingen, über. Die Leitung der Fabrik in
Salach übernahm Hermann Deibele, der seit 1924 im Salacher Betrieb tätig war.
Die Familien Neuburger waren zur Auswanderung genötigt. Von ihrem Vermögen
konnten sie nur wenig mitnehmen. Sie wanderten nach Amerika aus. Dort verstarb
Frau Luise Neuburger* am 14. August 1944 und Emil Neuburger* am 27. Dezember 1946
in New York. Aufgrund des alliierten Rückerstattungsgesetzes übergab die Firma
Steiger & Deschler in einem gerichtlichen Vergleichsverfahren am 28. November
1949 die Salach auf Fabrik den Familien Neuburger in Amerika. Unter der alten
Firmenbezeichnung Mechanische Weberei Salach, J. H. Neuburger oHG., führten
Hermann Neuburger in New York und Bankdirektor Richard Neuburger in Stuttgart,
in Verbindung mit Hermann Deibele in Salach den Betrieb weiter.
Vom Ende des Weltkrieges bis 1949 stand das Salacher Werk als widerrechtlich
entzogenes Gut unter Treuhänderschaft. Betriebs- und Branchefremde walteten als
Treuhändern. Im Gegensatz zu freien Firmen, die diese Jahre gut nutzten und
Verbesserungen durchführten, wurde im Salacher Betriebe gar nichts getan. Unter
diesem Versäumnis litt das Unternehmen noch lange Zeit. Als erste dringende
Investitionen war die Erstellung einer modernen Kessel-Kraft- und
Elektrizitätsanlage in den Jahren 1950 und 1951 notwendig. Durch
Gesellschaftsvertrag vom 15. Juni 1950 waren die O.H.G.-Gesellschafter
übereingekommen, auf eine neu zu errichtende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung sämtliche Aktiven und Passiven der bisherigen offenen
Handelsgesellschaft, mit Ausnahme der Fabrikgrundstücke, Maschinen, sowie der
dazugehörigen Betriebsvorrichtungen, zu übertragen. Im Verfolg dieses
Beschlusses wurde die Firma Mechanische Weberei Salach, J. H. Neuburger GmbH.,
Sitz in Salach, neu gegründet. Die alte oHG. änderte ihren Namen in Neuburger &
Co. Diese Änderung ist am 25. September 1950 in das Handelsregister Göppingen
eingetragen worden. Die Firma Neuburger & Co. blieb Besitzgesellschaft, während
die GmbH. Betriebs- und Vertriebsgesellschaft wurde. Die alten
O.H.G.-Gesellschafter beziehungsweise deren Erben verblieben als
GmbH.-Gesellschafter, neu trat Hermann Deibele als Gesellschafter in die GmbH
ein. Das Geschäfte führten Hermann und Richard Neuburger, ferner Hermann Deibele.
Am 20. Januar 1952 verstarb Richard Neuburger*.
Die Kunstlederfabrikation musste in den Jahren 1952 bis 1955 baulich und
maschinell erweitert werden. Die Gesellschaftsversammlung der Firma Neuburger
und Co. beschloss am 29. Februar 1956, sämtliche Aktiven und Passiven mit
Wirkung vom 31. Dezember 1955 an die Firma Mechanische Weberei Salach, J. H.
Neuburger GmbH., zu verkaufen. Damit war die Firma Neuburger und Co. erloschen.
Durch die Erstellung einer neuen modernen Appretur- und Trockenmaschine
verbesserte sich die Firma 1956. Im gleichen Jahr entschloss man sich zur
Einrichtung einer Druckerei.
Das Unternehmen war immer bemüht, Wohnungen für die Angestellten und Arbeiter zu
schaffen. Mit der Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft am 16. Oktober 1950
begann das soziale Unternehmen und die Geschäftsführung übernahm Hermann Deibele. Das erste
Sechs-Familienhaus entstand 1951/52, (sc. an der Lippstraße),
ein weiteres Sechs-Familienhaus 1955/56. Die Firma verfügt im ganzen über 27
Werkswohnungen. An alte und berufsunfähige Betriebsangehörige bezahlt die Firma
seit 1938 monatliche Unterstützungen über einen Sozialfonds. Anstelle des
üblichen Betriebsausfluges wurden seit 1955 die Betriebsangehörigen alle drei
Jahre turnusmäßig, kostenlos auf eine Woche in Ferien geschickt. Seit
Jahrzehnten sind zwischen 200 bis 300 Beschäftigte im Betrieb.
Am 21. Januar 1957 verstarb in Stuttgart unerwartet Hermann Neuburger* im Alter
von 86 Jahren. Sein Leben galt nur dem Unternehmen; kaufmännischer Weitblick und
technisches Verständnis haben wesentlich zu der guten Entwicklung der Fabrik
beigetragen. Die ausländische Kundschaft bereiste er bis zuletzt. Wenige Tage
vor seinem Tode löste er noch eine Schiffskarte nach Amerika. Wenn er in Salach
war, kam er täglich ins Geschäft und zeigte für alles noch reges Interesse.
Die Produktion des Werkes umfasst rohweiße und ausgerüstete Textilgewebe aus
Baumwolle und Kunstfaser für die Konfektion von Wäsche, Miedern, sowie für die
Schuh- und Lederwarenindustrie, außerdem Spezialprodukte in Kunstleder für
Schuh- und Lederwaren und für die Automobilindustrie.
Die Fabrikate in Textilien und Kunstleder erfreuen sich seit Jahren guter
Nachfrage im In- und Ausland bei einer Kundschaft, die hohe Ansprüche an die
Qualität stellt. Der Export nach europäischen Ländern und nach Übersee wird von
der Firma seit Jahrzehnten besonders gepflegt."
Zur Geschichte der Firma (mit ergänzender Geschichte 1960 bis 1970 (in
"700 Jahre Salach 1275-1975 s.Lit. S. 39-40): "Am 7. Juli 1869 erwarb
Max Neuburger von den Erben Borst's die Salacher Fabrik, zu der immer noch eine
Kundenmühle gehörte. Schon der Vater Max Neuburgers hatte zuvor in Ulm eine
Buntweberei betrieben. Der Betrieb in Salach wurde gründlich modernisiert, die
alten Wasserräder durch Turbinen ersetzt und neue englische und schweizerische
Webstühle aufgestellt. Die Fabrikanlage wurde in den folgenden Jahrzehnten immer
wieder erweitert: zu der Weberei kam eine Spulerei und eine Schlichterei,
schließlich noch eine Jacquardweberei. Die Firma der Familie Neuburger, - die
einzige jüdische Familie im Ort, wurde 1938 'arisiert', d.h. der Betrieb musste
verkauft werden und ging an die Firma Steiger & Deschler in Ulm-Söflingen über.
Der Familie gelang die Auswanderung nach New York. In einem gerichtlichen
Vergleich wurde die Firma 1949 den ursprünglichen Besitzern bzw. deren Erben
zurückerstattet. Besonders die Kunstlederproduktion gewann in den Jahren nach
dem zweiten Weltkrieg an Bedeutung. Durch Verkauf kam dann aber der Betrieb an
ein Zweigwerk der 'Conti AG', welche die Gesamtanlage 1970 der Gemeinde Salach
verkauft, die dadurch eine Baulandreserve im Ortskern gewann".
Zur Familiengeschichte Neuburger
(hervorgehoben sind die oben im Text genannten Personen, zu weiteren
Familienmitgliedern siehe Informationen über die Links bei geni.com oder in der
Hohenems Genealogie
http://www.hohenemsgenealogie.at/; Hinweis: die Familiengeschichte Neuburger
ist außerordentlich komplex, in der Hohenems Genealogie werden allein 396
Personen genannt!; teilweise variieren die Lebensdaten in den verschiedenen
genealogischen Datenbanken):
Isaak Heinrich (Hirsch) Neuburger ist am 14. August 1814 geboren in
Bad Buchau als Sohn von Hirsch (Naphtali)
Michael Neuburger [1772 Buchau - 1851 Buchau] und seiner Frau Helene (Hendel)
geb. Bernheimer [1781 Hohenems - 1856 Buchau]. Er war verheiratet mit Helena Chaile geb. Mayer (Maier), die am 20. Januar 1818 in
Laupheim geboren ist als Tochter von Abraham
Mayer und der Judith (Jetle) geb. Seligmann. Isaak und Helene Neuburger hatten
13 Kinder. Isaak Heinrich Neuburger starb am 4. November 1870 in Meran; seine
Frau Helena starb am 29. Dezember 1879 in Ulm.
Genealogische Informationen: zu Isaak Heinrich Neuburger (1814 Buchau
- 1870 Ulm)
https://www.geni.com/people/Isak-Isaac-Hirsch-Neuburger/6000000020023383988
und seiner Frau Helene geb. Maier (1818 Laupheim - 1897)
https://www.geni.com/people/Helene-Neuburger/6000000020024088581
Genealogische Informationen auch in der Hohenems Genealogie
http://www.hohenemsgenealogie.at/
Der älteste Sohn von Isaak und Helene Neuburger war Michael Max
Neuburger (auch Max J. Neuburger = Max, Sohn von Jsaak Neuburger),
der am 22. Oktober 1843 noch in Dietenheim geboren ist. Er war
seit 1866 (Stuttgart) verheiratet mit
Ida Jette geb. Neuburger, die am 25. Juli 1843 in
Buchau als Tochter von Raphael Hirsch
Neuburger und der Klara Giedel geb. Mayer (Meyer, Maier) geboren ist. Max und
Ida Neuburger hatten drei Kinder: Anna Hindel (geb. 1867 in Ulm, gest.
1878 in Stuttgart, Grab im israelitischen
Teil des Pragfriedhofes),
Johanna Jittele (geb. 1872 in Ulm) und Hermine (geb. 1872 in
Stuttgart, später verheiratet mit Josef Oppenheimer, gest. 1944 in Chicago
Ill./USA). Michael Max Neuburger starb am 14. Dezember 1889 in Stuttgart und
wurde im israelitischen Teil des
Pragfriedhofes beigesetzt; seine Frau Ida Jette starb am 14. Februar 1933 in
Berlin und wurde gleichfalls im
israelitischen Teil des Pragfriedhofes beigesetzt (Grabstein
kriegszerstört, Fragmente teilweise lesbar; Hahn Pragfriedhof S. 157).
Genealogische Informationen: zu Michael Max Neuburger
https://www.geni.com/people/Michael-Max-Neuburger/6000000020024769041
und seiner Frau Ida Jettel geb. Neuburger
https://www.geni.com/people/Ida-Jette-Neuburger/6000000020023628926
Genealogische Informationen auch in der Hohenems Genealogie
http://www.hohenemsgenealogie.at/.
 |
 |
Grabstein
(kriegserstört bei Bombenangriff) im
israelitischen Teil des Pragfriedhofes in Stuttgart
für Max Neuburger (1843 - 1889) und Ida Jette geb. Neuburger
(1843-1933) |
Grabstein
ebd. für Anna Neuberger
(1867-1878) |
| |
|
Grabsteine
ebd. für Raphael und Klara Neuburger,
Eltern von Ida Jette geb. Neuburger (oben)
und Max R. Neuburger (unten) |
 |
 |
 |
 |
| |
Grabstein für Raphael Neuburger (1808-1882) |
Grabstein
für Klara Neuburger geb. Maier (1815-1881) |
Der oben im Text zur Geschichte der Firma genannte Max R. Neuburger (Max
R. Neuburger = Max, Sohn von Raphael Neuburger) war ein Schwager von Michael
Max Neuburger: Max R. Neuburger ist am 9. April 1840 in
Buchau geboren als Sohn von Raphael Hirsch Neuburger
und seiner Frau Klara Giedel geb. Mayer (Meyer, Maier). Er war verheiratet mit
Emilie geb. Gieser, die am 3. März 1844 in
Walldorf geboren ist als Tochter des Handelsmannes Wolf Gieser und seiner
Frau Rosa geb. Walldorfer (aus Wiesloch, siehe Geburtsregister Walldorf
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1227205-109). Die beiden hatten
vier Kinder: Hermann (geb. 28. Juli 1870 in Stuttgart, gest. 24. Januar 1957 in
Stuttgart, beigesetzt im israelitischen Teil
des Pragfriedhofes), Emil (geb. 5. Januar 1872 in Stuttgart,
emigrierte vor 1942 über Havanna/Kuba in die USA, gest. 27. Dezember 1946 in
Manhattan, NY, Grab
https://de.findagrave.com/memorial/130430299/emil-neuburger), Fanny (geb.
5. Mai 1875 in Stuttgart, gest. 22. Februar 1960 in Stuttgart oder Salach), Anton (geb.
1. Januar 1879 in Stuttgart, gest. 1955 in New York City/USA). Max R.
Neuburger ist 1929 gestorben, seine Frau Emilie am 8. Juni 1934. Beide wurden im
israelitischen Teil des Pragfriedhofes in
Stuttgart beigesetzt (Grabstein erhalten, Hahn Pragfriedhof S. 157).
Genealogische Informationen in der Hohenems Genealogie
http://www.hohenemsgenealogie.at/
Der oben im Text zur Geschichte der Firma genannte Martin Neuburger bzw. Martin Michael Neuburger
ist am 28. Oktober 1840 in Buchau geboren als
Sohn von Samuel Hirsch Neuburger und der Mathilde Magdalena geb. Moos. Er war
verheiratet in erster Ehe mit Fanny geb. Gieser (geb. 10. Juni 1847 in
Walldorf als Tochter von Wolf Gieser und der
Rose geb. Walldörfer; gest. 1873), in zweiter Ehe mit Luise (Louise) geb. Neuburger
(Tochter von Raphael Hirsch Neuburger und Klara geb. Mayer). Martin und
Luise bekamen die Kinder Albert (geb. 1876 in Stuttgart, gefallen 1915
s.u.), Helene (geb. 1877 in Stuttgart, später verheiratet mit Albert
Marx, gest. 1955 USA), Erwin (geb. 1878 in Stuttgart, gest. 1981 USA),
Max (geb. 1880 in Stuttgart, gest. 1909, beigesetzt im
israelitischen Teil des Pragfriedhofes), Klara (geb. 1882 in
Stuttgart, bekannt als Malerin, gest. 1945 Paterson, N.Y./USA), Richard (geb. 1884 in Stuttgart,
war verheiratet mit Erna geb. ? [1884-1949]; Sohn Rolf Neuburger [geb. 1919] gest. 1952 Salach
oder Stuttgart) und Oskar (geb. 1894 in Stuttgart, gefallen 1917). Martin
Neuburger starb am 27. April 1914 in Stuttgart und wurde beigesetzt im
israelitischen Teil des Pragfriedhofes (Hahn
Pragfriedhof S. 156), seine Frau Luise starb am 14. August 1944 in New York.
- Genealogische Informationen zu Martin Michael Neuburger
https://www.geni.com/people/Martin-Neuburger/6000000025796416261
- Genealogische Informationen auch in der Hohenems Genealogie
http://www.hohenemsgenealogie.at/
Der Sohn von Martin Michael Neuburger, der spätere Bankdirektor Richard
Raphael Neuburger ist am 22. August 1884 in Stuttgart geboren. Er war
verheiratet mit Erna Alma geb. Franz, die am 13. Mai 1884 in Grumbach
Kreis Meißen/Sachsen (heute Wilsdruff, Landkreis Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge) als Tochter von Heinrich Hermann Frank, Händler in
Grumbach und seiner Frau Clara Auguste geb. Döring geboren ist. Die beiden
hatten einen Sohn Rolf (geb. 6. September 1919 in Berlin, vermisst auf
Seeüberfahrt 1938). Richard Neuburger starb am 20. Januar 1952 in
Stuttgart.
Die obigen Angaben zu Frau Erna sind nach dem Standesregister Salach, ganz andere
Angaben finden sich bei geni.com:
https://www.geni.com/people/Erna-Neuburger/6000000027323429427: demnach war
Erna eine geb. Zenner (geb. 1898 in Lichtenfels als Tochter von Friedrich Zenner
und Emma geb. ?)
Genealogische Angaben zu Richard Neuburger
https://www.geni.com/people/Richard-Neuburger/6000000027314258524
und zu Rolf Neuburger
https://www.geni.com/people/Rolf-Neuburger/6000000027323631176 (vgl.
unten die Angaben auf dem Grabstein der Familie)
In Salach lebte vermutlich seit der Niederlassung der Firma am Ort 1870 der Fabrikbuchhalter beziehungsweise Leiter der Firma in Salach David Gebhard mit seiner Frau
Rosalie (Rosa, Rose) geb. Neuburger. Möglicherweise war er bereits in Ulm in
der Firma tätig, zumal seine Heirat mit der Tochter des Firmengründer 1865 in
Ulm war.
David Gebhard (Familienname auch Gebhardt) ist am 13. oder 15.
August 1826 in Innsbruck geboren als Sohn von Isaac Gebhard (1776
Kairlinbach - 1864 Innsbruck) und der
Karoline geb. Dannhauser (s.u.). David Gebhard war von Beruf Mineraloge/"Grundentlastungsdurnist".
Über seine Heirat (1865 in Ulm) mit Rosalie
(Rose) geb. Neuburger ergab sich die Beziehung mit der Familie Neuburger.
Rosalie geb. Neuburger ist am 3. November 1842 in
Buchau geboren als Tochter von Isaak H.
Neuburger und Helene geb. Maier (siehe oben), dem Firmengründer der
Firma J.H. Neuburger. David Gebhard starb am 17. Januar 1888 und wurde im
jüdischen Friedhof Jebenhausen
beigesetzt. Seine Frau Rosalie ist am 30. März oder 30. September 1912 in Ulm
gestorben und im dortigen neuen jüdischen Friedhof
beigesetzt.
Bis 1879 lebte auch seine Mutter Karoline Gebhard geb. Dannhauser in
Salach, wo sie am 19. Juni 1879 "nach längerem Leiden" gestorben ist. Auf ihrem
Grabstein im jüdischen Friedhof in
Göppingen-Jebenhausen steht die Inschrift "Hier ruhet Frau Caroline Gebhardt
geb. Dannhauser, geb. in Innsbruck im Jahre 1791, gest. in Salach den 19. Juni
1879" (eine Traueranzeige für sie erschien in der Schwäbischen Chronik (Jahrgang
1879 S. 1134; unterzeichnet von D(avid) Gebhardt und Rosa geb. Neuburger.
Genealogische Angaben zu David Gebhard und Familie in der Hohenems Genealogie
http://www.hohenemsgenealogie.at/
Gräber in Jebenhausen nach Dokumentation
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-2398584 und
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-2940185&a=fb .
Grab von Rosalie Gebhard in Ulm
http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-2418108
Grabsteine im
jüdischen Friedhof Jebenhausen
(Quelle: Bamberger, Jüd. Friedhöfe
S. 89.127 (Gräber 116+170) |
 |
 |
 |
 |
| |
Grabstein
für Caroline Gebhardt geb. Dannhauser
(1791 Innsbruck - 1879 Salach) |
Grabstein
für David Gebhard aus Innsbruck, langjähriger
Leiter der mech. Weberei Salach (1826-1888) |
Im Ersten Weltkrieg ist gefallen: Albert Neuburger, der am 5.
April 1876 in Stuttgart geboren ist als Sohn von Martin und Luise (Louise) Neuburger
(Geburtsanzeige der Eltern in der Schwäbischen Chronik 1876 S. 731). Albert ist
vor dem Krieg im Adressbuch Stuttgart in der Jägerstraße 37 eingetragen als
Fabrikant (gemeint: des Betriebes in Salach, wo er nach Angaben oben seit 1913
Teilhaber war). Er wurde für seine Tapferkeit im Kriegseinsatz des Weltkrieges
mit dem EK II ausgezeichnet: zusammen mit dem württembergischen
Reserve-Infanterieregiment 247 war er im Kriegseinsatz im Bereich Ypern/Belgien
und fiel am 13. Mai 1915 bei den Frühjahrskämpfen 1915 um Ypern im Zusammenhang
mit der Erstürmung der Beelewaarde-Ferme (siehe
http://genwiki.genealogy.net/RIR_247). Er wurde am 18. Juli 1915 im
Israelitischen Teil des Pragfriedhofes in Stuttgart beigesetzt. Er wird genannt
in der Ehrentafel des Infanterieregimentes 247:
http://www.denkmalprojekt.org/2019/rir-247-ehrentafel.html sowie auf dem
Gefallenendenkmal des Ersten Weltkrieges beim Friedhof in Salach.
Erinnerung an den im
Ersten Weltkrieg
gefallenen Albert Neuburger
(Fotos: Hahn, links 1992) |
 |
|
| |
Grabdenkmal in der
Gefallenengedenkstätte im jüdischen Teil des Pragfriedhofes in Stuttgart
für
Albert Neuburger
vgl. Kriegerdenkmal in Salach - Foto unten |
|
Mitarbeiter bei der Kammgarnspinnerei Schachenmayr, Mann & Cie.
Für die weit über Salach hinaus bekannten Kammgarnspinnerei Schachenmayr in
Salach zeitweise auch jüdische Mitarbeiter tätig, die in der Firma in Erinnerung
geblieben sind (Auskunft durch den früheren Geschäftsführer der Firma
Schachenmayr, Herrn Karl Schmid in Salach vom 9. September 1985):
Hinweis: Zur Firmengeschichte vgl. unter anderem Artikel von Ulrike
Luthmer-Lechner in der "Südwestpresse" vom 14. September 2015: "Geschichte einer
Weltfirma..."
Link zum Artikel
Fotos siehe in einer
Seite der Datenbank Bauforschung/Restaurierung der Landesdenkmalpflege
Baden-Württemberg
Heinz Goldmann (geb. 20. Februar 1909 in Bamberg als Sohn des
Hopfenhändlers Max Goldmann und seiner Frau Paula geb. Levy): lebte mehrere
Jahre in Frankfurt und emigrierte im Jahr 1933 nach Schweden. 1934 wurde ihm die
Vertretung von Schachenmayr für Schweden übertragen. Diese Vertretung hatte er
41 Jahre inne - bis 1975. Bei seiner Verabschiedung 1975 hat er versichert, dass
er den Firmeninhabern sehr dankbar war, dass sie ihm mit der Übergabe der
Vertretung eine Existenzgrundlage nach der Emigration aus Deutschland ermöglicht
haben. Heinz Goldmann verstarb im Alter von 86 Jahren am 6. März 1995 in
Vasastaden, Solna kommun, Stockholms län (Schweden) und wurde im jüdischen
Friedhof Skondal (Södra Judiska Begravningsplatsen) in Stockholm beigesetzt.
Grab siehe
https://de.findagrave.com/memorial/91603590/heinz-goldmann#.
Ein Onkel und zwei Tanten von Heinz Goldmann - Martin Goldmann (geb. 1871 in
Bischberg), Selma Freudenberger geb. Goldmann (geb. 1873 in Bamberg) und Bertha
Wachtel geb. Goldmann (geb. 1878 in Bamberg) wurden 1942 nach der Deportation -
teils mit weiteren Angehörigen - in Treblinka ermordet. Siehe Gedenkbuch der
jüdischen Bürger Bambergs S. 122.134.381
https://d-nb.info/1058653989/34.
Auf dieser Seite des Gedenkbuches wird auch die Familie von Heinz Goldmann
- seine Eltern und Geschwister - genannt.
Grab von Heinz Goldmann in
Stockholm
(Quelle:
findagrave.com) |
 |
|
| |
Grab von Heinz Goldmann,
langjähriger Vertreter
von Schachenmayer in Schweden |
|
Ernst Alexander Goldberg (geb. 13. November 1891 in Köln-Lindenthal)
lebte bereits seit 1929 in Brüssel. Im gleichen Jahr hat er die Vertretung von
Schachenmayr übernommen und führte sie bis 1940 aus. 1940 musste er aufgrund der
damaligen NS-Gesetzgebung als Vertreter ausscheiden. Nach Beendigung des
Krieges, also nach 1945 hat er die Vertretung der Firma Schachenmayr für Belgien
wieder übernommen und im Jahre 1962 an seinen Sohn Freddy Goldberg übergeben.
Ernst Alexander Goldberg war während der Kriegszeit zeitweilig in einem Lager
festgehalten.
Sein Sohn Freddy Goldberg (geb. 9. September 1925) lebte zusammen mit
seinem Vater seit 1929 in Brüssel. Er übte noch bis in die 1980er-Jahre die
Vertretung der Firma Schachenmayr in Belgien aus.
Fotos:
Die Mechanische Weberei
Neuburger
(Foto links: Heimatkalender; rechts aus Adolf Aich S. 163) |
 |
 |
| |
Die Mechanische Weberei
Neuburger stand im Bereich des heutigen Ortszentrums
(Foto links vor 1900; Luftaufnahme Foto rechts vor 1960) |
| |
|
|
Ortsplan Salach 1957
(Quelle: A. Aich S. 179) |
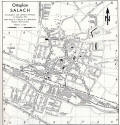 |
 |
| |
Der Plan zeigt die
Lage der Firma Neuburger zwischen Weberstraße und Hauptstraße
|
| |
|
|
Kriegerdenkmal in
Salach mit der
Eintragung von Albert Neuburger
(Foto: Alexander Gaugele) |
 |
 |
| |
|
|
Grabstein der Familie
Neuburger mit der
Eintragung des Schicksals von Rolf Neuburger
(Foto: Alexander Gaugele) |

|
| |
Inschrift des
Grabsteines:
"Der Liebe geweiht! Erna Neuburger geb. Franz geb. 13.5.1884 gest.
8.12.1959 -
Richard Neuburger geb. 22.8.1884 gest. 20.1.1952 -
Rolf Neuburger geb. 6. September 1919 untergegangen mit dem
Schulschiff Admiral Karpfanger 12. März 1938"
Hinweis: im Wikipedia-Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Admiral_Karpfanger wird Rolf Neuburger
genannt. |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Adolf Aich: Geschichte der Gemeinde Salach und der Burg
Staufeneck. Hrsg. vom Bürgermeisteramt der Gemeinde Salach. 1960. S. 162-165.191. |
 | Gemeinde Salach (Hrsg.): 700 Jahre Salach 1275-1975 (Festschrift).
Salach 1975. S. 39-40.
|
 | Joachim Hahn: Erinnerungen und Zeugnisse jüdischer
Geschichte in Baden-Württemberg. 1988 S. 198. |
 | Naftali Bar Giora Bamberger: Die Jüdischen
Friedhöfe Jebenhausen und Göppingen. Göppingen 1990. |
 | Joachim Hahn (unter Mitarbeit von Richard Klotz und Hermann Ziegler):
Pragfriedhof, israelitischer Teil. Reihe: Friedhöfe in Stuttgart Bd. 3 (bzw.
Reihe: Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Stuttgart Bd. 57). Stuttgart
1992. 268 S. ISBN 3-608-91618-0. |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|