|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
Synagogen in Bayerisch Schwaben
Steinhart (Gemeinde Hainsfarth, Landkreis
Donau-Ries)
Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Steinhart bestand eine jüdische Gemeinde bis zu ihrer Auflösung 1883. Ihre Entstehung geht in die Zeit Mitte des
16. Jahrhunderts zurück. 1560 standen unter dem Schutz des
damaligen Ortsherrn Georg Daniel von Gundolzheim sechs jüdische Familien
(persönlich wird Jud Falchle genannt). Allerdings mussten sie auf Befehl des
Grafen Ludwig - zumindest vorübergehend - den Ort verlassen. Einige Jahre
später waren wieder jüdische Familien am Ort. In den Nördlinger
Messgeleitbüchern werden von 1589 bis 1600 an Juden aus Steinhart genannt:
Josep, David, Lazarus, Isak Simon, Mossy, Liebmann, Samson, Jakob, Löw, Samuel
und Benedikt. 1625 lebten 23 jüdische Familien mit zusammen 98 Personen am Ort.
Vier dieser Familien gehörten dem Freiherr von Crailsheim, die anderen den von
Wildenstein. Um auch im benachbarten öttingischen Gebiet handeln zu können,
bezahlten die Judenschaften von Steinhard und Trendel in diesem Jahr zusammen 48
Reichsthaler an die oettingische Herrschaft. Bis 1660 ging die Zahl auf 12
Familien zurück. Neuer Zuzug erfolgt u.a. nach Ausweisung der Juden aus dem
Herzogtum Pfalz Neuburg (vgl. Monheim).
1792
gab es im Dorf 17 Judenhäuser. Anfang des 19. Jahrhunderts waren mehr
als 40 % der Bevölkerung Juden (1809/10: 149 jüdische
Einwohner = 41,2 % der Gesamteinwohnerschaft von 362 Personen). Die Familien
lebten vom Handel mit Vieh, Gütern und Landesprodukten. Einige ärmere waren
aus Hausierer unterwegs. Mehrere erlernten im 19. Jahrhundert ein Handwerk.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine
Synagoge (s.u.), eine jüdische Volksschule in dem 1844 erbauten jüdischen
Schul- und Gemeindehaus und einen Friedhof.
Der Bau des Schul- und Gemeindehauses wurde auf Grund der Stiftung eines nach England
ausgewanderten jüdischen Gemeindegliedes ermöglicht (Joel Emanuel'sche
Stiftung von 1842). Im Gebäude befand sich im Obergeschoss ein Schul- und
Versammlungsraum. Im Erdgeschoss war der Zugang zum rituellen Bad im
Untergeschoss (der Raum des rituellen Bades wurde später wegen der
Feuchtigkeit um die Hälfte verfüllt; Informationen von Gerhard Beck vom
1.3.2014).
Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Die Gemeinde wurde 1799 dem Rabbinat Oettingen
zugeteilt, was zu Differenzen mit der Kraft Crailsheim'schen
Fideicommiss-Administration führte. 1856 wurde Steinhart dem
Bezirksrabbinat Wallerstein zugeteilt.
In der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts entwickelte sich ein reiches jüdisches Gemeindeleben. Jüdische
Wohlfahrtsvereine wurden gegründet, auch gab es einen Verein zur
"Beförderung armer Jünglinge zu einem ordentlichen Handwerk". Nachdem
1861 auch die letzten
Beschränkungen des Judenedikts aus dem Jahr 1813 entfielen, wanderten immer
mehr Juden von den Dörfern weg in größere Orte (1867 89 jüdische Einwohner,
d.h. 26,6 % der Gesamteinwohnerschaft, 1880 26 jüdische Einwohner, d.h. 7,9 %
der Gesamteinwohnerschaft). Nach der Auflösung der jüdischen Gemeinde
1883 wurden die letzten hier noch lebenden jüdischen Einwohner der Gemeinde in Oettingen
zugeteilt.
Von den in Steinhart geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Auguste Buckmann (1882),
Joseph Buckmann (1880), Hedwig Gutmann geb. Steiner (1874), David Heymann
(1868), Rosalie Lehmann geb. Buckmann (1875), Karoline Oberdorfer geb. Steiner
(1864), Heinrich Steiner (1861), Moritz Steiner (1868).
Eine ausführliche Schilderung des jüdischen Lebens in
Steinhart findet sich in den Lebenserinnerungen von Heinrich Heymann: Eine
Jugend in Steinhart und Oettingen. Siehe bei G. Römer: Schwäbische Juden S.
37-51. Heymanns Vorfahren lebten schon Jahrhunderte in Steinhart.
Eine genealogische Übersicht zur Familie Heymann (Ahnentafel
Jenny Heymann, Nachkommen des Salomon, geb. um 1715 in Steinhart) haben Mouna
El Kassemi, Stefanie Jurk, Vitushan A. und Cornelia Egger (stud. PH Ludwigsburg)
im Zusammenhang mit einer Ausstellung
zu Jenny Heymann in Ludwigsburg Januar 2018 erstellt.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule
Über die Schenkung der Schule (1842)
Anmerkung: es geht um die 1842 getätigte Joel Emanuel'sche Stiftung des
Schul- und Gemeindehauses.
 Bericht in der Allgemeinen Zeitung des
Judentums vom 21. Mai 1842: "Ein Kaufmann in London hat den Ort seiner
Heimat, Steinhart, königlich bayerisches Landgericht Heidenheim, nach
langjähriger Abwesenheit wieder besucht, der israelitischen Gemeinde aber auch
ein bleibendes Andenken seines Besuches hinterlassen, indem er ihr auf seine
Kosten ein ganz neues Schulhaus erbauen lässt. die Bausumme soll 4.000 Gulden
übersteigen, dieses aber nicht die einzige edle Handlung sein, welche den
Bewohnern Steinharts diesen Besuch ewig unvergesslich machen wird". Bericht in der Allgemeinen Zeitung des
Judentums vom 21. Mai 1842: "Ein Kaufmann in London hat den Ort seiner
Heimat, Steinhart, königlich bayerisches Landgericht Heidenheim, nach
langjähriger Abwesenheit wieder besucht, der israelitischen Gemeinde aber auch
ein bleibendes Andenken seines Besuches hinterlassen, indem er ihr auf seine
Kosten ein ganz neues Schulhaus erbauen lässt. die Bausumme soll 4.000 Gulden
übersteigen, dieses aber nicht die einzige edle Handlung sein, welche den
Bewohnern Steinharts diesen Besuch ewig unvergesslich machen wird". |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der Gemeinde
Über Rabbiner Joseph Ben-Menahem Steinhart bzw. Josef ben
Menachem Mendel aus Steinhart (um 1700 in Steinhart - 1776 in Fürth)
Joseph Ben-Menhem Steinhart (um 1700 in Steinhart -
1776 in Fürth): Rabbiner, zunächst in Rixheim, danach Oberrabbiner des
Unter-Elsass, 1755 Oberrabbiner von Niederehnheim, Unterelsass, seit 1763
Rabbiner in Fürth. Großer Talmudist. Verfasste das Buch Sichron Josef
(erschien Fürth 1773). Vgl. Seite bei Steinhardt's
Familybook.
Weiterer ausführlicher
Beitrag zu Josef Steinhart in: Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen
Gesellschaft VI 5669 1909 S. 190-203 (eingestellt als pdf-Datei). |
| |
 Artikel in der Zeitschrift "Der Orient"
vom 16. April 1847:
Artikel in der Zeitschrift "Der Orient"
vom 16. April 1847:
Der Artikel konnte noch nicht abgeschrieben werden - zum Lesen bitte
Textabbildungen anklicken. |
 |
 |
Zum Tod des Handelsmannes Samuel Gutmann
(1879)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Juli 1879: "Kleinerdlingen.
Am 29. März laufenden Jahres verschied zu Steinhard der Handelsmann
Samuel Gutmann. Der Verlebte, der sich immer in dürftigen Verhältnissen
befang, ernährte sich vom Hausieren mit Siegellack, Postpapier und dergleichen.
Es dürfte wohl kein Ort in Bayern sein, in dem er nciht bekannt war. Wie
war man daher erstaunt, als sich bei Eröffnung des Testaments folgende
Legate vorfanden: Für die israelitische Waisenanstalt, Fürth 1100
Mark Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Juli 1879: "Kleinerdlingen.
Am 29. März laufenden Jahres verschied zu Steinhard der Handelsmann
Samuel Gutmann. Der Verlebte, der sich immer in dürftigen Verhältnissen
befang, ernährte sich vom Hausieren mit Siegellack, Postpapier und dergleichen.
Es dürfte wohl kein Ort in Bayern sein, in dem er nciht bekannt war. Wie
war man daher erstaunt, als sich bei Eröffnung des Testaments folgende
Legate vorfanden: Für die israelitische Waisenanstalt, Fürth 1100
Mark
Für den Begräbnisplatz Steinhard zur Erhaltung der Umzäunung 200
Mark
Für die jüdische Lehrerbildungsanstalt, Würzburg 200 Mark
Für die Armen Palästinas 860 Mark. Ferner war in dem
Testamente eine Summe ausgesetzt zur Verteilung bei der Beerdigung an Arme
ohne Unterschied der Konfession in Steinhard, Hainsfarth
und Oettingen.
Mit der Abwickelung der Verlassenschaft war ein Urenkel des Rabbi Josef
Steinhard - das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen - Herr
Josef Obermeier von Steinhard, betraut, der mit großem Aufwand von Zeit
und Mühe das hauptsächlich in Waren bestehende Vermögen schon bei
Lebzeiten des Verstorbenen zu Geld machte. Herr Obermeier gebührt auch
das Verdienst der Abfassung des Testaments." |
Berichte über Jakob Obermeyer
Jakob Obermeyer (1845 in Steinhart - 1935):
Orientforscher, reiste 1868 von Marokko über Ägypten nach Palästina und
weiter nach Damaskus und Bagdad; wurde
1869 Lehrer an einer Schule der Alliance Israélite Universelle in Bagdad und
1872-1881 Erzieher des aus seiner Heimat geflohenen persischen
Thronanwärters, den er 1881 nach Persien zurück begleitet. 1884 wurde er Lehrer der arabischen
und persischen Sprache und Literatur in Wien. Sein bedeutendstes Werk ist "Die Landschaft
Babyloniens im Zeitalter des Talmuds und des Gaonats" (1929).
Zum 90. Geburtstag von Jacob Obermeyer
(1935)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März 1935: "Professor
Jacob Obermeyer 90 Jahre alt. Hamburg, 26. März. Am 21. März wurde
Prof. Jacob Obermeyer in Würzburg 90 Jahre alt. Der Jubilar ist eine
interessante Persönlichkeit unter den jüdischen Gelehrten. Im Jahre 1845
in Steinhardt im bayerischen Mittelfranken geboren, hat Jacob Obermeyer im
Milieu, das früher Männer wie Chacham R. Jacob Bernajs, Rabbi Jacob
Ettlingen und später den 'alten Würzburger Raw' Rabbi Seligmann Beer
Bamberger hervorgebracht hat, seine geistige Formung erhalten. Er hat sich
schon in der Jugend gründliche talmudische Kenntnisse angeeignet. Schon
in frühester Jugend hat sich bei ihm ein besonderes Interesse gezeigt,
das jüdische Leben im Orient kennen zu lernen. Er bereiste im Jahre 1868
Nordafrika von Marokko bis Ägypten, durchquerte ganz Palästina und einen
Teil Syriens bis nach Damaskus. Im Jahre 1869 wurde er als Lehrer an eine
Schule der Alliance Israélit Universelle nach Bagdad berufen. Nach drei
Jahren übernahm er dann die Stelle eines Lehrers und Erziehers im Hause
des in Bagdad im Exil lebenden persischen Kronprätendenten Naib
as-Saltana, einer Bruder Nasir-ad-dins, des Schahs von
Persien. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März 1935: "Professor
Jacob Obermeyer 90 Jahre alt. Hamburg, 26. März. Am 21. März wurde
Prof. Jacob Obermeyer in Würzburg 90 Jahre alt. Der Jubilar ist eine
interessante Persönlichkeit unter den jüdischen Gelehrten. Im Jahre 1845
in Steinhardt im bayerischen Mittelfranken geboren, hat Jacob Obermeyer im
Milieu, das früher Männer wie Chacham R. Jacob Bernajs, Rabbi Jacob
Ettlingen und später den 'alten Würzburger Raw' Rabbi Seligmann Beer
Bamberger hervorgebracht hat, seine geistige Formung erhalten. Er hat sich
schon in der Jugend gründliche talmudische Kenntnisse angeeignet. Schon
in frühester Jugend hat sich bei ihm ein besonderes Interesse gezeigt,
das jüdische Leben im Orient kennen zu lernen. Er bereiste im Jahre 1868
Nordafrika von Marokko bis Ägypten, durchquerte ganz Palästina und einen
Teil Syriens bis nach Damaskus. Im Jahre 1869 wurde er als Lehrer an eine
Schule der Alliance Israélit Universelle nach Bagdad berufen. Nach drei
Jahren übernahm er dann die Stelle eines Lehrers und Erziehers im Hause
des in Bagdad im Exil lebenden persischen Kronprätendenten Naib
as-Saltana, einer Bruder Nasir-ad-dins, des Schahs von
Persien.
Im Winter des Jahres 1875/76 wählte der persische Prinz Abbas Mirza, der,
wie alle Angehörigen der persischen Fürstengeschlechter, ein
leidenschaftlicher Jäger war, auf Veranlassung von Obermeyer als
Jagdrevier das Gebiet zwischen dem Euphrat und Tigris, wo es diese
Zwillingsströme in ihrem mittleren Lauf am nächsten zueinander bringt,
das Gebiet der ehemaligen jüdisch-babylonischen Hauptansiedlung von
Beginn des babylonischen Exils, die Heimat des babylonischen Talmuds und
der gaonäischen Akademien. Wie Obermeyer selbst berichtet, war ihm die
Jagd an sich völlig gleichgültig. Nicht auf Gazellen, Rebhühner und die
verschiedenen Wasservögel |
 war
sein spähendes Auge gerichtet, er ließ keinen Jagdfalken aufsteigen, um
einer geängstigten Rebhühnerkette oder um flüchtenden Gazellen
nachzujagen, sein Hund lief ruhig neben ihm her und seine Flinte hing
unbenutzt über seinem Rücken. Ihm war doch die Hauptsache bei dieser
Reise, seinen Blick zu werfen auf die Zeit der Abfassung des babylonischen
Talmuds und auf die Stätten, wo die babylonischen Amoräer ihre
Lehrtätigkeit entfalteten. Sein Auge spähte in der gegenwärtig
größtenteils verlassenen Steppe nach jedem Ruinenhügel, nach jedem
längst vertrockneten Kanallauf, und er grübelte, ob wohl dieser oder
jener Ruinenhügel oder Kanallauf, nach seiner örtlichen Lage zu
schließen, mit dem einen oder anderen im Talmud erwähnten Ort oder Kanal
identisch sein möge. Nach seiner Rückkehr veröffentlichte er im Sommer
1876 in der hebräischen Wochenschrift 'Ha-Maggid' eine Reihe von Artikeln
unter dem Titel 'Meine Reise nach den Ruinen Babylons'. Von jener Zeit bis
zu seiner endgültigen Rückkehr nach Europa 1884 hat Obermeyer öfters
die Gelegenheit ausgenutzt, noch weiter die Landschaft zwischen dem
Euphrat und Tigris zu durchreisen und zu durchforschen und seine
Kenntnisse über die Heimat des babylonischen Talmuds erschöpfend zu
erweitern. Als der Prinz Abbas-Mirza-Naib-assaltanah, der sich in der
Zwischenzeit mit seinem Bruder versöhnte hatte, im Jahre 1881 nach
Persien zurückkehrte, begleitete ihn Obermeyer zuerst nach Kaswin und
später nach Teheran, wo er die Stelle des Lehrers im Hause des persischen
Prinzen beibehielt. Im Jahre 1884 erhielt er eine Berufung nach Wien als
Lehrer der arabischen und persischen Sprache und Literatur an der K.K.
Lehranstalt für orientalische Sprachen, wo er bis 1915 tätig war. Im
Jahre 1907 erschien das bekannte Werk von Obermeyer 'Modernes Judentum im
Morgen- und Abendland' (Wien und Leipzig). Dieses interessante Werk
behandelt mit großer Sachkenntnis viele aktuellen Probleme des jüdischen
Lebens und ist durchdrungen von einer besonderen Liebe des Verfassers zum
toratreuen Judentum, im Geiste dessen Obermeyer sein ganzes Leben geführt
hat. Im Jahre 1929 hat Obermeyer sein Lebenswerk 'Die Landschaft
Babyloniens im Zeitalter des Talmuds und des Gaonats' (Geographie und
Geschichte nach talmudischen, arabischen und anderen Quellen)
veröffentlicht. Dieses Werk ist eine reiche und unentbehrliche Quelle
für jeden Forscher auf dem Gebiete der Geographie des babylonischen Talmuds
und unterscheidet sich den den Arbeiten seiner Vorgänger auf diesem
Gebiet, da er außer den bisher benutzten Schriftstellern des Altertums
sich auch auf die arabischen Geographen und Historiker stützt, und
Obermeyer nicht zuletzt seine eigene Anschauung über alle Stätten und
Flecken Babyloniens zugute kommt. Es ist interessant zu bemerken, dass der
Verfasser bei Erscheinen dieses Buches bereits 84 Jahre alt war und selbst
die Korrektur gelesen hat. Das Buch ist aber in so bewundernswerter
Lebendigkeit geschrieben, dass man kaum das hohe Alter des Verfassers
merken kann. Jetzt lebt Professor Obermeyer im Israelitischen Altersheim
in Würzburg, wo er sich noch lange Jahre seiner wohl verdienten Ruhe und
geistigen Frische erfreuen möge. Prof. Dr. Isaac Markon.
Hamburg." war
sein spähendes Auge gerichtet, er ließ keinen Jagdfalken aufsteigen, um
einer geängstigten Rebhühnerkette oder um flüchtenden Gazellen
nachzujagen, sein Hund lief ruhig neben ihm her und seine Flinte hing
unbenutzt über seinem Rücken. Ihm war doch die Hauptsache bei dieser
Reise, seinen Blick zu werfen auf die Zeit der Abfassung des babylonischen
Talmuds und auf die Stätten, wo die babylonischen Amoräer ihre
Lehrtätigkeit entfalteten. Sein Auge spähte in der gegenwärtig
größtenteils verlassenen Steppe nach jedem Ruinenhügel, nach jedem
längst vertrockneten Kanallauf, und er grübelte, ob wohl dieser oder
jener Ruinenhügel oder Kanallauf, nach seiner örtlichen Lage zu
schließen, mit dem einen oder anderen im Talmud erwähnten Ort oder Kanal
identisch sein möge. Nach seiner Rückkehr veröffentlichte er im Sommer
1876 in der hebräischen Wochenschrift 'Ha-Maggid' eine Reihe von Artikeln
unter dem Titel 'Meine Reise nach den Ruinen Babylons'. Von jener Zeit bis
zu seiner endgültigen Rückkehr nach Europa 1884 hat Obermeyer öfters
die Gelegenheit ausgenutzt, noch weiter die Landschaft zwischen dem
Euphrat und Tigris zu durchreisen und zu durchforschen und seine
Kenntnisse über die Heimat des babylonischen Talmuds erschöpfend zu
erweitern. Als der Prinz Abbas-Mirza-Naib-assaltanah, der sich in der
Zwischenzeit mit seinem Bruder versöhnte hatte, im Jahre 1881 nach
Persien zurückkehrte, begleitete ihn Obermeyer zuerst nach Kaswin und
später nach Teheran, wo er die Stelle des Lehrers im Hause des persischen
Prinzen beibehielt. Im Jahre 1884 erhielt er eine Berufung nach Wien als
Lehrer der arabischen und persischen Sprache und Literatur an der K.K.
Lehranstalt für orientalische Sprachen, wo er bis 1915 tätig war. Im
Jahre 1907 erschien das bekannte Werk von Obermeyer 'Modernes Judentum im
Morgen- und Abendland' (Wien und Leipzig). Dieses interessante Werk
behandelt mit großer Sachkenntnis viele aktuellen Probleme des jüdischen
Lebens und ist durchdrungen von einer besonderen Liebe des Verfassers zum
toratreuen Judentum, im Geiste dessen Obermeyer sein ganzes Leben geführt
hat. Im Jahre 1929 hat Obermeyer sein Lebenswerk 'Die Landschaft
Babyloniens im Zeitalter des Talmuds und des Gaonats' (Geographie und
Geschichte nach talmudischen, arabischen und anderen Quellen)
veröffentlicht. Dieses Werk ist eine reiche und unentbehrliche Quelle
für jeden Forscher auf dem Gebiete der Geographie des babylonischen Talmuds
und unterscheidet sich den den Arbeiten seiner Vorgänger auf diesem
Gebiet, da er außer den bisher benutzten Schriftstellern des Altertums
sich auch auf die arabischen Geographen und Historiker stützt, und
Obermeyer nicht zuletzt seine eigene Anschauung über alle Stätten und
Flecken Babyloniens zugute kommt. Es ist interessant zu bemerken, dass der
Verfasser bei Erscheinen dieses Buches bereits 84 Jahre alt war und selbst
die Korrektur gelesen hat. Das Buch ist aber in so bewundernswerter
Lebendigkeit geschrieben, dass man kaum das hohe Alter des Verfassers
merken kann. Jetzt lebt Professor Obermeyer im Israelitischen Altersheim
in Würzburg, wo er sich noch lange Jahre seiner wohl verdienten Ruhe und
geistigen Frische erfreuen möge. Prof. Dr. Isaac Markon.
Hamburg." |
Zum Tod von Prof. Jacob Obermeyer (1937)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar 1938: "Prof.
Jacob Obermeyer - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - Würzburg,
17. Januar (1938). In der Nacht von Freitag auf Sabbat, den 28. Tebet
(Nacht vom 31. Dezember 1937 auf 1. Januar 1938), verschied in Würzburg
Prof. Jacob Obermeyer im hohen Greisenalter von 92 Jahren. Man macht sich
wohl keiner Übertreibung schuldig, wenn man behauptet, dass mit diesem
Leben eines der merkwürdigsten und interessantesten Schicksal unter Juden
neuerer Zeit sein Ende gefunden hat. Jacob Obermeyer wurde im Jahre 1845
im mittelfränkischen Dörfchen Steinhart geboren und genoss bereits in
früher Jugend eine gründliche talmudische Ausbildung. Dieses 'Lernen'
der Jugendzeit sollte für Obermeyer zum entscheidenden Erlebnis werden,
das für ihn weiterhin bis an sein Ende schicksalhaft geblieben ist. Seine
Jugend fiel in eine Zeit, die durch das Aufblühen der modernen jüdischen
Wissenschaft weiten Kreisen des deutschen Judentums neue Impulse zu geben
versprach. Als Obermeyer jung war, schrieben Zunz, Grätz und
Steinschneider ihre bekannten Werke. Von dem Forschungsdrang seiner Zeit
wurde auch er ergriffen, und doch in so ganz anderer Weise, als es unter
deutsch-jüdischen Gelehrten damals üblich war. Seine Leidenschaft,
Geschichte und Gegenwart des Judentums zu erforschen, zwang ihn nicht
hinter den Schreibtisch, sondern hinaus in fremde Länder und Erdteile.
Besonders der jüdische Orient interessiert ihn. Er durchstreifte die
ganze Nordküste Afrikas, besuchte Ägypten, Palästina, Syrien und wurde
schließlich im Jahre 1869 Lehrer an einer Alliance-Schule in Bagdad.
Angehörige des persischen Herrscherhauses, die in Bagdad im Exil lebten,
wurden auf ihn aufmerksam, und so wurde Obermeyer für längere Zeit -
Romantik aus 1001 Nacht; - Erzieher eines persischen Prinzen. Jetzt
begannen seine eigentlichen Forscherjahre; sein Amt ließ ihm noch genug
Muße übrig für ernste wissenschaftliche Tätigkeit. Er studierte
arabisch, persisch und die klassischen Sprachen des europäischen
Altertums, bis er sich eine profunde Kenntnis dieser Literaturen
angeeignet hatte. So ausgerüstet, konnte er nun an sein Lebenswerk
herangehen. Es führte ihn zurück zu den talmudischen Studien seiner
jungen Jahre und verfolgte kein geringeres Ziel, als die Erforschung Mesopotamiens,
der alten Heimat des babylonischen Talmuds und des Gaonats, um so den
Buchstaben des Gelernten das Leben der unmittelbaren Anschauung
einzuhauchen. Eine Geographie des Talmuds sollte sein Buch sein. Es
erschien - allerdings erst im Jahre 1929 - unter dem Titel: 'Die
Landschaft Babyloniens im Zeitalter des Talmuds und des Gaonats'. 'Dort
unten in Mesopotamien', schreibt Obermeyer an anderer Stelle, 'am Rande
der großen arabischen Wüste, an den Ufern des Euphrat und Tigris habe
ich aus dem Born der arabischen Klassiker meine Bildung geschöpft und an
den Bächen Babyloniens, an dem Urquell des Talmud, meinen Durst nach der
Lehre gelöscht.' Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar 1938: "Prof.
Jacob Obermeyer - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - Würzburg,
17. Januar (1938). In der Nacht von Freitag auf Sabbat, den 28. Tebet
(Nacht vom 31. Dezember 1937 auf 1. Januar 1938), verschied in Würzburg
Prof. Jacob Obermeyer im hohen Greisenalter von 92 Jahren. Man macht sich
wohl keiner Übertreibung schuldig, wenn man behauptet, dass mit diesem
Leben eines der merkwürdigsten und interessantesten Schicksal unter Juden
neuerer Zeit sein Ende gefunden hat. Jacob Obermeyer wurde im Jahre 1845
im mittelfränkischen Dörfchen Steinhart geboren und genoss bereits in
früher Jugend eine gründliche talmudische Ausbildung. Dieses 'Lernen'
der Jugendzeit sollte für Obermeyer zum entscheidenden Erlebnis werden,
das für ihn weiterhin bis an sein Ende schicksalhaft geblieben ist. Seine
Jugend fiel in eine Zeit, die durch das Aufblühen der modernen jüdischen
Wissenschaft weiten Kreisen des deutschen Judentums neue Impulse zu geben
versprach. Als Obermeyer jung war, schrieben Zunz, Grätz und
Steinschneider ihre bekannten Werke. Von dem Forschungsdrang seiner Zeit
wurde auch er ergriffen, und doch in so ganz anderer Weise, als es unter
deutsch-jüdischen Gelehrten damals üblich war. Seine Leidenschaft,
Geschichte und Gegenwart des Judentums zu erforschen, zwang ihn nicht
hinter den Schreibtisch, sondern hinaus in fremde Länder und Erdteile.
Besonders der jüdische Orient interessiert ihn. Er durchstreifte die
ganze Nordküste Afrikas, besuchte Ägypten, Palästina, Syrien und wurde
schließlich im Jahre 1869 Lehrer an einer Alliance-Schule in Bagdad.
Angehörige des persischen Herrscherhauses, die in Bagdad im Exil lebten,
wurden auf ihn aufmerksam, und so wurde Obermeyer für längere Zeit -
Romantik aus 1001 Nacht; - Erzieher eines persischen Prinzen. Jetzt
begannen seine eigentlichen Forscherjahre; sein Amt ließ ihm noch genug
Muße übrig für ernste wissenschaftliche Tätigkeit. Er studierte
arabisch, persisch und die klassischen Sprachen des europäischen
Altertums, bis er sich eine profunde Kenntnis dieser Literaturen
angeeignet hatte. So ausgerüstet, konnte er nun an sein Lebenswerk
herangehen. Es führte ihn zurück zu den talmudischen Studien seiner
jungen Jahre und verfolgte kein geringeres Ziel, als die Erforschung Mesopotamiens,
der alten Heimat des babylonischen Talmuds und des Gaonats, um so den
Buchstaben des Gelernten das Leben der unmittelbaren Anschauung
einzuhauchen. Eine Geographie des Talmuds sollte sein Buch sein. Es
erschien - allerdings erst im Jahre 1929 - unter dem Titel: 'Die
Landschaft Babyloniens im Zeitalter des Talmuds und des Gaonats'. 'Dort
unten in Mesopotamien', schreibt Obermeyer an anderer Stelle, 'am Rande
der großen arabischen Wüste, an den Ufern des Euphrat und Tigris habe
ich aus dem Born der arabischen Klassiker meine Bildung geschöpft und an
den Bächen Babyloniens, an dem Urquell des Talmud, meinen Durst nach der
Lehre gelöscht.'
Nach dreijährigem Aufenthalt in Persien erhielt er im Jahre 1884 einen
ehrenvollen Ruf nach Wien als Dozent für arabische und persische Sprache
und Literatur an der k.k. Lehranstalt für orientalische Sprachen. Über
drei volle Jahrzehnte bekleidete er dieses Amt. In dieser Zeit schrieb er
u.a. ein Buch über 'Modernes Judentum im Morgen- und Abendland' (Wien und
Leipzig 1907), in dem er uns zeigt, mit welchem Forscherblick für alles,
was jüdisch war, er seine Weltreisen unternommen hat. Mit schonungsloser
Wahrheitsliebe werden hier alle jüdischen Erscheinungen, besonders
diejenigen des westeuropäischen Judentums, in ihrer Echtheit gemessen an
der alten, unverfälschten, legitimen Tradition, und an nicht wenigen
Stellen seines Buches reißt er dem als hohl und unlauter erkannten
Reformjudentums seinerzeit die Maske ab. Von 1920 bis 1931 lebte Obermeyer
in Berlin, im Jahre 1931 übersiedelte er ins hiesige Altersheim.
Seit dieser Zeit kannten wir Würzburger Professor Obermeyer und wenn er
jetzt in die Ewigkeit abberufen wurde, so mögen Judentum und Judenheit in
der weiten Welt den Tod des bedeutenden Gelehrten beklagen, wir in
Würzburg trauern außerdem noch um den Menschen Jacob Obermeyer. Nicht
etwa, dass er hier in Würzburg abseits von der wissenschaftlichen Welt
ein 'Privatleben' geführt hätte, er hätte vielleicht als 90er das Recht
dazu gehabt. Nein, wie alle, die das Glück hatten, mit Jacob Obermeyer in
seinen letzten Jahren öfters zusammen zu sein, konnten an dieser
ehrwürdigen Greisengestalt so recht einmal sehen, wie echtes Gelehrtentum
seinen Träger innerlich und äußerlich zu einem Menschen zu formen und
zu prägen vermag. Das, was an der Gestalt Obermeyers auf alle, die ihm
nahe standen, besonders aber auf junge Menschen, so faszinierend wirkte,
war eine absolute und doch so demütige Wahrheitsliebe. Allen
Erscheinungen gegenüber, ein unzerstörbarer Lebensoptimismus und vor
allem eine tiefe Liebe zum Judentum und zum jüdischen Volk. Und dadurch
war sein Wesen zu einer Lehrer- und Erzieherpersönlichkeit geformt, die
er bis zu seinem letzten Atemzug geblieben ist und deren Eindruck sich
schlechterdings Niemand |
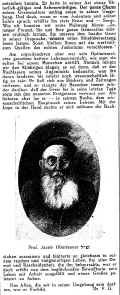 entziehen konnte. Er hatte in seiner Art etwas Väterlich-gütiges und
liebenswürdiges. Der ganze Charm seines Greisenalters umfing einen in
seiner Umgebung. Und doch, wenn er vom Judentum und seiner Lehre sprach,
erfüllte ihn stets Ernst und - Sorge. Wie oft konnten wir seine Mahnung
hören: 'Ja, junger Freund, Sie und Ihre ganze Generation müssen arabisch
lernen, Sie müssen den Saadja Gaon in seiner Ursprache, müssen seine Bibelübersetzung
lernen. Sonst bleiben Ihnen mit die wertvollsten Quellen des echten
Judentums verschlossen.'
entziehen konnte. Er hatte in seiner Art etwas Väterlich-gütiges und
liebenswürdiges. Der ganze Charm seines Greisenalters umfing einen in
seiner Umgebung. Und doch, wenn er vom Judentum und seiner Lehre sprach,
erfüllte ihn stets Ernst und - Sorge. Wie oft konnten wir seine Mahnung
hören: 'Ja, junger Freund, Sie und Ihre ganze Generation müssen arabisch
lernen, Sie müssen den Saadja Gaon in seiner Ursprache, müssen seine Bibelübersetzung
lernen. Sonst bleiben Ihnen mit die wertvollsten Quellen des echten
Judentums verschlossen.'
Am ergreifendsten aber war sein Optimismus, eine geradezu heitere
Lebenszuversicht, wie man sie selten bei einem Menschen antrifft. Niemals
hörten wir den 92-jährigen klagen, es sei denn, dass er das Nachlassen
seines Augenlichts bedauerte, was ihn daran hinderte, bis zuletzt noch
wissenschaftlich tätig zu sein. Er ließ sich aus Büchern und Zeitungen
vorlegen, und so staunte der Besucher immer wieder darüber, dass der
Greis bis in seine letzten Tage stets mit den neuesten Ereignissen
vertraut war. Am liebsten aber las er - in seinem Buche, dem
wissenschaftlichen Hauptwerk seines Lebens. Mit der Lupe in der Hand
suchte er sich mühsam die Buchstaben zusammen und blätterte so gleichsam
in seinem reichen und vielgestaltigen Leben. Bei aller Demut und
Bescheidenheit, die ihn beherrschte, war er doch erfüllt von dem
beglückenden Bewusstsein, sein Leben mit Arbeit ausgefüllt und etwas
Großes geleistet zu haben. Uns Allen, die wir in seiner Umgebung sein durften,
war er Vorbild. Dr. F.G." |
| |
Weiterer Artikel zum Tod von Jacob Obermeyer
von Prof. Dr. Isaak Markon
in der "Central-Verein-Zeitung" vom 13. Januar 1938: "Jacob Obermeyer..."
Der Verfasser des Nachrufes Isaak Dov Ber Markon (1875-1949) war ein
russischer Bibliothekar, Orientalist und Pädagoge, siehe Wikipedia-Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Isaak_Dov_Ber_Markon
|
 |
 |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
N. Heymann zieht nach Oettingen (1861)
Anmerkung: es handelt sich um
Nathan Heymann (geb. 1811 in Steinhart als Sohn von Moses Heymann und Gietel
geb. Höchstädter). Dieser war seit 1843 verheiratet von Jeanette geb.
Schülein aus Bechhofen. Nathan Heymann
starb am 15. Februar 1887 in Oettingen, seine Frau am 18. August 1890 ebd.
Weiteres auf Familienblatt
von R. Hofmann.
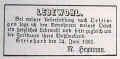 Anzeige
aus dem "Oettingischen Wochenblatt" vom
Juni 1861 (aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries): "Lebewohl.
Bei meiner Übersiedlung nach Oettingen sage ich den Bewohnern meines
Ortes ein herzliches Lebewohl und bitte zugleich um die Fortdauer ihres
Wohlwollens. Anzeige
aus dem "Oettingischen Wochenblatt" vom
Juni 1861 (aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries): "Lebewohl.
Bei meiner Übersiedlung nach Oettingen sage ich den Bewohnern meines
Ortes ein herzliches Lebewohl und bitte zugleich um die Fortdauer ihres
Wohlwollens.
Steinhard, den 24. Juni 1861. N. Heymann." |
Weitere Dokumente
Postkarte
an Hermann Weil,
Maschinenfabrik in Augsburg-Pfersee (1923)
von Hedwig Gutmann geb. Steiner (geb. in
Steinhart) |
 |
 |
|
Der Adressat Hermann Weil (geb. 1893 in
Buchau) war mit seinem Bruder Siegfried
Teilhaber der "Motoren- und Maschinenfabrik Augsburg-Pfersee. Hermann Weil und seine Tochter
Edith Weil (Information
über Link) flohen 1938 in die Niederlande. Im Dezember 1943 oder Januar 1944
wurden beide von Amsterdam nach Auschwitz deportiert, wo sie am 28.Januar 1944 ermordet
wurden. Vgl. über Link: Die
Geschichte der Familie Siegfried Weil, Augsburg.
Die Karte selbst ist an die Frau von Hermann Weil geschrieben: Selma
Weil geb. Oberdorfer (geb. 1893 in Hainsfarth). Selma
Weil blieb 1938 in Augsburg bei ihrer Mutter. Ihre Adresse war 1939 die Halderstrasse 6, direkt
neben der Synagoge. In der Liste der ermordeten Juden Augsburgs findet sich der
3. September 1943 als eingetragener Deportationstag. Der Name ihrer bei Ihr lebenden Mutter
Karoline Oberdorfer geb. Steiner (geb. in Steinhart) findet sich ebenfalls in der Liste der ermordeten
Juden Augsburgs mit dem eingetragenen Deportationstag 30. August 1942.
Die Absenderin der Karte ist Hedwig Gutmann geb. Steiner
(geb. 1874 in Steinhart). Sie war eine jüngere Schwester von Selmas Mutter und somit Selmas Tante. Auch
die Namen von Hedwig Gutmanns und Karoline Oberdorfer geb. Steiner finden
sich in den Listen der Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland (siehe oben).
Link zu den "Jewish Birth
Records of Steinhart" von Rolf
Hofmann. |
Zur Geschichte der Synagoge
Eine Synagoge
beziehungsweise einen Betsaal gab es sicher bereits im 18. Jahrhundert. Im
Zusammenhang mit den allgemeinen Reformbemühungen seit den 1830er-Jahren wurden
auch in Steinhart gottesdienstliche Reformen durchgeführt. Ein Synagogenchor
(nach orthodoxer Tradition jedoch nur mit Männerstimmen) wurde gegründet. Die
Synagoge wurde 1839 umfassend renoviert und am 6. September 1839
neu eingeweiht. Über die damaligen Veränderungen im Gemeindeleben erschien in
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" (Ausgabe vom 17. Oktober 1840)
erschien folgender Artikel:
 Steinhart (Mittelfranken, Anm. damals noch Steinhard,
die Gemeinde wechselte erst vor wenigen Jahrzehnten mit der Auflösung des
Landkreises Gunzenhausen von Mittelfranken nach Schwaben). In Nummer 27
Ihres sehr geschätzten Blattes findet sich Seite 391 eine Notiz über
Synagogen-Reform in der Gemeinde Dittenheim, bei welcher Gelegenheit von den
Nachbargemeinden auf eine wegwerfende Weise abgesprochen wird, dies veranlasst
mich, folgende Zeilen zur Berichtigung jenes Artikels einzusenden. Steinhart (Mittelfranken, Anm. damals noch Steinhard,
die Gemeinde wechselte erst vor wenigen Jahrzehnten mit der Auflösung des
Landkreises Gunzenhausen von Mittelfranken nach Schwaben). In Nummer 27
Ihres sehr geschätzten Blattes findet sich Seite 391 eine Notiz über
Synagogen-Reform in der Gemeinde Dittenheim, bei welcher Gelegenheit von den
Nachbargemeinden auf eine wegwerfende Weise abgesprochen wird, dies veranlasst
mich, folgende Zeilen zur Berichtigung jenes Artikels einzusenden.
Wenn ich auch weit entfernt bin, die zum Lobe jener Gemeinde angeführten
Tatsachen in Abrede stellen zu wollen, so kann ich doch, ohne unbescheiden zu
sein, sagen, dass nicht minder auch in hiesiger Gemeinde, seit einer geraumen
Zeit, ein reger Eifer für alles Gute und Zeitgemäße, auf eine für jeden
Menschenfreund höchst erfreuliche Weise sich kund gegeben hat. So sind hier
zwei Vereine ins Leben getreten, die sich Unterstützung der Armen und Kranken
und Beförderung armer Jünglinge zu einem ordentlichen Handwerke zur Pflicht
gemacht haben. Das Bedürfnis einer Synagogen-Reform längst fühlend, suchte
man durch einzelne Einrichtungen manche Missbräuche abzustellen. Umso williger
kam man im vorigen Jahre der Aufforderung des königlichen Landgerichts, die
Synagogen-Ordnung von Mittelfranken einzuführen, entgegen und scheute die
beträchtlichen pekuniären Opfer nicht, um unsere Synagoge auch in ihrem
Inneren zeitgemäß und ihrer hohen Bestimmung würdig auszustatten, was auf
eine so befriedigende Weise gelungen ist, dass Jeder welcher unsere Synagoge
früher kannte, jetzt beim Eintritt in dieselbe sich von deren freundlichem
Anblick überrascht fühlt. Gleichzeitig hat sich aus der männlichen
Schuljugend und mehreren erwachsenen Jünglingen ein Sänger-Chor gebildet,
welcher sich seit der Wiedereröffnung unserer renovierten Synagoge (d.i. am 6.
September 1839) beeifert, an Sabbat- und Festtagen durch angemessenen
Choral-Gesang die Gemeinde zur Andacht zu stimmen. Schließlich muss ich mir die
Bemerkung noch erlauben, dass es dem verehrten Einsender obiger Notiz entgangen
zu sein scheint, dass aus seiner Gemeinde eine Deputation Sachkundiger sich hier
her begab, um von unserer Synagoge Einsicht zu nehmen und nach diesseitigem Plane die dortige Synagoge herstellen zu lassen; somit hat Steinhart, nicht aber
Dittenheim, für diese Gegend das gute Beispiel gegeben. |
Bis um 1880 waren die meisten jüdischen Einwohner abgewandert, sodass
die Synagoge geschlossen, verkauft und zu einem bis heute erhaltenen Wohnhaus
umgebaut wurde. Nach den Erinnerungen von Heinrich Heymann wurde die Synagoge
allerdings "auf Abbruch verkauft", sodass nicht ganz klar ist, wie viel
von dem alten Synagogengebäude in dem jetzt hier stehenden Wohnhaus aufgegangen
ist.
Fotos
Historische Fotos:
Historische Fotos sind nicht bekannt, eventuelle
Hinweise bitte an den Webmaster von Alemannia Judaica,
Adresse siehe Eingangsseite |
Neuere Fotos:
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 12.3.2004)
| Die Steinharter Synagoge |
|
 |
 |
 |
| Die Synagoge in
Steinhart war ein unauffälliges Gebäude. Es wird heute zu Wohnzwecken
genutzt. |
| |
Das jüdische
Schul- und Gemeindehaus |
 |
 |
| |
Das stattliche
jüdische Schul- und Gemeindehaus wurde von dem aus Steinhart stammenden, nach London
ausgewanderten jüdischen Kaufmann Joel Emanuel 1842 finanziert;
es kostete über 4.000
Gulden. |
| |
|
Bauplan des
jüdischen Gemeindehauses von 1842; Planfertiger war Dionys Streicher,
Gemeindebevollmächtigter, Techniker und Maurermeister zu Wemding
(Plan erhalten über Rolf Hofmann, Stuttgart) |
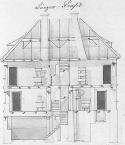 |
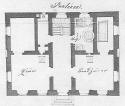 |
 |
Längenprofil des
jüdischen Gemeindehauses.
Erkennbar sind die Öfen auf beiden Stockwerken.
Das Kaltwasser wurde aus dem Brunnen im Keller
in einen Holzbottich in der Küche im EG hochgepumpt
und dann im freien Fall ins Tauchbecken geleitet.
|
Erdgeschoss: die
beiden Zimmer links wurden als
Schulraum genutzt (beheizt). Hinten neben der Treppe
gab es ein WC. Die Mikwe im rechten Bereich hatte
einen Zugang über das "Baadzimmer" mit Ofen. In der
"Kuch" sieht man den Holzbottich und den Ofen für
die Zubereitung des warmen Wassers für die Mikwe. |
Erster Stock (Parterre) mit
der Wohnung des Lehrers
(Wohn- und Schlafzimmer, Kammer, "Kuche" (Küche),
"Speiß" (Speisekammer) und "Cabinet" (kleines
Nebenzimmer)). Auch ein Gemeindezimmer war
vorhanden für die Sitzungen des Gemeindevorstandes
und für die Gruppen der Gemeinde. |
| |
|
Foto von 2013
(vor Einbau neuer Fenster;
Foto erhalten von Gerhard Beck) |
 |
| |
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Ludwig Müller: Aus fünf Jahrhunderten. Beiträge zur Geschichte
der jüdischen Gemeinden im Ries. in: Zeitschrift des Historischen Vereins
für Schwaben und Neuburg 26 1899 S. 81-183. |
 | Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish
Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -
Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 370. |
 | Michael Trüger: Der jüdische Friedhof in Steinhart/Schwaben. In:
Der Landesverband der Israelit. Kultusgemeinden in Bayern. 11. Jg. Nr. 73
Juni 1997 S. 17-18. |
 | Alfred Heinzel: Juden in Steinhart - Kurzer
Rückblick. Aufsatz aus den 1990er-Jahren. |
 | Gernot Römer: Schwäbische Juden. Leben und Leistungen aus zwei Jahrhunderten. In
Selbstzeugnissen, Berichten und Bildern. Augsburg 1990 (insbesondere zu der
aus Steinhart stammenden Familie Heymann S. 37ff. |
 |
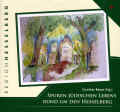 Spuren jüdischen Lebens rund um den Hesselberg. Kleine Schriftenreihe Region Hesselberg Band
6.
Spuren jüdischen Lebens rund um den Hesselberg. Kleine Schriftenreihe Region Hesselberg Band
6.
Hrsg. von Gunther Reese, Unterschwaningen 2011. ISBN
978-3-9808482-2-0
Zur Spurensuche nach dem ehemaligen jüdischen Leben in der Region Hesselberg lädt der neue Band 6 der
'Kleinen Schriftenreihe Region Hesselberg' ein. In einer Gemeinschaftsarbeit von 14 Autoren aus der Region, die sich seit 4 Jahren zum
'Arbeitskreis Jüdisches Leben in der Region Hesselberg' zusammengefunden haben, informieren Ortsartikel über Bechhofen, Colmberg,
Dennenlohe, Dinkelsbühl, Dürrwangen, Feuchtwangen, Hainsfarth, Heidenheim am Hahnenkamm, Jochsberg, Leutershausen, Mönchsroth, Muhr
am See (Ortsteil Altenmuhr), Oettingen, Schopfloch, Steinhart,
Wallerstein, Wassertrüdingen und Wittelshofen über die Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinden. Am Ende der Beiträge finden sich Hinweise auf sichtbare Spuren in Form von Friedhöfen, Gebäuden und religiösen Gebrauchsgegenständen mit Adressangaben und Ansprechpartnern vor Ort. Ein einleitender Beitrag von Barbara Eberhardt bietet eine Einführung in die Grundlagen des jüdischen Glaubens. Eine Erklärung von Fachbegriffen, ein Literaturverzeichnis und Hinweise auf Museen in der Region runden den Band mit seinen zahlreichen Bildern ab. Das Buch ist zweisprachig erschienen, sodass damit auch das zunehmende Interesse an dem Thema aus dem englischsprachigen Bereich
abgedeckt werden kann, wie Gunther Reese als Herausgeber und Sprecher des Arbeitskreises betont. Der Band mit einem Umfang von 120 Seiten ist zum Preis von
12,80 €- im Buchhandel oder im Evangelisch-Lutherischen Pfarramt Mönchsroth, Limesstraße 4, 91614 Mönchsroth, Tel.: 09853/1688 erhältlich
E-Mail: pfarramt.moenchsroth[et]elkb.de. |
|
Materialien zu Steinhart, erarbeitet von Rolf Hofmann, harburgprojekt,
auf Grundlage der Forschungen von Mario Jacoby
STEINHART JEWISH VITAL RECORDS - compiled by Rolf Hofmann, based on Mario
Jacoby's previous research
(1) birth records
1816-1871
(2) marriage records 1816-1875
(3) death records 1816-1900
(4) gravelist + name index
(5) cemetery map
(6) family list of 1804
(7) matrikel list (ca. 1813-1861)
(8) familysheet Michael
Untermeier of Steinhart + Augsburg
(9) familysheet
Nathan Heymann of Steinhart + Oettingen
(10) Familienblatt
Familie Heymann aus Steinhart - Schematische Teilübersicht
(11) Familienblatt Familie
Emanuel aus Steinhart
Joel Emanuel (1770
Steinhart - 1853 London) war Bankier und Philantropist in London.
(12) Familienblatt
Samuel Israel Weinberger of Steinhart
(13) familysheet Isaak
Herrmann of Steinhart + Oettingen
(14) familysheet Salomon
Herrmann of Steinhart + Oettingen
Weitere Ahnentafel:
Ahnentafel
Jenny Heymann (Nachkommen von Salomon, geb. um 1715 in Steinhart), erstellt
von Mouna El Kassemi, Stefanie Jurk, Vitushan A. und Cornelia Egger (stud.
Ludwigsburg 2018)



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|