|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
Zurück zur Übersicht: "Jüdische
Friedhöfe in der Region"
Zurück zur Übersicht: "Jüdische Friedhöfe in Mittelfranken"
Ermetzhofen (Gemeinde
Ergersheim, Kreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim)
Jüdischer Friedhof
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
Siehe Seite zur Synagoge in Ermetzhofen
(interner Link)
Zur Geschichte des Friedhofes
Der jüdische Friedhof konnte auf
Grund eines Vertrages mit der Ortsherrschaft im September 1654 angelegt werden.
Die jüdische Gemeinde hatte dafür ein jährliches "Grab- und
Schutzgeld" zu bezahlen. 1777 konnte der Friedhof auf Grund eines
fürstlichen Dekretes erweitert werden, obwohl sich die Pfarrei und die Gemeinde
dagegen aussprach. Auf dem Friedhof wurden auch die Verstorbenen der jüdischen
Gemeinden in Burgbernheim, Gnodstadt, Uffenheim und
Welbhausen beigesetzt.
Im Dezember 1926 wurde der Friedhof geschändet (siehe Mitteilungen
unten).
In
der NS-Zeit wurde der Friedhof schwer geschändet und teilweise abgeräumt.
Viele Grabsteine wurden für den Straßenbau verwendet. Das Taharahaus und ca.
400 Grabsteine aus der Zeit zwischen 1791 und 1936 sind heute noch
erhalten. Nach 1945 wurde der Friedhof - soweit möglich - wieder hergerichtet
(1959).
Die Friedhofsfläche umfasst 43,30 ar, nach anderen Angaben 44,12 ar.
Der Friedhof ist im Nord- und Südwesten durch einen Maschendrahtzaun auf Beton-
bzw. Feldsteinsockel eingegrenzt, an den beiden anderen Seiten durch eine ca.
1.60 m hohe Mauer aus Betonplatte, die im Südosten von Efeu überwuchert
ist.
Der Friedhof besitzt zwei Eingänge: Ein Tor aus Eisenstäben mit zwei Davidsternen versehen in der Mitte der Nordwestseite, an der Straße im
Rannachgrund. Das andere Tor, aus Eisenblechen geschmiedet, liegt in der Südostecke, und ist von der Bergtshofener Straße über den Feldweg zu erreichen.
Gleich rechts beim unteren Tor steht ein Walnussbaum, links das Leichenhaus. Auf der nach Südosten hin ansteigenden Wiese liegen im unteren Bereich noch vereinzelt Grabsteinreste. Es gibt keine Wege, jedoch führt eine Treppe in der Mitte der Nordostseite zum oberen, weniger steilen Gräberfeld. In 17 Reihen stehen 405 Grabsteine, drei sind umgestürzt.
Im Bereich gleich oberhalb der Böschung finden sich mit wenigen Ausnahmen kleine, zum Teil schon in die Erde gesunkene Sandsteinstelen, einzeln oder in kurzen Reihen stehend, dazwischen viele Lücken. Weiter oben stehen die Grabsteine immer dichter, die Stelen werden größer, andere Grabmalformen wie neoklassizistische und neugotische Denkmäler treten auf, andere Materialien wie Muschelkalk, Granit und Marmor.
Besonderheiten: Die beiden ältesten erhaltenen Grabsteine stammen von 1791 und 1794 und stehen am unteren Ende des Grabsteinfeldes direkt an der Böschung. Die letzten Beerdigungen fanden 1936 statt.
In der ersten und zweiten Reihe wurden, soweit erkennbar, fast nur Frauen begraben, darunter mindestens
fünf Wöchnerinnen, wie aus einigen Grabinschriften und dem Sterberegister hervorgeht. Im Übrigen wurden meist Frauen neben Frauen, Männer neben Männern begraben. An einigen Stellen liegen mehrere
Kindergräber nebeneinander. Dadurch, dass so viele Reihen angelegt waren, konnten jedoch Ehepartner oder Verwandte, die in kurz aufeinanderfolgenden Jahren starben, nebeneinander begraben werden.
Einige Doppelgrabsteine stehen für Eheleute oder Verwandte, die innerhalb eines Jahres starben, da dann der Grabstein für den zuerst Gestorbenen noch nicht gesetzt war. Aufzufinden sind mehrere Grabsteine für Männer, die sich um die Gemeinde verdient gemacht hatten:
ein Kreisvorstand aus Welbhausen, ein Rabbiner aus Welbhausen, ein Schofarbläser und ein Religionslehrer aus
Ermetzhofen.
Aus der Geschichte des Friedhofes
Schändung des Friedhofes (1926)
 Mitteilung der der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins) vom 28. Januar 1927: "Dezember 1926. Ermetzhofen
(Mittelfranken): Beschädigung des kleinen jüdischen
Friedhofes." Mitteilung der der "CV-Zeitung" (Zeitschrift des
"Central-Vereins) vom 28. Januar 1927: "Dezember 1926. Ermetzhofen
(Mittelfranken): Beschädigung des kleinen jüdischen
Friedhofes." |
| |
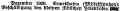 Mitteilung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Februar 1927:
"Dezember 1926. Ermetzhofen (Mittelfranken): Beschädigung des
kleinen jüdischen Friedhofes." Mitteilung
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Februar 1927:
"Dezember 1926. Ermetzhofen (Mittelfranken): Beschädigung des
kleinen jüdischen Friedhofes." |
| |
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 8. Juli 1927: Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und
Waldeck" vom 8. Juli 1927:
"Tafel der Schmach - 39 jüdische Friedhöfe in Deutschland geschändet.
Berlin. (J.T.A.) 'Der Schild', Zeitschrift des Reichsbundes jüdischer
Frontsoldaten, bringt unter der Überschrift 'Tafel der Schmach' ein
Verzeichnis von 39 Friedhofschändungen, die sich von November 1923 bis
Mai 1927 in Deutschland ereignet haben. Hier die Namen der Orte und die
Daten:
1. Sandersleben
(November 1923), 2. Schneidemühl (Januar 1924), 3. Sandersleben
(März 1924), 4. Rhoden, 5. Wolfhagen
- Hessen (April 1924), 6. Ribnitz
/ Mecklenburg (Mai 1924), 7. Villing (Juli 1924), 8. Regensburg
(August 1924), 9. Hemer (November 1924), 10. Hersfeld
(November 1924, 11. Kleinbardorf bei
Königshofen, 12. Binswangen Bez.
Augsburg (Juni 1924), 13. Hagen i.W. (Juni 1924), 14. Göttingen
(August 1924), 15. Beverungen (Dezember 1924), 16. Köthen
(Mai 1925), 17. Plauen i.V.
(Juni 1924), 18. Alsbach a.d. Bergstraße,
19. Hockenheim / Baden (Januar
1925), 20. Löwenberg (Februar 1926), 21. Pflaumloch
(März 1926), 22. Erfurt (März 1926),
23. Callies (April 1926), 24. Memmelsdorf
/ Oberfranken (Main 1926), 25. Altdamm/Pommern (Oktober 1926), 26.
Breslau (Dezember 1926), 27. Bingen
(Dezember 1926), 28. Ermetzhofen /
Mittelfranken (Dezember 1926), 29. Kuppenheim
/ Baden (Januar 1927), 30. Kerpen / Rheinland (März 1927), 31.
Neviges / Regierungsbezirk Düsseldorf (März 1927), 32.
Hillesheim / Rheinhessen (April 1927), 33. Moers (April 1927), 34.
Krefeld (April 1927), 35. Richelsdorf /
Bezirk Kassel (April 1927), 36. Ansbach
(April 1927), 37. Regensburg (Mai
1927), 38. Aufhausen bei Bopfingen
(Mai 1927), 39. Rülzheim / Rheinpfalz
(Mai 1927)." |
Lage des Friedhofes
Der Friedhof liegt am südöstlichen Ortsrand an der Gabelung
der Wege nach Bergtshofen und Pfaffenhofen. Der Eingang liegt etwa 20 m rechts
auf dem Weg nach Pfaffenhofen.
Pläne / Fotos
(Pläne: aus der Dokumentation Johanna Morgenstern-Wolff
s.Lit.; Fotos: Jürgen Hanke, Kronach)
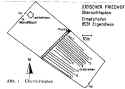 |
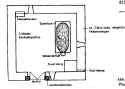 |
 |
| Übersichtsplan zum Friedhof |
Plan des Taharahauses |
Belegungsplan: Gräberfeld
1791-1936 |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Blick auf das
Taharahaus mit dem Waschtisch |
Grabstein für Helene
Fleischmann
von Welbhausen (1833-1861) |
| |
| |
|
 |
 |
 |
Grabstein für Ernst Hirsch
(1903-1935)
und Rosa Hirsch geb. Jochsberger
aus Windsheim (1871-1935) |
Grabstein für Josef Hirsch
aus Windsheim (1865-1936)
|
Grabstein für Anna Löwenthal
geb. Gundelfinger (gest. 1883)
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Johanna Morgenstern-Wulff: Der jüdische Friedhof
von Ermetzhofen: eine Dokumentation im Auftrag der Gemeinde Ergersheim.
Uffenheim 1988.
|
 | Israel Schwierz: Steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens
in Bayern. 1988 S. 153-154. |
 | Michael Trüger: Der jüdische Friedhof in
Ermetzhofen. In: Der Landesverband der Israelit. Kultusgemeinden in Bayern. 10.
Jahrgang Nr. 67 vom September 1995 S. 23.
|



vorheriger Friedhof zum ersten
Friedhof nächster Friedhof
|