|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zu den Synagogen in
Baden-Württemberg
 Links:
Stempel der Israelitischen Gemeinde Malsch (Quelle: Stude s. Lit. S. 363) Links:
Stempel der Israelitischen Gemeinde Malsch (Quelle: Stude s. Lit. S. 363)
Malsch (Landkreis Karlsruhe)
Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In dem von 1622 bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zur
Markgrafschaft Baden-Baden gehörenden Malsch bestand eine jüdische Gemeinde
bis 1938/40. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17. Jahrhunderts zurück, als
zunächst – vermutlich während des Dreißigjährigen Krieges – drei jüdische
Familien im Ort aufgenommen wurden. 1684 wird ein Aaron von Malsch genannt. 1715 waren sechs
Familien am Ort, 1721 fünf, 1783 vier, 1797 vierzehn.
Eine selbständige jüdische Gemeinde dürfte sich zwischen 1810 und 1822
gebildet haben. Erstmals ist in einem Kaufvertrag vom 3. Mai 1822 von der
"hiesigen Israelitischen Gemeinde" die Rede. An diese verkaufte damals
die Witwe des Liebmann Simon eine zweistöckige Behausung. In einem Vertrag vom
Mai 1810 war noch die Rede von "sämtlicher Judenschaft", an die der
"Schutzjud" Max Bär seine Stallung samt dem Grundstück verkauft
hat.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner
wie folgt: 1825 108 jüdische Einwohner (4,6 % von insgesamt 2.330 Einwohnern),
1832 113, 1836 152, 1839 160, 1864 243, 1871 254, 1875 Höchstzahl von 320 Personen
(9,0 % von insgesamt 3.544 Einwohnern), 1880 303, 1885 293, 1890 247, 1895
224 (6,0 % von 3.771), 1900 203 (5,2 % von 3.906), 1905 180, 1910 146 (3,3 % von
4.407).
Bis zur 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es unter den jüdischen
Gewerbetreibenden fast ausschließlich Viehhändler, Metzger und
Krämer.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine
jüdische Schule (von 1873 bis 1876 als jüdische Konfessionsschule), ein rituelles
Bad (am Ortsbach, Gebäude 1962 abgebrochen). Die jüdische Schule war in einem
Unterrichtsraum in einem gemeindeeigenen Haus neben der Kirche eingerichtet.
Nach der Auflösung der Konfessionsschulen in Baden 1876 wurde im Schulraum noch der
Religionsunterricht erteilt; für den allgemeinen Unterricht besuchten die
jüdischen Kinder die Ortsschule. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der
Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet
tätig war. Unter den Lehrern werden genannt: Lehrer Hirsch Rothschild (1851 bis
1868, vgl. ein Bericht von ihm in der Seite zu
Gerstheim), Lehrer Kahn (1873 bis 1876 bis zur
Auflösung der Konfessionsschule; 1869/70 gab es 51 jüdische Schulkinder,
1870/71 53, 1871/72 63), Hauptlehrer Nathan Bergmann (von mindestens 1889 bis
1920). In den 1920er-Jahren wurden die Kinder der Gemeinde zeitweise durch Lehrer aus
Nachbargemeinden unterrichtet. Die Toten der Gemeinde wurden auf dem jüdischen Friedhof
in Kuppenheim beigesetzt; die Anlage eines jüdischen Friedhofes in Malsch
neben dem allgemeinen Ortsfriedhof wurde 1868 von der Gemeindeverwaltung
abgelehnt. 1827 wurde
die jüdische Gemeinde dem Rabbinatsbezirk Karlsruhe, 1885 dem Rabbinatsbezirk
Bühl
zugeteilt.
Im deutsch-französischen Krieg 1870/71 nahmen auch jüdische Soldaten
aus der Gemeinde teil: auf der Gedenktafel der "Germania" auf dem
Kirchplatz finden sich die Namen der jüdischen Kriegsteilnehmer: Nathan Maier
und Salomon Kaufmann. Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Wilhelm Dreifuß
(geb. 15.4.1893 in Malsch, gef. 26.5.1915) und Sally Maier (geb. 26.9.1899 in
Malsch, gef. 17.11.1918). Der Name von Sally Maier steht auf dem Gefallenendenkmal der Gemeinde.
Beide Namen waren auf einer Gedenktafel in der Synagoge zu lesen (siehe
Abbildung unten). Außerdem sind gefallen: Berthold Falk (geb. 6.5.1899 in
Malsch, vor 1914 in Durlach wohnhaft, gef. 21.7.1918), David Falk (geb.
18.1.1895 in Malsch, vor 1914 in Ettlingen wohnhaft, gef. 24.3.1918), Jakob
Maier (geb. 5.8.1871 in Malsch, vor 1914 in Hitdorf wohnhaft, gef.
7.11.1917).
Um 1924, als zur Gemeinde 101 Personen gehörten (2,1 % von insgesamt
5.004 Einwohnern, waren die Gemeindevorsteher Julius Maier, Samuel Maier und Lippmann Maier. Die damals neun schulpflichtigen jüdischen Kinder erhielten
ihren Religionsunterricht durch Lehrer Lazarus Aberbach aus Ettlingen. 1932
waren die Gemeindevorsteher Albert Stern (1. Vors.), David Maier (2. Vors.) und
Gustav Maier (3. Vors.). Als Lehrer, Kantor und Schochet kam regelmäßig Lehrer
H. Translateur aus Rastatt nach Malsch; im Schuljahr 1931/32 hatte er fünf Kinder
aus der Gemeinde in Religion zu unterrichten. An jüdischen Vereinen gab
es insbesondere den Wohltätigkeitsverein Gemilus Chesed (1932 unter
Leitung von David Maier; Zweck und Arbeitsgebiete: Krankenpflege und
Bestattungswesen) sowie den Frauenverein (1932 unter Leitung von Lina
Löb). Nachdem 1932 Leo Gabel das Amt des Kantors und Religionslehrers
übernommen hatte, wurde auch ein "Jüdischer Jugendbund"
gegründet.
An ehemaligen, bis nach 1933 bestehenden Handels- und Gewerbebetrieben
im Besitz jüdischer Personen beziehungsweise Familien sind bekannt: Händler Julius Dreyfuß
(Hauptstraße 125, abgebrochen, nach 1945 neu erstellt), Warenhandlung Ludwig Dreyfuß (Adlerstraße 50, abgebrochen), Viehhandlung Alfred Löb
(Kreuzstraße 14, abgebrochen), Zigarrenfabrikant Artur Löb (Kronenstraße 2), Viehhandlung Isidor Löb
(Kreuzstraße 8), Viehhandlung Leopold Löb (Kreuzstraße 10), Viehhandlung Gustav Maier
(Adlerstraße 38, abgebrochen), Viehhandlung Isidor Maier (Adlerstraße 8), Fellhandlung Jakob Maier
(Adlerstraße 4 und 6), Viehhandlung Lippmann Maier (Hauptstraße 33), Textilgeschäft Siegmund Maier
(Beethovenstraße 1 und Neuwiesenstraße 6), Fellhandlung Maier Maier (Neudorfstraße
1) Schuhmacher Max Maier I (Adlerstraße 8), Kaufmann Max Maier II (Waldprechtsstraße
1, abgebrochen), Tankstelle Richard Maier (Hauptstraße 13), Handelsmann Samuel Maier
(Adlerstraße 52, abgebrochen), Metzger und Viehhandlung Stern (Sézanner Straße
54).
1933 lebten in Malsch noch 89 jüdische Personen. Durch die Folgen des
wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Repressalien und der Entrechtung sind
alsbald mehrere der jüdischen Gemeindeglieder von Malsch in andere Orte
verzogen oder ausgewandert. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge
zerstört (s.u.), die Schaufenster jüdischer Geschäfte und das Mobiliar
jüdischer Wohnungen wurden zerschlagen. Es kam auch zu Misshandlungen und
Plünderungen: Lippmann Maier wurden 3.800 RM aus dem Kassenschrank gestohlen.
Mindestens 10 Männer der Gemeinde wurden in das KZ Dachau verschleppt. Am 31.
Dezember 1939
wurden noch 28 jüdische Einwohner gezählt. Am 22. Oktober 1940 wurden die
letzten 19 jüdischen Einwohner aus Malsch nach Gurs deportiert.
Von den in Malsch geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches
- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Wilhelm Bär (1890), Clara Bermann geb. Maier
(1895), Berthold Dreyfuss (1870), Gustav Dreyfuss (1866), Joseph Dreyfuss
(1878), Karoline Dreyfuss (1874), Ludwig Dreyfuss (1894), Simon Dreyfuss (1875),
Wilhelm Dreyfuss (1871), Wilhelm Dreyfuss (1898), Bertha Falk geb. Bär (1872), Josef Falk
(1892), Max Falk (1897), Charlotte Gabel geb. Weisberg
(1907), Leo Gabel (1901), Betty Geismar geb. Löb (1884), Sara Herz geb. Maier
(1866), Klara Kahn (1900), Betty Kaufherr geb. Weil (1896), Hannelore Kaufherr
(1926), Josef Kaufherr (1889), Mathilde Kaufmann geb. Maier (1855), Salomon
Lehmann (1868), Alfred Löb (1887), Isidor Löb (1866), Jenny Löb geb.
Neustädter (1879), Karolina Löb geb. Maier (1872), Babette Maier (1895), David
Maier (1878), Ella Maier geb. Israel (1879), Frieda Maier geb. Löb (1894),
Hilda Maier (1891), Jacob Maier (1886), Klara Maier (1875), Klara Maier geb.
Weil (1890), Lina Maier (1883), Löb Maier (1877), Max Maier (1867), Max Maier
(1872), Mina Maier (1873), Nanette Maier (1871), Klara Maier geb. Weil (1890),
Löb Maier (1877), Salomon Maier (1893), Samuel Maier (1861), Samuel Maier
(1864), Sigmund Maier (1888), Simon Maier (1857), Simon Maier (1881), Sophie
Maier (1863), Wanda Nussbaum geb. Maier (1898), Babette Oppenheimer geb. Maier
(1877), Selma Ruthenberg geb. Maier (1890), Babette Schmalz geb. Stern (1867),
Fanni Slingeneyer geb. Maier (1879), Lina Sohn geb. Dreifuss (1881), Josef Stein
(1871), Anna Stern
geb. Neustädter (1875), Friederike Stern (1869), Josef Stern (1873), Julius
Stern (1886), Leopold Stern (1872), Salomon Stern (1864), Elise Vollweiler geb.
Maier (1889).
Unklar ist noch die Zuordnung der in der NS-Zeit Umgekommenen zu Malsch HD oder Malsch
KA bei den folgenden in "Malsch" geborenen Personen: Max
David (1877), Nathan David (1877), Hermann Hirsch (1883), Josef Jost (1885), Jenny Samson geb.
David (1882).
Am 11. Oktober 2010 wurden in Malsch 15 "Stolpersteine"
zur Erinnerung an Personen verlegt, die aus Malsch nach der Deportation
umgekommen sind. Die "Stolpersteine" liegen vor folgenden Gebäuden:
Hauptstraße 26 (Josef, Betty und Hannelore Kaufherr), Waldprechtsstraße 1 (Ella
und Max Maier), Waldprechtsstraße 5 (Leo und Charlotte Gabel; die Steine
wurden auf Wunsch der Familie Gabel inzwischen wieder entfernt und befinden sich
im Archiv der Heimatfreunde),
Hauptstraße 27 (Nanette Maier), Hauptstraße 29 (Samuel und Frieda Maier), Kreuzstraße 10
(Isidor und Karoline Löb, Salomon und Mina Lehmann, Amalie Herz). Bericht
über die Verlegung (Video) bei R.TV. Eine zweite Verlegungsaktion war
am 13. September 2012: dabei wurden vor den folgenden Gebäuden
"Stolpersteine" verlegt: Sézanner Straße 54 (Anna Stern geb.
Neustädter), Neuwiesenstraße 6 (Sigmund Maier und Clara Maier geb. Weil),
Adlerstraße 5 (Salomon Stern), Adlerstraße 8 (Max Maier und Sophie Maier),
Adlerstraße 50 (Leopold Stern und Ludwig Dreifuss), Adlerstraße 72 (Löb
Maier), Friedrichstraße 59 (Josef Stein). Dazu wurden "Stolpersteine"
für Opfer der "Euthanasie" verlegt. Weitere Informationen und
Fotos in der Website www.heimatfreunde-malsch.de.
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer, Vorbeter und Schächter sowie der Schule
Ausschreibung der Stelle eines Lehrers und Vorsängers
(1837 / 1846) sowie der eines Kantors und Schächters in
Malsch (1903)
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" von 1837 S. 754 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Erledigte Stelle. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" von 1837 S. 754 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
"Erledigte Stelle.
Bei der israelitischen Gemeinde Malsch ist die Lehrstelle für den Religionsunterricht
der Jugend, mit welcher ein Gehalt von 60 Gulden nebst freier Kost und
Wohnung, sowie der Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen
verbunden ist, erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter
höherer Genehmigung zu besetzen.
Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,
unter Vorlage der Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren
sittlichen und religiösen Lebenswandel binnen 6 Wochen sich bei der
Bezirks-Synagoge Karlsruhe zu melden.
Auch wird bemerkt, dass im Falle weder Schulkandidaten noch
Rabbinatskandidaten sich melden, andere inländische Subjekte nach
erstandener Prüfung bei dem Bezirks-Rabbiner zur Bewerbung zugelassen
werden.
Karlsruhe, den 23. August 1837. Großherzogliche
Bezirks-Synagoge." |
| |
 Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 12. August 1846 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
" Bei der israelitischen Gemeinde Malsch ist die
Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein
Gehalt von 1 50 fl., sowie der
Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist,
erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer
Genehmigung zu besetzen.
Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,
unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren
sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen sich bei der
Bezirkssynagoge Karlsruhe zu melden.
Auch wird bemerkt, dass im Falle sich weder Schul- noch
Rabbinatskandidaten melden, andere inländische Subjekte, nach
erstandener Prüfung bei dem Rabbiner, zur Bewerbung zugelassen
werden." Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den
See-Kreis" vom 12. August 1846 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):
" Bei der israelitischen Gemeinde Malsch ist die
Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein
Gehalt von 1 50 fl., sowie der
Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist,
erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer
Genehmigung zu besetzen.
Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,
unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren
sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen sich bei der
Bezirkssynagoge Karlsruhe zu melden.
Auch wird bemerkt, dass im Falle sich weder Schul- noch
Rabbinatskandidaten melden, andere inländische Subjekte, nach
erstandener Prüfung bei dem Rabbiner, zur Bewerbung zugelassen
werden." |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 18. Mai 1903: "Zu besetzen Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 18. Mai 1903: "Zu besetzen
per 1. August dieses Jahres die Kantor- und Schächterstelle in
Malsch bei Karlsruhe (Baden). Fixum 800 Mark Nebeneinkommen 600-700 Mark.
Freie Wohnung für Ledige. Meldungen nebst nur beglaubigten
Zeugnisabschriften sind sofort anher zu richten.
Bezirkssynagoge Bühl: Dr. B. Mayer." |
Bezirkslehrerkonferenz in Malsch
(1892)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. September 1892:
"Aus Baden. Die diesjährige Religionskonferenz der israelitischen
Lehrer des Konferenzbezirkes Bühl wurde am 11. September unter Vorsitz
des Bezirksrabbiners Herrn Dr. Meyer aus Bühl
in dem Orte Malsch abgehalten. Nach Begrüßung der Versammlung durch den
Lehrer des Versammlungsortes, Herrn Hauptlehrer Bergmann und besonderer
Danksagung an die Herren Bürgermeister Rastätter und Ratschreiber Deutel,
die auf an die Ortsschulbehörde ergangene Einladung die Konferenz mit
ihrer Anwesenheit beehrten, erwiderte Herr Bürgermeister Rastätter in
warmen, zu Herzen gehenden Worten, indem er auf das schone, friedliche
Einvernehmen zwischen den verschiedenen Konfessionen der Gemeinde Malsch
hinwies, woran dessen Wünsche gipfelten, es möchten die guten
Beziehungen auch fortan in der Gemeinde sich fortpflanzen. Ehre diesem
Manne, der in solch' humaner Weise die konfessionelle Eintracht zu pflegen
und zu erhalten bestrebt ist. - Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. September 1892:
"Aus Baden. Die diesjährige Religionskonferenz der israelitischen
Lehrer des Konferenzbezirkes Bühl wurde am 11. September unter Vorsitz
des Bezirksrabbiners Herrn Dr. Meyer aus Bühl
in dem Orte Malsch abgehalten. Nach Begrüßung der Versammlung durch den
Lehrer des Versammlungsortes, Herrn Hauptlehrer Bergmann und besonderer
Danksagung an die Herren Bürgermeister Rastätter und Ratschreiber Deutel,
die auf an die Ortsschulbehörde ergangene Einladung die Konferenz mit
ihrer Anwesenheit beehrten, erwiderte Herr Bürgermeister Rastätter in
warmen, zu Herzen gehenden Worten, indem er auf das schone, friedliche
Einvernehmen zwischen den verschiedenen Konfessionen der Gemeinde Malsch
hinwies, woran dessen Wünsche gipfelten, es möchten die guten
Beziehungen auch fortan in der Gemeinde sich fortpflanzen. Ehre diesem
Manne, der in solch' humaner Weise die konfessionelle Eintracht zu pflegen
und zu erhalten bestrebt ist. -
Mit sichtlichem Interesse folgten auch die erwähnten Herren den darauf
folgenden Probelektionen mit den Schülern der oberen Schuljahre des
Konferenzortes aus Exodus 33,17 bis Ende und Psalm 19, die durch Herrn
Hauptlehrer Bergmann zur Zufriedenheit der Anwesenden geistvoll und unter
Erzielung des richtigen Verständnisses behandelt wurden.. |
Lehrer Jacob Schloß von Talheim kommt nach Malsch (1905)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Dezember
1905: "Karlsruhe: "Das neueste Verordnungsblatt des
Großherzoglichen Oberrates der Israeliten meldet folgende Veränderungen
in der Besetzung der Religionsschullehrerstellen: Jakob Lewin seither in Lorsch
nach Randegg, Sally Rosenfelder in Eubigheim
nach Buchen, Nathan Adler von Külsheim
nach Eubigheim, Kantor Simon Metzger
von Sulzburg nach Bretten,
Samuel Strauß von Berlichingen
nach Sulzburg, Jakob Schloß
von Talheim nach Malsch bei
Ettlingen. Auf Ansuchen wurden von ihren Stellen enthoben: Kantor Weiß in
Gailingen und Religionslehrer Jakob
Lorch in Untergrombach, letzterer
behufs Übernahme der Verwalterstelle der M.A. d. Rothschild'schen
Lungenheilstätte in Nordrach." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Dezember
1905: "Karlsruhe: "Das neueste Verordnungsblatt des
Großherzoglichen Oberrates der Israeliten meldet folgende Veränderungen
in der Besetzung der Religionsschullehrerstellen: Jakob Lewin seither in Lorsch
nach Randegg, Sally Rosenfelder in Eubigheim
nach Buchen, Nathan Adler von Külsheim
nach Eubigheim, Kantor Simon Metzger
von Sulzburg nach Bretten,
Samuel Strauß von Berlichingen
nach Sulzburg, Jakob Schloß
von Talheim nach Malsch bei
Ettlingen. Auf Ansuchen wurden von ihren Stellen enthoben: Kantor Weiß in
Gailingen und Religionslehrer Jakob
Lorch in Untergrombach, letzterer
behufs Übernahme der Verwalterstelle der M.A. d. Rothschild'schen
Lungenheilstätte in Nordrach." |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Spendenaufruf für eine in schwere Not
geratene Familie (1889)
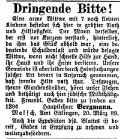 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. März 1889: "Dringende
Bitte! Eine arme Witwe mit 7 noch kleinen Kindern befindet sich hier
in größter Not und Hilflosigkeit. Der Mann derselben, der erst vor
Kurzem verstarb, hinterließ, da ihm das Glückabhold war, eine bedeutende
Schuldenlast und würde besagte Witwe, wenn nicht schnelle Hilfe zur Hand,
ihr Haus und ihr Heim verlieren. Unsere Gemeinde ist aber leider durch
Heimsuchungen solcher Art derart in Anspruch genommen, dass fremde Hilfe
Not tut. Deswegen, teure Glaubensbrüder, höret unser Flehen und
betätigt auch hier jüdische Mildtätigkeit. Freundliche Gaben bitte zu
senden an Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. März 1889: "Dringende
Bitte! Eine arme Witwe mit 7 noch kleinen Kindern befindet sich hier
in größter Not und Hilflosigkeit. Der Mann derselben, der erst vor
Kurzem verstarb, hinterließ, da ihm das Glückabhold war, eine bedeutende
Schuldenlast und würde besagte Witwe, wenn nicht schnelle Hilfe zur Hand,
ihr Haus und ihr Heim verlieren. Unsere Gemeinde ist aber leider durch
Heimsuchungen solcher Art derart in Anspruch genommen, dass fremde Hilfe
Not tut. Deswegen, teure Glaubensbrüder, höret unser Flehen und
betätigt auch hier jüdische Mildtätigkeit. Freundliche Gaben bitte zu
senden an
Hauptlehrer Bergmann. Malsch, Amt Ettlingen, 20. März
1889.
Auch die Expedition dieses Blattes ist bereit, Gaben in Empfang zu nehmen
und weiterzubefördern." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Einzelpersonen
Torarolle gesucht (1891)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Mai 1891: "Es
wird von einer Gesellschaft eine gebrauchte, kleine Torarolle zu
kaufen gesucht. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Mai 1891: "Es
wird von einer Gesellschaft eine gebrauchte, kleine Torarolle zu
kaufen gesucht.
Offerten mit Preisangabe und Größe nimmt entgegen
David Löb Maier, Malsch, Amt Ettlingen (Baden). |
Anzeige des Gasthofes zum Schwanen von Isidor Löb
(1904)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 25. Mai 1904: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 25. Mai 1904:
"Reines Gänsefett,
streng koscher, das Pfund zu 1,80 Mark, stets zu haben bei
Isidor Löb, Gasthof zum Schwanen in Malsch, Amt Ettlingen
(Baden)." |
Anzeige des "Etagen-Geschäftes" von Julius
Maier
(Quelle: Stude s. Lit. S. 364, ohne Datierung)
 Anzeige
(aus einer nichtjüdischen Zeitung). Anzeige
(aus einer nichtjüdischen Zeitung).
"Beim Etagen-Geschäft Julius
Maier, Hauptstraße 81
liegt ein Posten Kopftuchkattune, Gardinenstoffe
(Reichsware), Schürzenzeuge, Kittelstoffe, Bettbezugstoffe
in nur prima
Qualitäten zum Verkauf aus, die zu mäßigen Preisen abgegeben
werden." |
Anzeige des Manufakturwarengeschäftes Jacob
David
(Quelle: Stude s. Lit. S. 364, ohne Datierung)
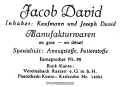 Anzeige
(aus einer nichtjüdischen Zeitung): Anzeige
(aus einer nichtjüdischen Zeitung):
"Jacob David.
Inhaber: Kaufmann
und Joseph David.
Manufakturwaren en gros - en détail.
Spezialität:
Anzugstoffe, Futterstoffe. Fernsprecher Nr. 29.
Bank-Konto: Vereinsbank
Rastatt e.G.m.b.H. Postscheck-Konto: Karlsruhe Nr. 14624." |
Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge
Da bereits 1715 sechs jüdische
Familien in Malsch lebten, dürften sie sich schon in dieser Zeit einen Betsaal
eingerichtet haben (Standort unbekannt).
Eine Synagoge wurde vermutlich Anfang des 19.
Jahrhunderts erbaut, nach einem späteren Bericht in einer Zeit, als gerade 14 jüdische
Familien in Malsch lebten. Für die Zeit der Entstehung der Synagoge um
beziehungsweise kurz nach 1810 sprechen zwei Quellen: 1. am 19. Mai 1810
verkaufte der "Schutzjud" Max Bär seine Stallung samt dem Platz neben
Hitscherich und Liebmann Simon für 400 Gulden zur Erbauung einer Schul (=
Synagoge) an "sämtliche Judenschaft". 2. Der "Schutzjude"
Isak Stern heiratete am 20. Februar 1814 die Jüdin Regine Dreifuß in der
Synagoge.
Um 1850 war sie für die stark gewachsene jüdische
Gemeinde zu klein geworden. Am 9. November 1855 wurde eine Gemeindeversammlung
einberufen, die die Frage einer Vergrößerung der Synagoge zum Thema hatte. Die
große Mehrheit sprach sich für eine solche Vergrößerung aus, worauf der
Synagogenrat der Gemeinde diesen Wunsch dem Bezirksamt in Ettlingen mitteilte.
Das Bezirksamt bat darum, einen Plan und Kostenüberschlag anfertigen zu lassen,
womit Anfang 1856 Werkmeister Ulrich von Ettlingen beauftragt wurde. Dieser
meinte, dass eine Vergrößerung der Synagoge etwa 2.500 Gulden kosten würde.
Freilich müsste auch das danebenstehende israelitische Schulhaus abgebrochen
werden, was im Blick auf einen Neubau weitere 1.500 Gulden kosten würde. Der
Betrag von zusammen 4.000 Gulden konnte jedoch von der Gemeinde nicht
aufgebracht werden, da bislang kein Fond für einen Synagogenbau eingerichtet
worden war. So wurde im April 1856 beschlossen, einstweilen nur die
Inneneinrichtung der bisherigen Synagoge so zu verändern, dass noch einige Plätze
gewonnen wurden. Der Synagogenrat beschloss jedoch auch, einen Baufonds
anzulegen, in den jährlich 200 bis 250 Gulden eingelegt werden sollten.
Bereits im Juni 1856 wurde eine neue Idee diskutiert,
nachdem die Gastwirtschaft "Zum Adler“ zum Kauf stand. In dieser
Gastwirtschaft oder an deren Stelle könnte man eine neue Synagoge erbauen oder
einrichten. Bezirksrabbiner Benjamin Willstätter aus Karlsruhe hielt die Idee
in einem Briefwechsel mit dem Bezirksamt Ettlingen grundsätzlich für gut, aber
er befürchtete aus seinen Erfahrungen mit der jüdischen Gemeinde in Malsch,
dass bei einer sofortigen Ausführung dieses Projektes der Frieden in der
Gemeinde gefährdet sei. Die Malscher Judenschaft sei "bisher öfters der Hort
der Zwietracht und gegenseitiger Gehässigkeit" gewesen. Er riet dazu,
nochmals acht bis zehn Jahre zu warten. In dieser Zeit würde es sicher wieder
mal Gelegenheit zum Ankauf eines geeigneten Grundstückes geben. Das Bezirksamt
stimmte Willstätter zu und wies darauf hin, dass die Gemeinde derzeit auch unmöglich
die Kosten für ein solches Projekt in Höhe von geschätzten 8.000 Gulden übernehmen
könnte.
So blieb die alte Synagoge in Malsch stehen. Allerdings
standen bis um 1900 einige Umbauten an. 1888 gab es zunehmende Proteste der
Nachbarn bei der Synagoge, da im Synagogengebäude keine Toilette vorhanden war
und diese darunter zu leiden hatten. Im Synagogengebäude ließ sich freilich
keine Toilette einrichten, da für eine hierzu notwendige Grube Ochsenwirt Kunz
keine Fläche seines Grundstückes abzutreten bereit war. 1890 wurde eine
Einigung gefunden. Die in der Nachbarschaft lebende Witwe von Salomon David
gestattete gegen eine regelmäßige kleine Vergütung, dass ihre Toilette zu den
Gebets- und Gottesdienstzeiten der Synagoge zur Mitbenutzung offen stand. Die nächste
bauliche Veränderung wurde seit 1894 diskutiert, als das Bezirksamt
beanstandete, dass die beiden Aufgänge zur Frauenempore so schmal (75 cm)
seien, dass kaum eine Person unbeengt alleine durch den Gang und über die
Treppen sich bewegen könne. Dabei seien die Treppen auch noch so steil und aus
Holz gebaut, was auch aus feuerpolizeilichen Gründen unzulässig war. Das
Bezirksamt brachte einen Vorschlag zur Verlegung der Treppe ein, wodurch jedoch
zehn Männerplätze des Betsaales verloren gegangen wären. Der Synagogenrat
schlug seinerseits zunächst vor, ganz auf den Umbau zu verzichten und endlich
einen Neubau der Synagoge in Angriff zu nehmen. Da dies auch damals auf Grund
der Finanzierung keine schnell zu verwirklichende Lösung war, entschloss man
sich, nach Plänen des Ortsbaumeisters Reichert, die vom Bezirksamt noch überarbeitet
wurden, im Sommer 1897 neue Treppen zur Frauenempore herstellen zu lassen.
Letztmals wurde die Synagoge 1928 renoviert.
Am 23. Juni 1934 wurde noch
feierlich eine neue Torarolle eingeweiht, worüber die Zeitschrift
"Der Israelit" berichtete:
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. August 1934: "Malsch
bei Ettlingen, 23. Juli (1934). Eine seltene Feier erlebte am Heiligen
Schabbat Paraschat Chukat (Schabbat mit der Toralesung Chukat,
d.i. 4. Mose 19,1 - 22,1, das war Schabbat, 23. Juni 1934) unsere
Gemeinde. Durch eine größere Spende der hiesige Chewra Gemillut
Chassodim (Wohltätigkeitsverein) und einen Zuschuss der 'Freien
Vereinigung' war es möglich, eine Torarolle neu schreiben zu lassen.
Nachdem die einzelnen Gemeindemitglieder am Vortrage den letzten Absatz zu
Ende geschrieben hatten, wurde die neue Torarolle am Heiligen
Schabbat Paraschat Chukat feierlich unter Vorantragung sämtlicher
Torarollen in die geschmückte Synagoge eingeführt. Herr Bezirksrabbiner
Dr. Ucko aus Offenburg hielt eine weihevolle Ansprache. Die Feier
hinterließ bei allen Anwesenden einen tiefen Eindruck. - Die Torarolle
wurde von dem bekannten Sofer Herr Chaim Färber, Frankfurt am Main
geschrieben und fand allseitig höchstes Lob." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. August 1934: "Malsch
bei Ettlingen, 23. Juli (1934). Eine seltene Feier erlebte am Heiligen
Schabbat Paraschat Chukat (Schabbat mit der Toralesung Chukat,
d.i. 4. Mose 19,1 - 22,1, das war Schabbat, 23. Juni 1934) unsere
Gemeinde. Durch eine größere Spende der hiesige Chewra Gemillut
Chassodim (Wohltätigkeitsverein) und einen Zuschuss der 'Freien
Vereinigung' war es möglich, eine Torarolle neu schreiben zu lassen.
Nachdem die einzelnen Gemeindemitglieder am Vortrage den letzten Absatz zu
Ende geschrieben hatten, wurde die neue Torarolle am Heiligen
Schabbat Paraschat Chukat feierlich unter Vorantragung sämtlicher
Torarollen in die geschmückte Synagoge eingeführt. Herr Bezirksrabbiner
Dr. Ucko aus Offenburg hielt eine weihevolle Ansprache. Die Feier
hinterließ bei allen Anwesenden einen tiefen Eindruck. - Die Torarolle
wurde von dem bekannten Sofer Herr Chaim Färber, Frankfurt am Main
geschrieben und fand allseitig höchstes Lob." |
Vier Jahre nach dieser Einweihung einer
Torarolle ist die Synagoge beim Novemberpogrom 1938 am Nachmittag des 10. November 1938
angezündet und zerstört worden. Mitglieder des SA-Sturms 3/111 aus Gaggenau
waren mit einigen NSDAP- und SA-Führer aus dem Kreis nach der Zerstörung der
Kuppenheimer Synagoge nach Malsch weitergefahren und hatten hier ihr
verbrecherisches Tun fortgesetzt.
1939 ist die Synagogenruine beseitigt, das Grundstück verkauft worden. Am ehemaligen Synagogenstandort in der Hauptstrasse 26 befinden sich seit 1985 eine
Hinweistafel und seit 1988 ein Erinnerungsmal.
Fotos
Historische Fotos:
(Quelle: W. Widemann: Malscher Antlitz S. 176 (Foto oben
links); Malscher Leben S. 251 (Fotos zweite Zeile))
 |
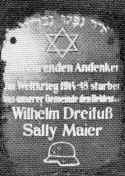 |
Die Synagoge in Malsch,
Aufnahmedatum nicht bekannt
|
Gedenktafel für die beiden aus Malsch gefallenen jüdischen Soldaten des
Ersten Weltkrieges (Quelle: Hundsnurscher/Taddey s. Lit. Abb. 133) |
| |
|
 |
 |
 |
Die Demolierung
der Malscher Synagoge am 10. November 1938. Torarollen, Bücher und
rituelle Gegenstände werden in den
Hof oder in den nahen Bach geworden.
Die Malscher beobachten die Ereignisse von der Hauptstrasse aus.
Die
Volksschüler erhielten schulfrei, um das Zerstörungswerk beobachten zu
können. |
| |
|
|
Die in Auschwitz ermordeten Sigmund
und Klara Maier (Foto: in Malsch
1937)
sowie
ihr Sohn und späterer Autor von Büchern
zur jüdischen Geschichte in
Malsch:
Dr. Louis Maier |
 |
 |
|
Aus dem Buch von Louis Maier:
"From the
Golden Gate to the Black Forest" s.Lit. |
Dr. Louis Maier
(Quelle) |
Fotos nach 1945/Gegenwart:
Fotos um 1985:
(Fotos: Hahn) |
 |
 |
| |
Der ehemalige Synagogenstandort, noch ohne Gedenkstein |
| |
|
Fotos 2003:
(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum: 16.9.2003) |
|
 |
 |
 |
Gebäude Hauptstraße 26 (an
der
Durchfahrt befindet sich die
nebenstehende Hinweistafel) |
Hinweistafel für die
ehemalige
Synagoge an der Durchfahrt
Gebäude Hauptstraße 26 |
Der ehemalige
Synagogenstandort;
hinter dem dunklen Auto ist der
Gedenkstein |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Gedenkstein für die ehemalige
Synagoge |
| |
| |
Ehemaliges jüdisches Haus
in Malsch (Adlerstraße 72) -
abgebrochen im April 2018 |
 |
 |
| Eines der
früheren jüdischen Wohnhäuser am Ort war das Gebäude Adlerstraße 72,
das zur Anlage eines Parkplatzes im April 2018 abgebrochen wurde; am Torbogen war noch die Spur einer Mesusa zu sehen.
In dem Haus wohnten bis zur Deportation nach Gurs am 22. Oktober 1940 Löb
Maier (1877-umgekommen in Gurs 1941) und seine Frau Berta (1877-?,
überlebte Gurs und übersiedelte 1947 in die USA). Vor dem Haus wurde
2012 ein "Stolperstein" für Löb Maier verlegt. Das Foto
rechts unten zeigt den Torbogen (Schlussstein und Teil mit Mesusa) nach
dem Abbruch (Quelle der Fotos: "Heimatfreunde Malsch e.V., Günter
Heiberger). |
| |
 |

 |
| |
|
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.
1968. S. 18-19. |
 | Louis Maier:
In Lieu of Flowers. In Memory of the Jews of Malsch, a Village in Southern
Germany. Los Colinas TX/USA 1985.
Informationen über dieses Buch: siehe englische
Website.
deutsche Ausgabe:
 Louis
Maier: Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit. Ein Sohn spricht vom Leben und Schicksal der Jüdischen Gemeinde in Malsch. Louis
Maier: Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit. Ein Sohn spricht vom Leben und Schicksal der Jüdischen Gemeinde in Malsch.
Zum Andenken an die Juden in Malsch erzählt Louis Maier Geschichten über das dörfliche Leben, von Familie, Freunden und Nachbarn, vom Zusammenleben von Juden und Nichtjuden, von der Schule, dem Leben zu Hause und von der jüdischen Lebensweise. Gleichzeitig schildert er mit bemerkenswerter Einfachheit und Ehrlichkeit die Realität jener Zeit: von der sich abzeichnenden und dann eskalierenden Nazi-Brutalität bis hin zur Deportation der Juden, die damit endet, dass das Dorf im Oktober 1940 für "judenfrei" erklärt wurde.
Hrsg. von der Gemeinde Malsch. Übersetzt aus dem Englischen von Sally
Laws-Werthwein und Donald Werthwein.
192 S. mit 44 Abb. ISBN-10: 3-89735-133-1 / ISBN-13: 978-3-89735-133-2.
€ 14,90. Website des Verlages
Regionalkultur. |
| |
 Louis
Maier: From the Golden Gate to the Black Forest. The Odyssey of
A New American in Search of His Parents' Fate. Louis
Maier: From the Golden Gate to the Black Forest. The Odyssey of
A New American in Search of His Parents' Fate.
Published by Schreiber Publishing. ISBN-13:
978-0-88400-330-4 ISBN-10: 0-88400-330-2 $
24.95.
Informationen über dieses Buch: siehe englische
Website.
|
| |
 Deutsche
Ausgabe des oben genannten Buches: Louis Maier:
Empfänger unbekannt verzogen. Die Odyssee eines jungen Flüchtlings auf den Spuren des Schicksals seiner Eltern. Deutsche
Ausgabe des oben genannten Buches: Louis Maier:
Empfänger unbekannt verzogen. Die Odyssee eines jungen Flüchtlings auf den Spuren des Schicksals seiner Eltern.
Nach seiner geglückten Flucht aus Nazi-Deutschland im Herbst 1940 erlebt der 16-jährige Louis Maier mit seiner Schwester Agathe aus Malsch bei Karlsruhe den Beginn eines neuen, geschenkten Lebens in den USA. Eindrucksvoll beschreibt er den Alltag in ihm fremden Lebenswelten. Gleichzeitig kontrastiert er seinen eigenen hoffnungsvollen Neubeginn mit den Briefen seiner Eltern aus dem KZ Gurs, in das die badischen Juden im Oktober 1940 deportiert worden waren. In der Korrespondenz spiegeln sich die Mühen um die Organisation der Ausreise der Eltern. Briefe als Lebensfäden, die schließlich mit der Deportation der Eltern im August 1942 tragisch enden. Louis Maiers Schreiben an seine Eltern kommen nun mit der Aufschrift
'Empfänger unbekannt verzogen' zurück. Als amerikanischer Soldat kehrt Louis Maier 1945 nach Europa zurück und erlebt die Schrecken der letzten Kriegsphase. Nach Kriegsende verfolgt er die Spuren des Schicksals seiner Eltern. Seine Suche führt ihn 1946 für kurze Zeit in seine badische Heimat Malsch. Diese Erinnerungen eines jüdischen Jugendlichen sind ein in dieser Intensität erschütterndes, einzigartiges Dokument.
Hrsg. von der Gemeinde Malsch. Übersetzt aus dem Englischen von Sally
Laws-Werthwein und Donald Werthwein. 320 S. mit 42 Abb., fester Einband. 2008.
ISBN 978-3-89735-543-9. EUR 18,90 Bestellmöglichkeit beim
Verlag
Regionalkultur - Zu
diesem Buch
|
|
 | Jürgen Stude: Geschichte der Juden im Landkreis
Karlsruhe. 1990. |
 | Wilhelm Wildemann: Malscher Antlitz. Eine Art
Bestandsaufnahme 1987. Malsch 1987. |
 | ders.: Malscher Leben. Malsch 1991. |
 | Joseph Walk (Hrsg.): Württemberg - Hohenzollern -
Baden. Reihe: Pinkas Hakehillot. Encyclopedia of Jewish Communities from
their foundation till after the Holocaust (hebräisch). Yad Vashem Jerusalem
1986. S. 370-371. |
 |  Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim
Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als
Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte
und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,
Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,
Jerusalem. Stuttgart 2007. |
 |  Jüdisches
Leben in Malsch. Hrsg.: Heimatfreunde Malsch e.V.. Reihe: Malscher
Historischer Bote Band 3. Malsch 2009. ISBN 3-931001-01-6. Jüdisches
Leben in Malsch. Hrsg.: Heimatfreunde Malsch e.V.. Reihe: Malscher
Historischer Bote Band 3. Malsch 2009. ISBN 3-931001-01-6. |
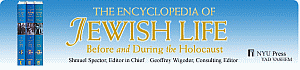
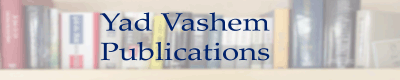
Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Malsch bei Karlsruhe
Baden. Jews first settled during the Thirty Years War (1618-48). With the
lifting of residence restrictions in the early 19th century, the community began
to expand, reaching a peak population of 320 in 1875 (total 3,544). In the early
20th century nearly half the Jews were cattle traders. In 1933, 89 remained. On Kristallnacht
(9-10 November 1938), jewish homes and stores were heavily damaged and the
synagogue was burned. Fifty-seven Jews were able to emigrate; the last 20 were
deported to the Gurs concentration camp on 22 October 1940. Five who sailed on
the St. Louis were let off in Belgium after months at sea and died in Auschwitz.
Of the survivors, seven were hidden by the French underground.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|