|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia
Judaica
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und
bestehende) Synagogen
Übersicht:
Jüdische Kulturdenkmale in der Region
Bestehende
jüdische Gemeinden in der Region
Jüdische
Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur
und Presseartikel
Adressliste
Digitale
Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Schweiz"
Zürich (Kanton
Zürich, Schweiz)
Die Israelitische Religionsgesellschaft Zürich (IRGZ)
und ihre Synagoge in der Freigutstraße
Übersicht:
Zur Geschichte der Israelitischen Religionsgesellschaft Zürich
Die Israelitische Religionsgesellschaft in Zürich entstand 1895.
Damals taten sich einige orthodoxe Mitglieder aus der Israelitischen Cultusgemeinde
zusammen, da sie den Gebrauch eines Harmoniums und die Einführung eines gemischten
Chorgesangs im Gottesdienst ablehnten. Wenige Jahre zuvor war von den aus
Frankfurt am Main stammenden und von der dortigen Religionsgesellschaft im
Geiste Samson Raphael Hirsch geprägten Herren Josua Goldschmidt und Josef
Ettlinger zusammen mit Isidor Kohn (aus Baden bei Wien) das erste
orthodox geprägte Minjan in Zürich gründetet worden. Die drei jungen Männer, die in Zürich in Stellung waren,
konnten auf Grund ihrer orthodoxen Einstellung am Gottesdienst der bestehenden
Zürcher Gemeinde nicht teilnehmen. Sie fanden Verständnis und
Gesinnungsgemeinsamkeit in dem Züricher Leopold Weill, der einen Raum in seiner
Wohnung zur Verfügung stellte. Am 22. Februar 1890, dem Schabbat Paraschat Teruma
wurde in Weills Wohnung ein erster orthodoxer Gottesdienst abgehalten.
Dass sich dafür die nötige Zehnzahl fand, beweist das Vorhandensein einer Anzahl
Gleichgesinnter aus den Reihen der Gemeindeglieder der Cultusgemeinde. Das Minjan verblieb einige Monate
im Hause des Herrn Leopold Weill und wurde dann in den Saal des damaligen
'Schützengartens' verlegt. An die Gottesdienste der Gruppe schlossen sich regelmäßige
Lern-Schiurim an. Im August 1895 wurde die Religionsgesellschaft
schließlich durch die Herren
Gabriel Bernheim,
Leon Bloch, A. Gutmann, Raphael Lang, Hermann Weill, Joseph Weill und
Leopold Weill gegründet. Zunächst wollte man als Verein eigene
Gottesdienste abhalten, jedoch weiterhin in der Israelitischen Cultusgemeinde verbleiben.
Leopold Weill selbst gilt als "Gründer und
geistiger Vater der Israelitischen Religionsgesellschaft" (siehe
unten: Bericht zu seinem Tod 1927).
Das Bestehen der Religionsgesellschaft innerhalb der Israelitischen
Cultusgemeinde führte jedoch mit der Zeit zu Spannungen innerhalb der Gemeinde, die
mit den auf einer Generalversammlung der jüdischen Gemeindeglieder am 2. Mai
1896 verabschiedeten Beschlüssen für beide Seiten befriedigend geklärt
werden sollten. In den Kreisen des damaligen Vorstandes der Israelitischen
Cultusgemeinde gab es jedoch eine Mehrheit, die die Beschlüsse zu
Ungunsten der Religionsgesellschaft auslegen beziehungsweise nur sehr unwillig
umsetzen wollten, worauf es in den folgenden beiden Jahren zu einer längeren
Auseinandersetzung kam, die schließlich zur Abspaltung und Gründung einer von
der Cultusgemeinde unabhängigen Israelitischen Religionsgesellschaft 1898
führte (siehe unten den ausführlichen Bericht aus der Zeitschrift "Der
Israelit" von 1898).
Um 1900 gehörten etwa 25 Familien der Religionsgemeinschaft an. Die Zahl
stieg rasch an: 1916 wurden 84 Mitglieder (Familien) mit zusammen etwa 370
Personen gezählt, 1921 114 Familien mit zusammen etwa 600 Personen.
Kurze Zeit nach Gründung der Religionsgesellschaft wurde nach Kauf des
Friedhofgeländes Steinkluppe im Jahr 1899 ein eigener Friedhof
angelegt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde wurde noch 1899 als Kantor
der Gemeinde M. Hurwitz angestellt. Drei
Jahre später wurde Rabbiner Armon Kornfein zum Rabbiner und Lehrer der
Gemeinde bestimmt.
An jüdischen Kantoren / Lehrern beziehungsweise weiteren Kultusbeamte
(vor allem Schochetim, siehe einige Ausschreibungen der Stellen bis in die
1920er-Jahre unten) waren in der Religionsgesellschaft tätig: ab 1904 (Ausschreibung
der Stelle siehe unten) als Kantor, Lehrer und Schochet Ignaz Kurzweil, ab 1908 Kantor und Lehrer
Josef Messinger, 1913
bis 1933 Schochet David Uscherowitz, ab 1914 Kantor und Lehrer D. (in
anderen Listen auch H. oder A.) Wallach, ab
1921 Kantor und Lehrer Hermann Lieber, 1927 bis 1940 Schochet Herr
Bleck, von
1929 bis 1972 Lehrer und Kantor Max Ruda, 1930 bis 1955 Lehrer Pinchas
Blumberg,
1944 bis 1972 Lehrer Dr. David Kolman, 1945 bis 1966 Schochet Efraim
Rowinsky,
1952 bis 1991 Schochet Josef Krakauer, 1955 Schochet Nathan Wieder, 1956 bis
1995 Lehrer Dr. Samuel Adler, 1956 bis 1990 Lehrer Zwi Zaler, ab 1973 Lehrer
Jizchok Wolokarsky.
Als Rabbiner waren in der Religionsgesellschaft tätig:
- 1902 - 1959 Rabbiner Armin Kornfein (geb. 1869 in Lackenbach,
Ungarn, gest. 1959 in Zürich), besuchte die Rabbinerschule in Pressburg (heute
Bratislava); 1892 nach Baden umgezogen; 1896 zum Lehrer, ab 1902 zum Rabbiner an
der Israelitischen Religionsgesellschaft berufen.
- 1912 - 1940 Rabbiner Tobias Lewenstein (geb. 1863 Paramaribo,
Surinam, gest. 1953 bei Montreux): studierte in Amsterdam und Berlin; zunächst
Rabbiner in Leeuwarden (Friesland), 1903 Oberrabbiner in Kopenhagen; 1912 bis
1940 (zweiter) Rabbiner der IRGZ.
- 1947 - 1972 Rabbiner Dr. Theodor Weiss (Weisz) (geb. 1908 in
Emden, gest. 1987 in Zürich): studierte 1928 bis 1932 in Berlin und Bonn,
danach an der Jeschiwa in Mir; 1937 bis 1938 Oberrabbiner von Altona und
Schleswig-Holstein; Dezember 1938 Flucht nach England, zunächst Internierung
auf der Isle of Man, später Rabbiner in Luton bei London und in Blackburn bei
Manchester; seit März 1947 zweiter Rabbiner der IRGZ , 1972 Ruhestand.
- 1972 - 1994 Rabbiner Daniel Levy
seit 2007 Rabbiner Chaim Moische Levy
Die Israelitische Religionsgesellschaft schuf zahlreiche Einrichtungen, um ihren
Gemeindegliedern und den anderen jüdischen Einwohnern sowie Gästen der Stadt
ein toratreues jüdisches Leben zu ermöglichen. 1907 wurde ein eigener
Metzgereibetrieb mit Fleisch- und Wurstverkauf (auch Versandgeschäft) eröffnet
(vgl. Anzeige unten von 1917). 1915 wurde ein neues rituelles Bad (Mikwe)
eingeweiht (Anwandstraße).
1945 feierte die Israelitische Religionsgesellschaft ihr 50-jähriges Bestehen,
1995 ihr 100-jähriges Bestehen.
Aktuelle Informationen zur Israelitischen Religionsgesellschaft Zürich siehe
deren Website www.irgz.ch.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens
(vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die
1930er-Jahre)
Die israelitische Religionsgesellschaft trennt sich von der Israelitischen
Cultusgemeinde (1898)
Anmerkung: in der orthodox geprägten Zeitschrift "Der Israelit"
erschien 1898 als Leitartikel in sieben Teilen eine ausführliche Darstellung
der Vorgänge, die dazu führten, dass die Israelitische Cultusgemeinde und die
Israelitische Religionsgesellschaft von nun an getrennte Wege
gingen. Auch wenn damals das Verhältnis zwischen den Gemeinden zeitweise sehr
angespannt war, konnte zum Zeitpunkt der Einweihung der Synagoge der
Religionsgesellschaft 1924 wieder von einem "friedlichen und herzlichen
Verhältnis zwischen Kultusgemeinde und Religionsgesellschaft"
gesprochen werden (siehe unten).
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 23. Juni 1898: "Die israelitische Religionsgesellschaft
und der Vorstand der Cultusgemeinde - Zürich. Von einem Mitglieder der
Züricher Cultusgemeinde. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 23. Juni 1898: "Die israelitische Religionsgesellschaft
und der Vorstand der Cultusgemeinde - Zürich. Von einem Mitglieder der
Züricher Cultusgemeinde.
Zürich, im Juni (1898). Die Vorgänge in der hiesigen
Cultusgemeinde und das Verhältnis der israelitischen
Religionsgesellschaft zu ihr sind in jüngster Zeit so oft und so dreist
in tendenziöser Weise entstellt worden, dass eine wahrheitsgemäße
Darstellung der ganzen Sachlage kaum einer Rechtfertigung bedarf. -
Die hiesige ca. 266 Mitglieder zählende Gemeinde hat in vielen
wesentlichen Punkten das von den Vätern überkommene Judentum verlassen
und ist nach der offiziellen Erklärung ihres eigenen Vorstandes eine
liberal-reformjüdische, das Gros der Mitglieder entweiht öffentlich
Sabbat und Feiertag, und setzt sich über die fundamentalsten sonstigen
Satzungen der Tora und des rabbinischen Judentums hinweg. Die
Gemeindeinstitutionen entsprechen der religiösen respektive unreligiösen
Richtung der Mitglieder. Die Synagoge und ihr Gottesdienst haben durch ein
christliches Kircheninstrument, durch den religionsgesetzlich
verbotenen gemischten Chor ihren jüdischen Charakter eingebüßt.
Der Jugendunterricht ist von den maßgebenden Faktoren selbst wiederholt
als ungenügend bezeichnet worden, und die Beaufsichtigung des
Koscherfleischverkaufs ist eine so unzulängliche, dass von Zeit zu Zeit
die unglaublichsten Dinge an die Öffentlichkeit gelangen. Eine Mikwe hat
die Gemeinde bis auf den heutigen Tag nicht und ebenso wenig besaß sie
bis vor zwei Jahren die Einrichtung, dass jemand, der an den Werktagen
seine 'Jahrzeit' begehen sollte, in der Orgelsynagoge ein Minjan vorfand,
um Kaddisch sagen zu können.
Wir heben diese Missstände nicht hervor, um daraus eine Klage über die
Gemeinde und ihre Leiter zu konstruieren; vielmehr lediglich deshalb um zu
konstatieren, wie die wenigen orthodoxen Mitglieder im Laufe der Jahre in
der Gemeindeversammlung um Besserung dieser Zustände und um eine auch
noch so bescheidene Berücksichtigung petitionierten und wiederholt mit
lautem Hohn und Spott von der Majorität abgewiesen wurden.
Länger als 10 Jahre war Herr Leopold Weill der einzige, der
wenigstens am Sabbat und Festtage ein Minjan unterhielt, um auf den
unjüdischen Gottesdienst in der Synagoge nicht angewiesen zu sein. Die
Verspottung und Verdächtigung, welchen diejenigen ausgesetzt waren, die
an diesem Minjan teilnahmen, hielt manche gleichgesinnte, achtungswerte
Gemeindemitglieder lange Zeit zurück, bis sich nunmehr vor drei Jahren
einige Herren fanden, die zu einer Gesellschaft zusammentraten, um sich
die Möglichkeit zu schaffen, nach der Weise der Väter zu beten, dem Religionsgesetz
gemäß zu leben und ihre Kinder dafür gewinnen und erhalten zu
können.
Diese Herren sind - bis auf eine einzige Ausnahme - Mitglieder der Cultusgemeinde.
Sie taten |
 keinen
Schritt, der auch nur einen Schein von oppositionellem Charakter gegen die
Cultusgemeinde gehabt hätte. Sie zahlten ihre Gemeinde-Beiträge nach wie
vor; sie verlangten keine Subvention für ihre mit beträchtlichen
pekuniären Opfern beschafften Einrichtungen, kurz, sie wollten nichts,
als die ihnen von der Cultusgemeinde versagte Möglichkeit als Juden leben
zu können, sich aus eigenen Mitteln schaffen. Das suchte der
Cultusvorstand zu hintertreiben. - Er schlug der Gemeindeversammlung vor
zu beschließen, dass die Statuten der Cultusgemeinde wie folgt geändert
werden sollen: keinen
Schritt, der auch nur einen Schein von oppositionellem Charakter gegen die
Cultusgemeinde gehabt hätte. Sie zahlten ihre Gemeinde-Beiträge nach wie
vor; sie verlangten keine Subvention für ihre mit beträchtlichen
pekuniären Opfern beschafften Einrichtungen, kurz, sie wollten nichts,
als die ihnen von der Cultusgemeinde versagte Möglichkeit als Juden leben
zu können, sich aus eigenen Mitteln schaffen. Das suchte der
Cultusvorstand zu hintertreiben. - Er schlug der Gemeindeversammlung vor
zu beschließen, dass die Statuten der Cultusgemeinde wie folgt geändert
werden sollen:
'Mitglieder, welche sich einer anderen Cultusgemeinde (bezw.
Genossenschaft) auf dem Platze Zürich anschließen, können auf Antrag
des Vorstandes durch die Generalversammlung aus der Gemeinde ausgeschlossen
werden.'
Die Aufregung, welche dieses Ansinnen zur Folge hatte, spiegelte sich in
mehreren damals erschienenen Flugblättern wieder. Es möge hier ein
Passus aus einem solchen Blatte folgen, dessen Verfasser (ein Mitglied der
Cultusgemeinde) nicht zur Religions-Gesellschaft gehört:
'Was will die israelitische Religionsgesellschaft bezwecken? Sie will,
dass ein täglich regelmäßig zweimaliger Gottesdienst stattfinde; sie
will Gemilus-Chesed schel Emes üben, indem sie Leidtragenden und
Jahrzeithaltenden Gelegenheit gibt, Kaddisch zu sagen; sie will, dass die
bestehenden Mängel in der Fleischversorgung gehoben werden; sie will,
dass der Jugendunterricht verbessert werden soll; sie will, dass die
rituellen Bedürfnisse erfüllt werden können.
Für alles dieses opfert sie durch die Bereitwilligkeit ihrer Mitglieder
nicht allein Zeit und Geld, sondern sie bietet die Mitbenützung ihrer
Einrichtungen jedem in Zürich wohnenden Israeliten an, ohne von der
Hauptgemeinde irgend welche Entschädigung zu beanspruchen, und dafür
soll die Gemeinde nach dem Antrage des Vorstandes, diese ihre
steuerzahlenden und allen sonstigen Pflichten seit langen Jahren in
regelmäßiger Weise nachkommenden Mitgliedern auszuschließen berechtigt
sein! Kann es wohl eine größere Inkonsequenz, ein widersinnigeres,
unmoralischeres Vorhaben geben?'
Diese Inkonsequenz wurde dennoch begangen und das unerhörte Ansinnen des
Vorstandes von der Generalversammlung zum Beschluss erhoben. Aber in Folge
des energischen, gerichtlichen Protestes der Herren, welche auf diese
Weise von der Gemeinde ausgeschlossen werden sollten, scheint dem
Kultusvorstand doch eine Ahnung des Unerhörten aufgegangen zu sein, das
sein Antrag bedeutete. Er ließ sich in Friedens-Verhandlungen ein, die
aber zu keinem Resultate führten.
Er diktierte den Frieden in zehn Paragraphen, die sich wie zehn Gebote
lesen, deren paschamäßiger Ton aber wenig geeignet war, den Glauben an
die Friedensliebe des Vorstandes zu festigen.
Erst durch die Bemühung einzelner Gemeindemitglieder, die in der Tat den
Frieden um jeden Preis wollten, gelang es in der Generalversammlung vom 2.
Mai 1896 ein volles, allseitiges Einverständnis zu erzielen und folgender
Vertrag wurde von beiden Parteien unterzeichnet.
Die Generalversammlung vom 2. Mai 1896
'In Erwägung, dass bei einigen Mitgliedern der Gemeinde das Bedürfnis
nach einem Gottesdienst vorhanden ist, welcher in wesentlichen Dingen sich
von dem in der Kultusgemeinde geführten Gottesdienst unterscheidet; in
Erwägung ferner, dass dieselben Mitglieder das Verlangen nach einem
umfassenderen Unterricht ihrer Kinder haben, als er gegenwärtig in der Religionsschule
der Gemeinde erteilt wird; in der ferneren Erwägung, dass dieselben
Mitglieder mit den rituellen Fleischverhältnissen nicht zufrieden sind,
wie sie gegenwärtig in der Gemeinde beschaffen sind; und endlich in dem
Bestreben, den Frieden in der Gemeinde zu erhalten'
beschließt:
1) Die israelitische Cultusgemeinde errichtet, sobald das neue Schulhaus
fertiggestellt ist, einen Gottesdienst, welcher den Bedürfnissen der
Eingangs erwähnten Mitgliedern entspricht, also ohne Harmonium oder
dergleichen und ohne gemischten Chor; sie selbst stellt die hierzu
nötigen Lokalitäten, worin die Plätze jährlich vermietet werden und
unterhält die Beamten und sonstigen Einrichtungen; die Überwachung
besorgt die Gemeinde respektive der Vorstand; die Leitung übernimmt die
Synagogenkommission unter Zuzug von drei Mitgliedern, die jenen
Gottesdienst regelmäßig besuchen. Sollte der projektierte Neubau auf
Rosch-haschonoh 1898 nicht beziehbar sein, so stellt die Gemeinde
anderweitige Lokalitäten mit der nötigen Einrichtung zu diesem
Zeitraum.
2) Die israelitische Cultusgemeinde überlässt zu demselben Zeitpunkt
unentgeltlich denjenigen Mitgliedern, die einen eigenen Religionsunterricht
für ihre Kinder einrichten, ein geeignetes Unterrichts-Lokal.
3) Die israelitische Cultusgemeinde stellt es demjenigen der
Gemeindemitglieder, die gegen die Metzgerverhältnisse der Gemeinde
religiöse Bedenken haben, frei von Auswärts Fleisch zu beziehen oder
kollektiv beziehen zu lassen.
4) Die israelitische Cultusgemeinde wird die Einrichtungen, die sich zur
Zeit im Besitze des Herrn R. Lang und Genossen befinden, soweit dieselben
für die Einrichtung des neuen Lokals brauchen kann, gegen billige und
gerechte Entschädigung ankaufen. 5) Dieser Beschluss der
Generalversammlung darf während 25 Jahren nciht abgeändert werden,
solange zehn Mitglieder in der Gemeinde daran festhalten.
(Unterschriften)." |
| |
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 27. Juni 1898: Fortsetzung: "II. Mit dieser die
Cultusgemeinde und die Religionsgesellschaft bindenden Vereinbarung ist
ein Wendepunkt eingetreten, dessen Würdigung umso notwendiger ist, als
der Gemeindevorstand der konkreten Verwirklichung und Ausführung dieses
Einverständnisses noch bis zur Stunde auf Schritt und Tritt Schwierigkeiten
bereitet und sich dabei einen Anschein gibt, als seien die Friedensstörer
nicht bei ihm, sondern weit von ihm weg zu suchen. Diesen falschen Schein
möchte diese Darstellung an der Hand unleugbarer Tatsachen darstellen,
als das was es ist. - Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 27. Juni 1898: Fortsetzung: "II. Mit dieser die
Cultusgemeinde und die Religionsgesellschaft bindenden Vereinbarung ist
ein Wendepunkt eingetreten, dessen Würdigung umso notwendiger ist, als
der Gemeindevorstand der konkreten Verwirklichung und Ausführung dieses
Einverständnisses noch bis zur Stunde auf Schritt und Tritt Schwierigkeiten
bereitet und sich dabei einen Anschein gibt, als seien die Friedensstörer
nicht bei ihm, sondern weit von ihm weg zu suchen. Diesen falschen Schein
möchte diese Darstellung an der Hand unleugbarer Tatsachen darstellen,
als das was es ist. -
Nehmen wir einen Augenblick an, es habe am 2. Mai 1896 keine
Generalversammlung stattgefunden und es existiere somit auch kein die
Cultusgemeinde und die Religionsgesellschaft bindender Vertrag. Aber es
sei auf Seiten des Gemeindevorstandes das loyale Bestreben wirklich
vorhanden den Frieden innerhalb der Gemeinde wieder herzustellen, wäre
ihm dann sein Weg nicht zweifellos vorgeschrieben? Wenn man die an sich
klare Sachlage nicht künstlich verwirrt, so liegt sie doch so:
Der Vorstand und die große Mehrheit der Cultusgemeinde bekennen sich zum
Reformjudentum, was in offenkundigster Weise in dem Gemeindegottesdienst
offiziell zum Ausdruck kommt, der den Satzungen des überlieferten Religionsgesetzes
nicht entspricht.
Ein Teil der Gemeindemitglieder, die in der von den Väter überkommenen
Weise beten und einen dem überlieferten Religionsgesetz entsprechenden
Gottesdienst wünschen, ist deshalb zu einer besonderen Gesellschaft
zusammengetreten. Hält der Vorstand eine solche Gesellschaft im Interesse
des Gemeindefriedens nicht für wünschenswert, er möchte aber auch seine
Hand nicht zu einem Gewissenszwang gegen Männer bieten, die nichts
vollen, als in derselben Weise zu Gott beten, wie es auch die Eltern und
Großeltern des Kultusvorstandes taten, so braucht er der Gemeinde nur
folgendes zu unterbreiten: 'Wir haben in unserer Mitte zwei Richtungen,
von welchen die eine der Orthodoxie huldigt. Für das religiöse
Bedürfnis der Majorität ist durch unsere Synagoge gesorgt, wir wollen
unseren orthodoxen Mitgliedern auch einen orthodoxen Gottesdienst stellen,
welcher ihren Bedürfnissen genügt.' Damit wären alle Differenzen
beseitigt. - Nun hängt aber dieser Ausgleich der Zwistigkeiten heute
nicht mehr vom guten Willen des Vorstandes ab, sondern die Cultusgemeinde
ist durch den Beschluss der Generalversammlung vom 2. Mai 1896 dazu
verpflichtet.
Wie der Gemeindevorstand dieser Verpflichtung sich entziehen möchte, wie
er Ecken und Schwierigkeiten sucht, um ihr aus dem Wege zu gehen und sie
illoyaler Weise zu erfüllen, wie er Wahrheit und Recht mit Füßen
getreten - Tatsachen - in dreister, gehässiger Weise entstellt und
erdichtet hat - und wie auch der Gemeinderabbiner Dr. Littmann dem
Willen des Vorstandes sich unterstellt, und seinem Vorgehen die
tatkräftigste Unterstützung gewährt hat -, das ist dem Gros der
Gemeinde leider nicht bekannt, und soll deshalb an der Hand folgender
Tatsachen dargelegt werden. - Die Art und Weise, wie sich jemand in
Geldangelegenheiten benimmt, wird mit Recht als Maßstab zur Beurteilung
seines Charakters angesehen. Es möge daher ein an und für sich
geringfügiger Umstand hier ausgeschickt werden. Wenn es sich bei der
Regelung des Verhältnisses zwischen Cultusgemeinde und
Religions-Gesellschaft seitens des Gemeinde-Vorstandes wirklich um eine
schwerwiegenden prinzipielle Konzession gehandelt hätte, so wäre
anzunehmen, dass er in Geldsachen umso kulanter verfahren, je zäher und unnachgiebiger
er in Prinzipienfragen erscheint. Das Gegenteil ist aber hier der Fall. In
Prinzipien hat der Gemeindevorstand mit sich handeln lassen, aber in
Geldsachen hat er, um einen gelingen Ausdruck zu gebrauchen, sich -
kleinlich erwiesen.
Die Cultusgemeinde hat sich in der Generalversammlung vom 2. Mai 1896
verpflichtet, die Einrichtung des Betsaales der Religionsgesellschaft für
die Einrichtung des neuen Lokals gegen billige und gerechte Entschädigung
anzukaufen.
Am 29. April hat sich im Auftrag des der Gemeindevorstandes Schreiner
Schneidel die Utensilien auf 3.800-3.900 Frcs. geschätzt. Am 18. Mai
offeriert der Vorstand 3.000 Frcs. für die ganze Einrichtung, am 30. Mai
3.500 Frcs.
In einer Zuschrift des Herrn Leopold Weill weist dieser Herrn Präsident
Leopold Bollag nach, dass sich der Werk der Gegenstände auf 4.500
verläuft, der Gemeindevorstand verbleibt trotzdem in einem Schreiben vom
2. Juli 1897 bei seiner Offerte.
Ob diese Art und Weise der Verhandlung billig |
 und
gerecht ist, ob sie geeignet ist, den Glauben an die Friedensliebe des
Vorstandes zu festigen, kann dem unbefangenen Urteil ruhig anheim gegeben
werden, ganz so wie das eigenartige Gebaren des Vorstandes in der
Behandlung des eigentlichen Differenzpunktes. und
gerecht ist, ob sie geeignet ist, den Glauben an die Friedensliebe des
Vorstandes zu festigen, kann dem unbefangenen Urteil ruhig anheim gegeben
werden, ganz so wie das eigenartige Gebaren des Vorstandes in der
Behandlung des eigentlichen Differenzpunktes.
Die israelitische Cultusgemeinde hat in der Generalversammlung vom 2. Mai
die Verpflichtung übernommen, einen Gottesdienst einzurichten, welcher
den Bedürfnissen der Mitglieder der Religionsgesellschaft
entspricht.
Es liegt auf der Hand, dass die Religionsgesellschaft mit ihrer
Einrichtung ihren bisherigen Gottesdienst nicht aufgeben wollte, ohne die
bündige Zusage zu haben, dass ihr nun ein Gottesdienst, welcher den
Bedürfnissen ihrer Mitglieder entspricht, auch wirklich eingerichtet
werde. Daran wird am Ende eines größeren Schreibens der
Religionsgesellschaft an den Gemeinde-Vorstand vom 22. Mai 1897 durch
folgende Worte erinnert:
'Hieran anknüpfend, erlauben wir uns auch gleichzeitig aufmerksam zu
machen, dass, damit der eingerichtete Gottesdienst, wie nachträglich
vorgesehen, den Mitgliedern entspricht, auch ein Synagogen-Regelement
unerlässlich ist. Hierbei ist mir gestattet, Ihnen mitzuteilen, dass wir
gerne bereit sind, ein solches aufzustellen.'
Man kann wohl kaum zahmer und bescheidener sein klar verbrieftes Recht zur
Sprache bringen, als es hier geschehen ist. Es kann auch keinem Zweifel
unterliegen, dass niemand auf der Welt die religiösen Bedürfnisse der
betreffenden Mitglieder besser kennt als sie selber, und dass, falls man
ihnen wirklich in ehrlicher Weise Rechnung tagen will, man nicht nur in
erster, sondern in einziger Reihe sie und nur sie darüber hören muss.
Sollten die Bedürfnisse der Mitglieder in dem von ihnen zu entwerfenden Reglement
wirklich staatsgefährliche oder gegen die guten Sitten verstoßende Allüren
enthalten, so könnte ja der Gemeindevorstand dagegen einschreiten, falls
ihm die Polizei nicht damit zuvorkäme.
In seiner Antwort vom 30. Mai nimmt der Vorstand von der Offerte eines
Reglements seitens der Religionsgesellschaft keine Notiz, sondern gibt die
Mitteilung hinaus:
'Ein besonderes Reglement für diesen Gottesdienst wird nächstens von der
erweiterten Synagogen-Kommission ausgearbeitet werden. - In Fernerem
teilen wir Ihnen mit, dass wir für das Vorbeteramt im neuen Betlokal
Herrn Lehrer Strauß vorgesehen haben.'
Auf diese Zumutung antwortete die Religionsgesellschaft unterm 8.
Juni:
'Zur Aufstellung eines Regelements dürfen wohl jene Mitglieder in
erster Linie gehört werden; diesem Reglement muss auch der Passus
beigefügt sein, der von jenen Personen spricht, die in diesem
Gottesdienst funktionieren können usw.'
Der wesentliche Teil des von der Religionsgesellschaft vorgelegten
Reglements sind die folgenden §§:
'§ 5. Diejenigen, welche gottesdienstliche Funktionen in der Synagoge
verrichten, müssen durch die erforderlichen Kenntnisse und ihre ganze
Führung sich dazu qualifizieren. Wer den Sabbat und die Speisegesetze
verletzt, eine Orgel-Synagoge besucht, und sonst vom Synagogenvorstand als
nicht würdig erachtet wird, kann weder als Vorbeter, noch sonst zur
Ausübung einer Funktion zugelassen werden. Ausgenommen davon, ist nur der
Vortrag des Kadisch-Gebets für Leidtragende. Hiervon sind nur diejenigen
ausgeschlossen, welche ohne Tefillin sich beim Gebete zu einer Zeit
befinden, wo das Anlegen von Tefillin vorgeschrieben ist. Solche dürfen
auch nicht zur Tora aufgerufen werden.
§ 15. Der Synagogenvorstand besteht aus drei Mitgliedern. In diesen
Vorstand sind nur solche Gemeindemitglieder wählbar, die die Synagoge
regelmäßig besuchen, die Sabbat und Speisegesetze beobachten, die
Orgelsynagoge nicht besuchen und auch sonst sich eines unbescholtenen
Rufes erfreuen.
§ 17. Alle Anordnungen und Beschlüsse des Vorstandes haben nur Geltung,
wenn sie den Bestimmungen des jüdischen Religionsgesetzes wie es in den
maßgebenden rabbinisches Codices und speziell im Schulchan-Aruch kodifiziert
ist, nicht widersprechen." |
| |
|
|
|
Die weiteren Teile werden nicht
ausgeschrieben, können jedoch durch Anklicken der Textabbildungen gelesen
werden. |
Artikel in der Zeitschrift
"Der Israelit"
vom 4. Juli 1898 (Teil III) |
 |
 |
| |
|
|
Artikel in der Zeitschrift
"Der Israelit"
vom 14. Juli 1898 (Teil IV) |
 |
 |
| |
|
|
Artikel in der Zeitschrift
"Der Israelit"
vom 21. Juli 1898 (Teil V) |
 |
 |
| |
|
|
Artikel in der Zeitschrift
"Der Israelit"
vom 1. September 1898 (Teil VI) |
 |
 |
| |
|
|
Artikel in der Zeitschrift
"Der Israelit"
vom 8. September 1898 (Teil VII)
(Hinweis: trotz der Bemerkung "Schluss folgt" am Ende des
Abschnittes gab es keinen weiteren Artikel zu dieser Thematik) |
 |
 |
Gemeindevorstellungen 1916,
1917 und
1921
 Gemeindevorstellung
im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz" Jahrg. 1916 S.
202-203: Gemeindevorstellung
im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz" Jahrg. 1916 S.
202-203:
"Zürich. Zürich zählt heute über 5.000 jüdische Seelen.
Nahezu die Hälfte sind eingewanderte Juden aus dem Osten. Es bestehen in
Zürich die Israelitische Kultusgemeinde, die Israelitische
Religionsgesellschaft sowie viele Privatorganisationen und Minjonim.
...
Israelitische Religionsgesellschaft:
Im Jahre 1895 ist die Israelitische Religionsgesellschaft gegründet worden,
welche heute mit 84 Gemeindemitgliedern ca. 370 Seelen zählt. Vorstand:
Hermann Barth, S. Dreyfuss, Max Mannes, Jos. Rosenblatt, Max Kahn. Beamte:
Rabbiner Dr. Th. Levenstein; Rabbiner A. Kornfein, A. Wallach, Kantor;
Schneider, Synagogendiener. Institutionen: Synagoge (Füsslistraße
8), Religionsschule (Sihlstraße), Friedhof, Rituelles Bad.
..." |
| |
 Gemeindevorstellung
im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz" Jahrg. 1917 S.
230: "Israelitische Religionsgesellschaft.
Im Jahre 1895 ist die Israelitische Religionsgesellschaft gegründet
worden, welche heute 84 Gemeindemitglieder mit ca. 400 jüd. Seelen
zählt. Gemeindevorstellung
im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz" Jahrg. 1917 S.
230: "Israelitische Religionsgesellschaft.
Im Jahre 1895 ist die Israelitische Religionsgesellschaft gegründet
worden, welche heute 84 Gemeindemitglieder mit ca. 400 jüd. Seelen
zählt.
Vorstand: Hermann Barth, Präsident; Mitglieder: S. Dreyfuss, Max
Mannes, Joseph Rosenblatt, Max Kahn.
Beamte: Rabbiner Dr. T. Lewenstein; Rabb. A. Kornfein; D. Wallach,
Kantor; A. Schneider, Kultusbeamter.
Institutionen: Synagoge (Füsslistrasse 8), Religionsschule (Sihlstrasse),
Friedhof (beim Spitalfriedhof), Rituelles Bad (Anwandstrasse 60),
Metzgereien (Hornergasse und Löwenstrasse)." |
| |
 Gemeindevorstellung
im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz" Jahrg. 1921 S.
185-187: "Zürich. Zürich zählt heute ca. 7.000 Seelen.
Es bestehen in Zürich die Israelitische Kultusgemeinde, die Israelitische
Religionsgesellschaft, die jüdische Gemeinde Agudas Achim sowie viele
Privatorganisationen und Minjonim. Gemeindevorstellung
im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz" Jahrg. 1921 S.
185-187: "Zürich. Zürich zählt heute ca. 7.000 Seelen.
Es bestehen in Zürich die Israelitische Kultusgemeinde, die Israelitische
Religionsgesellschaft, die jüdische Gemeinde Agudas Achim sowie viele
Privatorganisationen und Minjonim.
---
Israelitische Religionsgesellschaft Zürich.
Im Jahre 1895 ist die Israelitische Religionsgesellschaft gegründet
worden, welche heute 114 Gemeindemitglieder mit ca. 600 Seelen zählt. - Vorstand:
S. Teplitz, Präsident; Mitglieder: Joseph Brandeis; Jakob Gut jun.; Jos.
Rosenblatt; Sally Harburger. Beamte: Dr. Th. Lewenstein und A.
Kornfein, Rabbiner; Hermann Lieber, Kantor und Religionslehrer; A.
Schneider, Kultusbeamter.
Institutionen der israelitischen
Religionsgesellschaft: Synagoge, Neumühlequai. -
Religionsschule, Brandschenkestrasse 20. - Friedhof (beim Spitalfriedhof).
- Rituelles Bad (Anwandstraße 60). - Metzgereien (Hornergasse). - Chewra
Kadischah (Präsident B. Rotschild).
...". |
Aus
der Geschichte des Rabbinates der Israelitischen Religionsgesellschaft
Ausschreibung der Rabbinerstelle der Religionsgesellschaft
(1911)
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 7. Dezember 1911: "In unserer Gemeinde ist eine Rabbinerstelle
zu besetzen. Wir reflektieren auf einen streng orthodoxen Herrn, der
bedeutendes talmudisches und profanes Wissen besitzt und guter Redner ist.
Fixer Gehalt 6.000 Francs. Zürich, 20. November 1911. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 7. Dezember 1911: "In unserer Gemeinde ist eine Rabbinerstelle
zu besetzen. Wir reflektieren auf einen streng orthodoxen Herrn, der
bedeutendes talmudisches und profanes Wissen besitzt und guter Redner ist.
Fixer Gehalt 6.000 Francs. Zürich, 20. November 1911.
Israelitische Religionsgesellschaft. Eugen Lang, Endlitz,
Präsident." |
Einführung der Rabbiner Dr. Tobias Lewenstein als (2.)
Rabbiner der
Israelitischen Religionsgesellschaft (1912)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 30. August
1912: "Zürich. Rabbiner Dr. Lewenstein, der tapfere
ehemalige Kopenhagener Oberrabbiner, ist feierlichst in sein Amt als
Rabbiner der hiesigen Religionsgesellschaft eingeführt worden. Seine
Antrittspredigt zeigte, dass er ein ganz hervorragender Redner
ist." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 30. August
1912: "Zürich. Rabbiner Dr. Lewenstein, der tapfere
ehemalige Kopenhagener Oberrabbiner, ist feierlichst in sein Amt als
Rabbiner der hiesigen Religionsgesellschaft eingeführt worden. Seine
Antrittspredigt zeigte, dass er ein ganz hervorragender Redner
ist." |
| |
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. September
1912: "Zürich, 28. August (1912). Zu einem Festsabbat
gestaltete sich die Einführung des neuen Rabbiners, Herrn Dr.
Lewenstein - früher Oberrabbiner in Kopenhagen- in der hiesigen
israelitischen Religionsgesellschaft. Nach einem erhebenden, von Herrn
Oberkantor Messinger geleiteten und von dem neuen Chor wirksam
unterstützten Gottesdienste wurde dem neuen Seelsorger durch den 1.
Präsidenten, Herrn Eugen Lang, ein in herzlichen Worten gehaltener
Willkommengruß zugerufen. In der darauf folgenden Antrittspredigt wusste
Herr Dr. Lewenstein, dem schon der Ruf eines glänzenden Kanzelredners
vorausging, seine Zuhörer so zu fesseln, dass sie in tiefer Ergriffenheit
den geistvollen Ausführungen folgten." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. September
1912: "Zürich, 28. August (1912). Zu einem Festsabbat
gestaltete sich die Einführung des neuen Rabbiners, Herrn Dr.
Lewenstein - früher Oberrabbiner in Kopenhagen- in der hiesigen
israelitischen Religionsgesellschaft. Nach einem erhebenden, von Herrn
Oberkantor Messinger geleiteten und von dem neuen Chor wirksam
unterstützten Gottesdienste wurde dem neuen Seelsorger durch den 1.
Präsidenten, Herrn Eugen Lang, ein in herzlichen Worten gehaltener
Willkommengruß zugerufen. In der darauf folgenden Antrittspredigt wusste
Herr Dr. Lewenstein, dem schon der Ruf eines glänzenden Kanzelredners
vorausging, seine Zuhörer so zu fesseln, dass sie in tiefer Ergriffenheit
den geistvollen Ausführungen folgten." |
Vortrag von Rabbiner Dr. T. Lewenstein in Luzern (1928)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1928: "Luzern,
2. Dezember (1928). Vor einem für hiesige Verhältnisse ganz
außerordentlich zahlreichem Publikum sprach Herr Dr. Th. Lewenstein
aus Zürich am 1. Dezember, abends, über das Thema: 'Die rechtliche
Stellung der jüdischen Frau'. Er trat der vielfach verbreiteten
Auffassung von der Minderwertigkeit der jüdischen Frau in rechtlicher
Beziehung entgegen, indem er an Hand zahlreicher Zitate aus dem jüdischen
Schrifttum bewies, dass es sich nur um eine geringere Verpflichtung der
Frau handle, die bedingt sei durch die vom Manne verschiedene
Lebensaufgabe und Konstitution. - Im besonderen trat der Referent auf die
diesbezüglichen Fragen der Heirat und der Scheidung, der Fähigkeit,
Zeugnis abzulegen und der Glaubwürdigkeit, des Wahlrechtes und der
Mizwoserfüllung ein. Er kam zum Schlusse, dass es nach der Tauroh (Tora)
keine Frauenbewegung im 'modernen Sinne' geben dürfe, höchstens eine
Mädchenbewegung. - Die Diskussion, geleitet vom Vorsitzenden, Herrn
Dr. Guggenheim, wurde von verschiedenen Damen und Herrn benützt und
trug noch wesentlich zur Klärung des Problems bei. - Der klare, anregende
Vortrag, rhetorisch meisterhaft aufgebaut, bei der Schilderung des
Aufgabenkreises der Frau an das jüdische Gemüt appellierend, wurde von
den zahlreichen Anwesenden mit großem Beifall aufgenommen. Das mag dem
Referenten ein Beweis dafür sein, dass ein baldiges Wiedererscheinen im
Kreise der Agudas-Jisroel-Ortsgruppe einem allgemeinen Wunsche
entspricht." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1928: "Luzern,
2. Dezember (1928). Vor einem für hiesige Verhältnisse ganz
außerordentlich zahlreichem Publikum sprach Herr Dr. Th. Lewenstein
aus Zürich am 1. Dezember, abends, über das Thema: 'Die rechtliche
Stellung der jüdischen Frau'. Er trat der vielfach verbreiteten
Auffassung von der Minderwertigkeit der jüdischen Frau in rechtlicher
Beziehung entgegen, indem er an Hand zahlreicher Zitate aus dem jüdischen
Schrifttum bewies, dass es sich nur um eine geringere Verpflichtung der
Frau handle, die bedingt sei durch die vom Manne verschiedene
Lebensaufgabe und Konstitution. - Im besonderen trat der Referent auf die
diesbezüglichen Fragen der Heirat und der Scheidung, der Fähigkeit,
Zeugnis abzulegen und der Glaubwürdigkeit, des Wahlrechtes und der
Mizwoserfüllung ein. Er kam zum Schlusse, dass es nach der Tauroh (Tora)
keine Frauenbewegung im 'modernen Sinne' geben dürfe, höchstens eine
Mädchenbewegung. - Die Diskussion, geleitet vom Vorsitzenden, Herrn
Dr. Guggenheim, wurde von verschiedenen Damen und Herrn benützt und
trug noch wesentlich zur Klärung des Problems bei. - Der klare, anregende
Vortrag, rhetorisch meisterhaft aufgebaut, bei der Schilderung des
Aufgabenkreises der Frau an das jüdische Gemüt appellierend, wurde von
den zahlreichen Anwesenden mit großem Beifall aufgenommen. Das mag dem
Referenten ein Beweis dafür sein, dass ein baldiges Wiedererscheinen im
Kreise der Agudas-Jisroel-Ortsgruppe einem allgemeinen Wunsche
entspricht."
|
Aus der Geschichte der Lehrer / Kantoren und weiteren Kultusbeamten
Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1904 /
1907 / 1920 / 1928 / 1934
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar
1904: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar
1904:
"Israelitische Religionsgesellschaft Zürich.
In unserer Gemeinde ist per sofort die Stelle eines streng orthodoxen Chasan,
gebildeten Lehrers und Schächters zu besetzen. Gehalt Frs. 2.000
bis Frs. 2.500 per Jahr. Bewerbungen nebst Zeugnisabschriften sind zu
richten an
F. Lang, Zürich, Usteristraße 15." |
| |
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. April 1907: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. April 1907:
Die israelitische Religionsgesellschaft Zürich sucht zum sofortigen
Antritt einen
Chasan,
der auch den Religions-Unterricht in den unteren Klassen zu übernehmen
und in Ausnahmefällen den Schochet zu vertreten hat. Fixes Gehalt
Fr. 2.400.- per Jahr. Bewerber, welche Referenzen gesetzestreuer Rabbiner
aufzuweisen haben, wollen ihre Offerten mit Zeugnisabschriften an
Herrn S. Teplitz, Zürich (Schweiz)
richten." |
|
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Januar 1920: "Die
Israelitische Religions-Gesellschaft Zürich Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Januar 1920: "Die
Israelitische Religions-Gesellschaft Zürich
sucht für möglichst sofort einen Lehrer und Chasan
bei festem Gehalt von Francs 7.000 bis 8.000 per anno.
Reflektanten streng orthodoxer Richtung mit gediegenem jüdischem Wissen
und pädagogischer Befähigung, die auch über ausreichende Stimmmittel
verfügen, wollen ihre Meldungen mit näheren Angaben richten an den
Präsidenten
Hermann Barth, Zürich, Steinmühlengasse 12." |
| |
 Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Dezember
1928: "Die Israelitische Religionsgesellschaft,
Zürich Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Dezember
1928: "Die Israelitische Religionsgesellschaft,
Zürich
sucht eine erste Kraft als Religionslehrer und Vorbeter,
verheiratete bevorzugt. Als Jahresgehalt wird in Aussicht genommen: für
unverheiratete Fr. 8-10.000 und für verheiratete Fr. 10-12.000. Streng
orthodoxe Kandidaten, welche sich über erfolgreiche Tätigkeit ausweisen
können, wollen ausführliche Offerten mit Referenzen richten an den Präsidenten
Herrn Jos. Ettlinger, Zürich, Sternenstraße 11." |
Lehrer Max Ruda (bisher in Wilhelmshaven) wechselt als Religionslehrer und Kantor
nach Zürich
(1929)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April 1929: "Wilhelmshaven,
5. April (1929). Herr Lehrer Max Ruda, der seit 7 Jahren mit warmer
Hingabe und reichem Erfolg hier wirkte, hat eine ehrenvolle Berufung als Religionslehrer
und Kantor nach Zürich erhalten. Die gesamte Gemeinde wird ihn mit
lebhaftem Bedauern scheiden sehen, wenn er, zum 1. Oktober, dem Rufe Folge
leistet." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April 1929: "Wilhelmshaven,
5. April (1929). Herr Lehrer Max Ruda, der seit 7 Jahren mit warmer
Hingabe und reichem Erfolg hier wirkte, hat eine ehrenvolle Berufung als Religionslehrer
und Kantor nach Zürich erhalten. Die gesamte Gemeinde wird ihn mit
lebhaftem Bedauern scheiden sehen, wenn er, zum 1. Oktober, dem Rufe Folge
leistet." |
P. Blumenberg wird Lehrer bei der Israelitischen
Religionsgesellschaft (1930)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
26. Juni 1930: "Zürich, 15. Juni (1930). Die Israelitische
Religionsgesellschaft dahier hat den bewährten langjährigen Lehrer der
Talmud-Thora der Agudas Achim, P. Blumenberg, als Lehrer an ihre
Gemeinde berufen." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
26. Juni 1930: "Zürich, 15. Juni (1930). Die Israelitische
Religionsgesellschaft dahier hat den bewährten langjährigen Lehrer der
Talmud-Thora der Agudas Achim, P. Blumenberg, als Lehrer an ihre
Gemeinde berufen." |
Aus der Geschichte der
jüdischen Schule
Die "Israelitische Religionsgesellschaft denkt an
den Bau einer eigenen Schule (1901)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober
1901: "Zürich, 3. Oktober (1901). (Israelitische Schulen).
Die 'Israelitische Religionsgesellschaft' hierselbst projektiert mit
Beginn des nächsten Schuljahres die Schaffung einer eigenen Schule. Es
geschieht dies namentlich aus dem Grunde, weil die Schulbehörden den
Schulbesuch am Samstag obligatorisch erklärten." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober
1901: "Zürich, 3. Oktober (1901). (Israelitische Schulen).
Die 'Israelitische Religionsgesellschaft' hierselbst projektiert mit
Beginn des nächsten Schuljahres die Schaffung einer eigenen Schule. Es
geschieht dies namentlich aus dem Grunde, weil die Schulbehörden den
Schulbesuch am Samstag obligatorisch erklärten." |
Berichte zu
einzelnen Personen aus der Gemeinde
Zum Tod von Leopold Weill (1927)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
10. Oktober 1927: "Zürich, 4. Oktober (1927). Letzten
Donnerstag haben wir auf dem Friedhof der Israelitischen
Religionsgesellschaft Leopold Weill zu Grabe getragen. Ein Baal-Habajis
(Hausvater), vorbildlich in Begeisterung für die Ausübung jüdischen
Pflichtenlebens ist mit ihm dahingegangen. Vor 40 Jahren nach Zürich
übergesiedelt, vertrat er hier mit seinem ganzen Sein den Glauben und die
Tradition, die sein Elternhaus in Kippenheim (Baden) ihn gelehrt. Als Mann
von Tat und Zielbewusstsein öffnete er sein Haus jungen Leuten und lieh
sein Ohr neuen Wünschen und Anregungen. Jahrelang unterhielt er ein
eigenes Minjan, förderte einen allwöchentlichen Schiur (Lehrvortrag) und
ermöglichte so vielen, nach altehrwürdigem Brauch zu beten und zu leben.
Er erstellte als erster eine Sukkoh (Laubhütte) in Zürich und selbst die
Erde, die nach fast 80-jährigem Erdenwallen seine Gebeine nun
umschließt, ist erworben auf seinen Namen und dank seiner angestrengten
Bemühung. Kein Hindernis vermochte ihn zu hemmen im Erstreben seines
Zieles, und so wurde er der eigentliche Gründer und geistige Vater der
Israelitischen Religionsgesellschaft. Eine sinnige Ehrung bedeutete es
deshalb, wenn man Leopold Weill vor vier Jahren den ersten Hammerschlag
zur Grundsteinlegung des Synagogenbaus führen ließ. An der Bahre sprach
zuerst Herr Rabbiner Kornfein, sodann dankte Herr Ettlinger
im Namen der Gemeinde, erzählte von Zeiten, wo er und mancher
Gesinnungsfreund im Hause Weills für alle jüdische Interessen auf
weitgehendes Verständnis stießen. Mit Leopold Weill schwang ein
lebensechtes Beispiel wahrer Emunoh aus unserer Mitte. Sein Andenken wird
in der Geschichte der Gemeinde ein gesegnetes bleiben. Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
10. Oktober 1927: "Zürich, 4. Oktober (1927). Letzten
Donnerstag haben wir auf dem Friedhof der Israelitischen
Religionsgesellschaft Leopold Weill zu Grabe getragen. Ein Baal-Habajis
(Hausvater), vorbildlich in Begeisterung für die Ausübung jüdischen
Pflichtenlebens ist mit ihm dahingegangen. Vor 40 Jahren nach Zürich
übergesiedelt, vertrat er hier mit seinem ganzen Sein den Glauben und die
Tradition, die sein Elternhaus in Kippenheim (Baden) ihn gelehrt. Als Mann
von Tat und Zielbewusstsein öffnete er sein Haus jungen Leuten und lieh
sein Ohr neuen Wünschen und Anregungen. Jahrelang unterhielt er ein
eigenes Minjan, förderte einen allwöchentlichen Schiur (Lehrvortrag) und
ermöglichte so vielen, nach altehrwürdigem Brauch zu beten und zu leben.
Er erstellte als erster eine Sukkoh (Laubhütte) in Zürich und selbst die
Erde, die nach fast 80-jährigem Erdenwallen seine Gebeine nun
umschließt, ist erworben auf seinen Namen und dank seiner angestrengten
Bemühung. Kein Hindernis vermochte ihn zu hemmen im Erstreben seines
Zieles, und so wurde er der eigentliche Gründer und geistige Vater der
Israelitischen Religionsgesellschaft. Eine sinnige Ehrung bedeutete es
deshalb, wenn man Leopold Weill vor vier Jahren den ersten Hammerschlag
zur Grundsteinlegung des Synagogenbaus führen ließ. An der Bahre sprach
zuerst Herr Rabbiner Kornfein, sodann dankte Herr Ettlinger
im Namen der Gemeinde, erzählte von Zeiten, wo er und mancher
Gesinnungsfreund im Hause Weills für alle jüdische Interessen auf
weitgehendes Verständnis stießen. Mit Leopold Weill schwang ein
lebensechtes Beispiel wahrer Emunoh aus unserer Mitte. Sein Andenken wird
in der Geschichte der Gemeinde ein gesegnetes bleiben. Seine Seele sei
eingebunden in den Bund des Lebens." |
Zum Tod von Bertha Mannes, eine "der frömmsten,
kostbarsten Frauen in Israels Mitte" (1929)
Anmerkung: Bertha Mannes war die Frau des langjährigen Vorstandsmitgliedes
der Religionsgesellschaft, Max Mannes.
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 31. Januar 1929: "Frankfurt am Main, 24. Januar (1929). Aus
Zürich kommt die Nachricht von dem Heimgang der Frau Bertha Mannes.
Eine kurze 'Israelit' - Annonce gibt davon Kunde - und in den Herzen
aller, die die Frau kannten, lebt auf ein tiefes, tiefes Klagen um den
jähen Heimgang einer der frömmsten, kostbarsten Frauen in Israels Mitte.
Die Frau eines Frommen - ist sie nicht wie der Fromme selbst? lehrt
die Halacha, indem sie der Frau das gleiche Maß religiöser
Zuverlässigkeit zuerkennt wie dem frommen Gatten. Die Frau eines
Frommen - ist sie nicht wie der Fromme selbst? pflegen wir
auszusprechen, wenn wir eine edle Frau an der Seite ihre Mannes, seine
Leistung ergänzend und vertiefend, wirken sehen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 31. Januar 1929: "Frankfurt am Main, 24. Januar (1929). Aus
Zürich kommt die Nachricht von dem Heimgang der Frau Bertha Mannes.
Eine kurze 'Israelit' - Annonce gibt davon Kunde - und in den Herzen
aller, die die Frau kannten, lebt auf ein tiefes, tiefes Klagen um den
jähen Heimgang einer der frömmsten, kostbarsten Frauen in Israels Mitte.
Die Frau eines Frommen - ist sie nicht wie der Fromme selbst? lehrt
die Halacha, indem sie der Frau das gleiche Maß religiöser
Zuverlässigkeit zuerkennt wie dem frommen Gatten. Die Frau eines
Frommen - ist sie nicht wie der Fromme selbst? pflegen wir
auszusprechen, wenn wir eine edle Frau an der Seite ihre Mannes, seine
Leistung ergänzend und vertiefend, wirken sehen.
Wer Max Mannes in Zürich kennt, diesen wahrhaft Frommen, wer weiß
von seiner Leistung für die Seinen, für die Züricher orthodoxe Kehillo
(gemeint die Religionsgesellschaft), für Agudas Jisroel, für die Armen,
für jeden Armen, wer sein Haus, das Gastfreundschaft ohnegleichen übt,
je betrat, wer ihn bei der Erziehung seiner Kinder beobachtete, der weiß,
wenn irgendwo, so galt in dieser Ehe: Die Frau eines Frommen - ist sie
nicht wie der Fromme selbst?, an der Leistung des Mannes hatte die
Frau ihren reichen, vollen Anteil diese Frau, die die Grundlage des
Hauses, des Hauses Grund und Giebel war, diese Frau, die fröhliche
Mutter der Kinder (Psalm 113,9), Freude und Glück nur im Gedeihen der
Ihren, des Gatten, der Kinder, der Enkel fand, darin - und im unentwegten
Üben der Mizwot (Gebote), dann sie war klugen Sinnes und wer
klugen Sinnes ist, nimmt die Mizwot an (Sprüche 10,8).
Wer Frau Bertha Mannes, in deren Haus, während des Krieges und nach dem
Kriege besonders, jeder einkehrte, den eine jüdische Sache nach Zürich
führte, nur oberflächlich kannte, auch der merkte schon, dass hier eine
starke und edle Kraft sinnvoll wirkte, wer aber erst näher, ganz nahe ihr
treten durfte, der erst wusste, dass das eine Frau war, gesegnet vor
Frauen im Zelte (Richter 5,24), in der lebte von dem Segen der großen
Mütter unseres Volkes, jener Mutterschaft der Welt, deren Güte
und Liebe alles Leid der Welt verklärte und meisterte. Wer Frau Bertha
Mannes näher kannte, der stand in Ehrfurcht vor dieser Persönlichkeit,
die in steter Selbsterziehung sich zu immer höheren Formen jüdischer
Vollendung hinaufentwickelte, zu reinster Frömmigkeit, zu festestem
Gottvertrauen. Wer Frau Bertha Mannes näher kannte, der wusste, dass sie
vom Besten ihrer Persönlichkeit in die Herzen ihrer Kinder gepflanzt und
dass diese nicht zuletzt deshalb schon in jungen Jahren zu reifen Menschen
gewachsen sind, die, ob schon im eigenen Heim, ob noch im Elternhaus, voll
sind von Liebe zur Tora und jederzeit bereit zu opfervollem Dienste
an der Gesamtheit Israels.
Groß ist darum der Verlust und groß die Trauer. Und wir erheben auch aus
der Ferne die Stimme mitgefühlten Schmerzes die Fernen haben es
gehört und kommen und setzen die Krone des guten Namens aufs
Haupt der edlen Frau und bewahren mit den Ihren das Gedächtnis
dieser Frommen, halten ihr Andenken heilig, lassen ihr Vorbild uns zum
Mahner werden und ihre Leistung zu ewig in uns lebendiger segenbringender Moral.
Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens."
|
Zum Tod von Salomon Teplitz, früher Präsident der
Israelitischen Religionsgesellschaft und des Misrachi in Zürich (1934)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
26. April 1934: "Tel Avv, 19. April (1934). Salomon Teplitz
in Tel Aviv, früher Präsident der Israelitischen Religionsgesellschaft
und des Misrachi in Zürich, ist, 69 Jahre alt, aus seinem
gesegneten Erdenleben abberufen worden. Tepitz's Denken und Fühlen
gehörte dem Volke, der Thora und dem Lande Israel in der harmonischen
Vereinigung dieses dreifachen Knotens. Als Teplitz vor einigen Jahren sein
schönes Haus in Tel Aviv einweihte, dankte er Gott für diese Gnade und
gelobte, sein ganzes ideelles und materielles Können der Förderung des
Tora-Judentums im Lande der Tora für das Volk der Tora zu widmen. Seit
einem Jahre hinderte den aktiven Mann ein ungünstiger Gesundheitszustand
an der Aktivität. Diese schmerzlich gefühlte Zurückhaltung wurde nur
durch die Hoffnung gelindert, dass seine Kinder seine Absichten als
heiliges Vermächtnis übernehmen werden. In der Erziehung einer toratreuen
Jugend sah er die Entscheidung für das Gelingen des jüdischen
Aufbauwerkes in Erez Israel. Mögen seine Kinder im Sinne ihres Vaters
sich dieser heiligen Aufgabe weihen. Seine Seele sei eingebunden in den
Bunde des Lebens. S. Geis." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom
26. April 1934: "Tel Avv, 19. April (1934). Salomon Teplitz
in Tel Aviv, früher Präsident der Israelitischen Religionsgesellschaft
und des Misrachi in Zürich, ist, 69 Jahre alt, aus seinem
gesegneten Erdenleben abberufen worden. Tepitz's Denken und Fühlen
gehörte dem Volke, der Thora und dem Lande Israel in der harmonischen
Vereinigung dieses dreifachen Knotens. Als Teplitz vor einigen Jahren sein
schönes Haus in Tel Aviv einweihte, dankte er Gott für diese Gnade und
gelobte, sein ganzes ideelles und materielles Können der Förderung des
Tora-Judentums im Lande der Tora für das Volk der Tora zu widmen. Seit
einem Jahre hinderte den aktiven Mann ein ungünstiger Gesundheitszustand
an der Aktivität. Diese schmerzlich gefühlte Zurückhaltung wurde nur
durch die Hoffnung gelindert, dass seine Kinder seine Absichten als
heiliges Vermächtnis übernehmen werden. In der Erziehung einer toratreuen
Jugend sah er die Entscheidung für das Gelingen des jüdischen
Aufbauwerkes in Erez Israel. Mögen seine Kinder im Sinne ihres Vaters
sich dieser heiligen Aufgabe weihen. Seine Seele sei eingebunden in den
Bunde des Lebens. S. Geis." |
Anzeigen
Anzeige eines unter der Aufsicht des Rabbinats der
Religionsgesellschaft stehenden Lebensmittelgeschäftes (1917)
 Anzeige
im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz", Jg. 1917 S. 247:
"Koscher Lebensmittel-Geschäft 'Oekonomie'. En
gros - En détails. L. Schmerling, Zürich 4, Müllerstraße
69. Anzeige
im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz", Jg. 1917 S. 247:
"Koscher Lebensmittel-Geschäft 'Oekonomie'. En
gros - En détails. L. Schmerling, Zürich 4, Müllerstraße
69.
Unter Ausicht des Rabbinats der Israleitischen
Religionsgesellschaft.
'Teston', Bouillon- und Minnichwürfel, Cocosnussfett, Speiseöl,
Albert-Biscuit, Teigwaren, Conserven, Confitäre, Cichorie, Tafel-Butter,
Käse, Kos.Seife.
Palästina- und Walliser-Weine.
Alleinverkauf und Niederlage von basar hergestellt sämtlichen
Artikel bei den best bekannten Fabriken:
Teigwaren- und Testonfabrik Wenger & Hug A.-G., Gümligen. 'Ola',
Biscuit-Fabrik, Altstetten.
Mont-d'or-Weine Johannisberg, weltbekannte Marke." |
Anzeige für den Fleisch- und Wurstverkauf der
israelitischen Religionsgesellschaft Zürich (1917)
 Anzeige
im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz", Jg. 1917 S. 250:
"Fleisch- und Wurstverkauf Anzeige
im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz", Jg. 1917 S. 250:
"Fleisch- und Wurstverkauf
der israelitischen Religionsgesellschaft Zürich.
Hornergasse 7 mit Filiale Löwenstraße 12. Telephon Selnau
4802- Postcheckrechnung VIII 4624 empfiehlt jederzeit
ff. Wurst und Fleischwaren aller Art.
Koscher - Prompter Versand nach auswärts - Koscher." |
Zur Geschichte der Synagoge
Orthodox geprägte Gottesdienste wurden seit 1890 in einem von Leopold Weill
zur Verfügung gestellten Betraum abgehalten
werden. Dieser hatte einen privaten Minjan eingerichtet, um nicht auf die
"unjüdischen" Gottesdienste mit Harmonium und gemischtem Chor
angewiesen zu sein.
Nach einer am 2. Mai 1896 abgehaltenen Generalversammlung sollte die
Israelitische Cultusgemeinde der Israelitischen Religionsgesellschaft einen Betsaal
im 1897 entstandenen Anbaus des Schulhauses an der
Synagoge Löwenstraße zur Verfügung stellen. Nach der Abspaltung der
Religionsgesellschaft von der Cultusgemeinde 1898 wurden in der Folgezeit bis
zur Einweihung der Synagoge 1924 verschiedene Beträume benutzt: 1898
bis 1900 im Gebäude In Gassen 10, 1900 bis 1910 Löwenstraße 32, 1910 bis 1912
Zeughausstraße 5, 1912 bis 1918 Füsslistraße 8, 1918 bis 1922 Neumühlequai /
Walchestraße, 1922 bis 1924 Gartenstraße 10.
Im Januar 1909 beschloss eine Generalversammlung der
Religionsgesellschaft die möglichst baldige Finanzierung und den Bau einer
Synagoge. 1910 wurde nach einem vorliegenden Pressemitteilung zum
Synagogenbau ein Grundstück erworben. Um welches Grundstück es sich gehandelt
hat, wird nicht mitgeteilt. Nach den vorliegenden Berichten wurde das
Synagogengrundstück an der Freigutstraße erst 1917 erworben, sodass
möglicherweise ein zunächst erworbenes Grundstück wieder verkauft worden ist.
Kauf eines Grundstückes zum Bau einer Synagoge (1910)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. August 1910:
"Die israelitische Religionsgesellschaft in Zürich hat ein
Grundstück zum Preise von 280.000 Francs erworben, um darauf eine zweite
Synagoge zu errichten." Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. August 1910:
"Die israelitische Religionsgesellschaft in Zürich hat ein
Grundstück zum Preise von 280.000 Francs erworben, um darauf eine zweite
Synagoge zu errichten." |
Der Bau der neuen Synagoge wurde 1923 bis 1924 durchgeführt. Sie
wurde nach Plänen der Züricher Architekten Walter Henauer und Ernst Witschi
erstellt. Sie hatten bereits die Friedhofshalle auf dem Friedhof der
Israelitischen Religionsgesellschaft erstellt. Bei dem 1918 durchgeführten
Architektenwettbewerb war ihr Vorschlag zu dem Bau der Synagoge an der
Freigutstraße jedoch nicht prämiiert worden. Dennoch erhielten sie
schließlich den Auftrag zum Bau der Synagoge.
Der Synagogenbau hat begonnen (1923)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. September 1923: "Zürich.
Wir lesen im 'Israelitischen Wochenblatt für die Schweiz': Der Synagogenbau
der Israelitischen Religionsgesellschaft hat, wie schon in letzter
Nummer kurz mitgeteilt, seit kurzem begonnen. Die Energie und der Opfermut
dieser Gemeinde, die in der jetzigen, doch sicherlich nicht glänzenden
Zeit zum Bau einer Synagoge übergeht, sind bewundernswert. Dabei darf
man, angesichts der leitenden Persönlichkeiten der Gemeinde, ohne
Weiteres annehmen, dass die Finanzierung des Baues von Grund auf eine
solide ist. Das Grundstück, 2.000 qm groß, am Ende der Freigutstraße
zur Sihl hin, seitlich durch die Sihlamtstraße begrenzt, hat eine ideale
Lage. Zu beiden Seiten der Synagoge bleibt prächtiger, schattiger Baumbestand
stehen. Der Bauplan selbst weist eine überraschend gute Idee auf: Der Bau
wird zugleich sowohl das Bethaus entstehen lassen wie auch Schulräume und
Versammlungslokal, und zwar nicht in der üblichen kostspieligen Weise
nebeneinander, sondern übereinander. Im Erdgeschoss werden vier
Schulräume sein und daneben ein großer Versammlungsraum, Darüber erhebt
sich, da neun Meter über dem Erdboden, das Gotteshaus, rechts und links
flankiert von prächtigen Freitreppen, die zur Männer- und Frauensynagoge
führen. Die Fassade wird einfache, vornehme Stilformen aufweisen. Die
Synagoge selbst wird 450 Plätze umfassen, 250 für Männer und 200 für
Frauen." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. September 1923: "Zürich.
Wir lesen im 'Israelitischen Wochenblatt für die Schweiz': Der Synagogenbau
der Israelitischen Religionsgesellschaft hat, wie schon in letzter
Nummer kurz mitgeteilt, seit kurzem begonnen. Die Energie und der Opfermut
dieser Gemeinde, die in der jetzigen, doch sicherlich nicht glänzenden
Zeit zum Bau einer Synagoge übergeht, sind bewundernswert. Dabei darf
man, angesichts der leitenden Persönlichkeiten der Gemeinde, ohne
Weiteres annehmen, dass die Finanzierung des Baues von Grund auf eine
solide ist. Das Grundstück, 2.000 qm groß, am Ende der Freigutstraße
zur Sihl hin, seitlich durch die Sihlamtstraße begrenzt, hat eine ideale
Lage. Zu beiden Seiten der Synagoge bleibt prächtiger, schattiger Baumbestand
stehen. Der Bauplan selbst weist eine überraschend gute Idee auf: Der Bau
wird zugleich sowohl das Bethaus entstehen lassen wie auch Schulräume und
Versammlungslokal, und zwar nicht in der üblichen kostspieligen Weise
nebeneinander, sondern übereinander. Im Erdgeschoss werden vier
Schulräume sein und daneben ein großer Versammlungsraum, Darüber erhebt
sich, da neun Meter über dem Erdboden, das Gotteshaus, rechts und links
flankiert von prächtigen Freitreppen, die zur Männer- und Frauensynagoge
führen. Die Fassade wird einfache, vornehme Stilformen aufweisen. Die
Synagoge selbst wird 450 Plätze umfassen, 250 für Männer und 200 für
Frauen." |
Grundsteinlegung zur neuen Synagoge (Oktober 1923)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Oktober 1923: "Zürich,
1. Oktober (1923). Am vergangenen Freitag wurde in Zürich der Grundstein
zur Synagoge der 'Israelitischen Religionsgesellschaft Adass Jeschurun'
an der Freigutstraße gelegt. Eröffnet wurde die Feierlichkeit von Herrn
Kantor Lieber mit einem Psalm. Herr Teplitz, als Präsident der
Israelitischen Religionsgesellschaft, leitete sodann den Reigen der Reden
ein. Er überflog die Geschichte der Gemeinde, die vor 28 Jahren mit 7
Mitgliedern in Dasein trat und nun die Zahl von 100 Mitgliedern erreicht
hat; sodann ließ er, wie jeder Redner nach ihm, die üblichen drei
Hammerschläge auf den Grundstein folgen, der die eingekapselte Bauurkunde
deckt. Herr Rabbiner Dr. Lewenstein sprach danach in tiefer
Rührung das Festgebet. Er erinnerte an jenen Bau des zweiten Tempels, auf
den man siebenzig Jahre habe warten müssen; sieben Jahre hatte man auch
in diesem Falle das Projekt einer Synagoge beraten. Architekt Witschi
sprach sodann im Namen von Bauleitung und Bauführung. Dann ergriff Herr
Max Kahn im Namen der Baukommission das Wort. Die Schlussrede hielt Herr
Rabbiner Kornfein, worauf Gesang die Feier
schloss." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Oktober 1923: "Zürich,
1. Oktober (1923). Am vergangenen Freitag wurde in Zürich der Grundstein
zur Synagoge der 'Israelitischen Religionsgesellschaft Adass Jeschurun'
an der Freigutstraße gelegt. Eröffnet wurde die Feierlichkeit von Herrn
Kantor Lieber mit einem Psalm. Herr Teplitz, als Präsident der
Israelitischen Religionsgesellschaft, leitete sodann den Reigen der Reden
ein. Er überflog die Geschichte der Gemeinde, die vor 28 Jahren mit 7
Mitgliedern in Dasein trat und nun die Zahl von 100 Mitgliedern erreicht
hat; sodann ließ er, wie jeder Redner nach ihm, die üblichen drei
Hammerschläge auf den Grundstein folgen, der die eingekapselte Bauurkunde
deckt. Herr Rabbiner Dr. Lewenstein sprach danach in tiefer
Rührung das Festgebet. Er erinnerte an jenen Bau des zweiten Tempels, auf
den man siebenzig Jahre habe warten müssen; sieben Jahre hatte man auch
in diesem Falle das Projekt einer Synagoge beraten. Architekt Witschi
sprach sodann im Namen von Bauleitung und Bauführung. Dann ergriff Herr
Max Kahn im Namen der Baukommission das Wort. Die Schlussrede hielt Herr
Rabbiner Kornfein, worauf Gesang die Feier
schloss." |
Einweihung der neuen Synagoge (September
1924)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1924: "Einweihung
der neuen Synagoge der 'Israelitischen Religionsgesellschaft'. Zürich,
9. September (1924). Die neue Synagoge der Israelitischen
Religionsgesellschaft steht nun als Prachtbau da und ist am 17. September
ihrer heiligen Bestimmung übergeben worden. Fast alle Rabbiner der
Schweiz waren anwesend und sämtliche Gemeinden des Landes waren
vertreten, ebenso Vertreter von Behörden und vielen ausländischen
Gemeinden. Nach einer weihevollen Abschiedsfeier im bisherigen Betlokale
begannen die Einweihungsfeierlichkeiten in der neuen Synagoge mit den
üblichen Rundgängen und Chorgesängen. Darauf hielt der Präsident der
Gemeinde, Herr S. Teplitz, eine kurze herzliche Ansprache, in der
er all denen, die am Bau mitgewirkt, den Dank im Namen des Vorstandes
ausdrückte. Das 'Ner Tomid' (ewiges Licht) wurde von zwei Begründern der
Gemeinde, den Herren Leopold Weill und Leon Bloch, angezündet.
Nach weiteren Chorgesängen hielt Herr Rabbiner Dr. Lewenstein eine
tief durchdachte Festrede, die mit einem Gebete schloss. Es wurde
dann das Vaterlandsgebet verrichtet und Herr Kantor Lieber trug in
schönem Sologesang Psalmen vor, worauf Herr Rabbiner A. Kornfein
die zweite Festpredigt hielt, die ebenfalls tiefen Eindruck
hinterließ. Mit dem Abendgebete und einigen Psalmgesängen, vorgetragen
und dem neugebildeten und gutgeschulten Chore, fand die weihevolle Feier
gegen Abend ihr Ende. - Der akademischen Feier schloss sich abends eine gemütliche
Veranstaltung an, die neben kulinarischen Genüssen von vielen
künstlerischen Darbietungen und geistvollen Ansprachen ausgefüllt
war. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1924: "Einweihung
der neuen Synagoge der 'Israelitischen Religionsgesellschaft'. Zürich,
9. September (1924). Die neue Synagoge der Israelitischen
Religionsgesellschaft steht nun als Prachtbau da und ist am 17. September
ihrer heiligen Bestimmung übergeben worden. Fast alle Rabbiner der
Schweiz waren anwesend und sämtliche Gemeinden des Landes waren
vertreten, ebenso Vertreter von Behörden und vielen ausländischen
Gemeinden. Nach einer weihevollen Abschiedsfeier im bisherigen Betlokale
begannen die Einweihungsfeierlichkeiten in der neuen Synagoge mit den
üblichen Rundgängen und Chorgesängen. Darauf hielt der Präsident der
Gemeinde, Herr S. Teplitz, eine kurze herzliche Ansprache, in der
er all denen, die am Bau mitgewirkt, den Dank im Namen des Vorstandes
ausdrückte. Das 'Ner Tomid' (ewiges Licht) wurde von zwei Begründern der
Gemeinde, den Herren Leopold Weill und Leon Bloch, angezündet.
Nach weiteren Chorgesängen hielt Herr Rabbiner Dr. Lewenstein eine
tief durchdachte Festrede, die mit einem Gebete schloss. Es wurde
dann das Vaterlandsgebet verrichtet und Herr Kantor Lieber trug in
schönem Sologesang Psalmen vor, worauf Herr Rabbiner A. Kornfein
die zweite Festpredigt hielt, die ebenfalls tiefen Eindruck
hinterließ. Mit dem Abendgebete und einigen Psalmgesängen, vorgetragen
und dem neugebildeten und gutgeschulten Chore, fand die weihevolle Feier
gegen Abend ihr Ende. - Der akademischen Feier schloss sich abends eine gemütliche
Veranstaltung an, die neben kulinarischen Genüssen von vielen
künstlerischen Darbietungen und geistvollen Ansprachen ausgefüllt
war.
Wir kommen auf die Geschichte der Gemeinde und die Bedeutung des jetzt
vollzogenen Weiheaktes noch
zurück." |
Über die neue Synagoge (1924)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Oktober 1924: "Die
neue Synagoge der Israelitischen Religionsgesellschaft in Zürich (Mit
Bildern.). Über die Errichtung und Einweihung der neuen prachtvollen
Synagoge der Israelitischen Religionsgemeinde haben wir bereits berichtet.
Über die Geschichte dieser ersten selbstständigen orthodoxen Gemeinde in
der Schweiz entnehmen wir der J.P.Z. folgende Angaben: Es waren die
jetzigen Mitglieder der Gemeinde Josua Goldschmidt und Josef Ettlinger,
aus Frankfurt am Main kommend, wo sie im Milieu der Religionsgesellschaft
gelebt und den Geist Samson Raphael Hirschs eingeatmet hatten, die in
Gemeinschaft mit dem inzwischen verstorbenen Isidor Kohn - seligen
Andenkens - aus Baden bei Wien das erste Minjan gründeten. Diese
jungen Leute, die in Zürich in Stellung waren, sahen sich vor der
Unmöglichkeit, ihre an Gemeinsamkeit gebundenen jüdischen Pflichten zu
erfüllen. Am Gottesdienst der bestehenden Gemeinde konnten sie nicht
teilnehmen, weil in deren Synagoge ein kirchliches Musikinstrument und ein
gemischter Chor von Herren und Damen es ihnen unmöglich machten. Eine
Stätte des Toralernens zur Erlangung der jedem bewussten Juden
lebensnotwendigen geistigen Nahrung fanden sie nirgends und selbst ihre
leibliche Nahrung mussten sie, damit solche dem Toragesetze entspräche,
auswärts einnehmen oder von dort beziehen. Sie fanden Verständnis und
Gesinnungsgemeinsamkeit in dem verehrten Nestor unserer Gemeinde, Herrn
Leopold Weill. Um die Einrichtung eines Gottesdienstes nach Toragesetz und
Vätersitte zu ermöglichen, stellte Herr Weill einen Raum in seiner
Wohnung zur Verfügung und im Februar 1890 (Schabbat) Paraschat Teruma
(das war 22. Februar 1890) wurde darin ein solcher erstmals abgehalten.
Dass sich dafür die nötige Zehnzahl fand, beweist das damalige
Vorhandensein einer Anzahl Gleichgesinnter, die nur des Anstoßes und der
Gelegenheit zur Betätigung bedurften. Das Minjan verblieb einige Monate
im Hause des Herrn Leopold Weill und wurde dann in den Saal des damaligen
'Schützengartens' verlegt. Die Grundlage für eine besondere
gesetzestreue Gemeinde war mit diesem den Anforderungen der Tora und
Tradition entsprechenden Gottesdienste, dem sich regelmäßige
Lern-Schiurim anschlossen, gelegt und führte im August 1895 zu der
Gründung einer Religionsgesellschaft durch die Herren Gabriel Bernheim,
Leon Bloch, A. Gutmann, Raphael Lang, Hermann Weill, Joseph Weill und
Leopold Weill. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Oktober 1924: "Die
neue Synagoge der Israelitischen Religionsgesellschaft in Zürich (Mit
Bildern.). Über die Errichtung und Einweihung der neuen prachtvollen
Synagoge der Israelitischen Religionsgemeinde haben wir bereits berichtet.
Über die Geschichte dieser ersten selbstständigen orthodoxen Gemeinde in
der Schweiz entnehmen wir der J.P.Z. folgende Angaben: Es waren die
jetzigen Mitglieder der Gemeinde Josua Goldschmidt und Josef Ettlinger,
aus Frankfurt am Main kommend, wo sie im Milieu der Religionsgesellschaft
gelebt und den Geist Samson Raphael Hirschs eingeatmet hatten, die in
Gemeinschaft mit dem inzwischen verstorbenen Isidor Kohn - seligen
Andenkens - aus Baden bei Wien das erste Minjan gründeten. Diese
jungen Leute, die in Zürich in Stellung waren, sahen sich vor der
Unmöglichkeit, ihre an Gemeinsamkeit gebundenen jüdischen Pflichten zu
erfüllen. Am Gottesdienst der bestehenden Gemeinde konnten sie nicht
teilnehmen, weil in deren Synagoge ein kirchliches Musikinstrument und ein
gemischter Chor von Herren und Damen es ihnen unmöglich machten. Eine
Stätte des Toralernens zur Erlangung der jedem bewussten Juden
lebensnotwendigen geistigen Nahrung fanden sie nirgends und selbst ihre
leibliche Nahrung mussten sie, damit solche dem Toragesetze entspräche,
auswärts einnehmen oder von dort beziehen. Sie fanden Verständnis und
Gesinnungsgemeinsamkeit in dem verehrten Nestor unserer Gemeinde, Herrn
Leopold Weill. Um die Einrichtung eines Gottesdienstes nach Toragesetz und
Vätersitte zu ermöglichen, stellte Herr Weill einen Raum in seiner
Wohnung zur Verfügung und im Februar 1890 (Schabbat) Paraschat Teruma
(das war 22. Februar 1890) wurde darin ein solcher erstmals abgehalten.
Dass sich dafür die nötige Zehnzahl fand, beweist das damalige
Vorhandensein einer Anzahl Gleichgesinnter, die nur des Anstoßes und der
Gelegenheit zur Betätigung bedurften. Das Minjan verblieb einige Monate
im Hause des Herrn Leopold Weill und wurde dann in den Saal des damaligen
'Schützengartens' verlegt. Die Grundlage für eine besondere
gesetzestreue Gemeinde war mit diesem den Anforderungen der Tora und
Tradition entsprechenden Gottesdienste, dem sich regelmäßige
Lern-Schiurim anschlossen, gelegt und führte im August 1895 zu der
Gründung einer Religionsgesellschaft durch die Herren Gabriel Bernheim,
Leon Bloch, A. Gutmann, Raphael Lang, Hermann Weill, Joseph Weill und
Leopold Weill.
Dreißig Jahre sind seitdem verflossen. Es waren Jahre der steten Weiterentwicklung,
rein zahlenmäßig wie in ideellem Sinne. Heute zählt die Zürcher
Religionsgesellschaft ihre Mitglieder nach Hunderten, besitzt eine
prächtige Synagoge und in den Herren Lewenstein und Kornfein zwei
Rabbiner, die bestrebt sind, sie weiter zu führen zur Ehre des
Ortes und zur Ehre der Tora.
Dem religiösen Weiheakt, über den wir bereits berichtet haben, schloss
sich abends ein Festmahl im großen Saal 'Zur Kaufleuten' an, das einen
herrlichen Verlauf nahm. Alle Gemeinden der Schweiz waren vertreten und
viele überbrachten kostbare und sinnige Geschenke. So stiftete die
Israelitische Kultusgemeinde Zürich ebenso die Gemeinden Baden,
Lausanne und Luzern Toraschmuck und Pokale, die alte
Muttergemeinde Lengnau eine Torarolle. Eine große Anzahl guter
Reden wurden gehalten. Fast alle Gemeinden der Schweiz entsandten durch
ihre Vertreter ihre Grüße. In großangelegter Rede hob der Präsident
der Kultusgemeinde, Herr Dr. Charles Bollag, das friedliche, herzliche
Verhältnis zwischen Kultusgemeinde und Religionsgesellschaft hervor. In
gleichem Sinne sprach Herr Rabbiner Dr. Littmann, während die
anderen Redner, zuletzt der Präsident der Religionsgesellschaft, Herr
Teplitz, die Aufgaben der Gemeinde zur Verbreitung von Tora und
Gottesfurcht unterstrichen.
In einem Lande und einer Stadt, die den staatlichen Zwang in religiösen
Angelegenheiten des Judentums nicht kennen, konnte sich dieses friedliche
Nebeneinandersein in der Tat in dieser idealen Formen entwickeln, in der
Weise, dass sich die Kultusgemeinde niemals als die Gemeinde aufspielte
und nie den Versuch machte, der Entwicklung der Religionsgesellschaft
irgend ein Hindernis in den Weg zu legen, was Teilnehmer aus Deutschland
sehr wohltuend berührte, im Vergleiche zu den Verhältnissen in manchen
Staaten und Städten Deutschlands, wo die Reformgemeinden sich als
'Hauptgemeinden' gebärden und auf die Gesetzestreuen, die von ihrem
religiösen Gewissen gezwungen, sich in einem eigenen Gemeindeverband
finden, wie auf
eine |
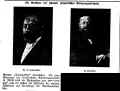 Fotos
links: Die Rabbiner der Züricher Israelitischen Religionsgesellschaft :
Dr. T. Lewenstein und A. Kornfein. Fotos
links: Die Rabbiner der Züricher Israelitischen Religionsgesellschaft :
Dr. T. Lewenstein und A. Kornfein.
Gruppe 'Separatisten' herabsehen. Die neue Synagoge der Israelitischen
Religionsgemeinde in Zürich wird ein Wahrzeichen von Tora und
Gottesfurcht, aber auch ein solches des Friedens, des wahren Scholaum auf
Grundlage der Torawahrheit sein." |
Weitere Angaben zur Synagoge auf der Website der
Israelitischen Religionsgesellschaft Zürich: "Baubeschreibung"
auf der Seite "Chronik der IRGZ"
Generalversammlung der israelitischen
Religionsgesellschaft nach Abschluss des Synagogenbaus (1925)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 2. April 1925: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"
vom 2. April 1925:
"Generalversammlung der israelitischen
Religionsgesellschaft.
Zürich, 23. März (1925). Am Sonntag, 22. März, nachmittags fand die
ordentliche Generalversammlung der Israelitischen
Religionsgesellschaft im Gemeindesaal bei starker Beteiligung statt. Nach
Verlesen des Protokolls erstattete der Präsident, Herr S. Teplitz,
den Jahresbericht, dem zu entnehmen ist, dass die Israelitische
Religionsgesellschaft alle Institutionen einer jüdischen Mustergemeinde
besitzt. Im Gebäude der Synagoge befinden sich prächtige
Schulräume, ein Lehrsaal, die Mikwe usw., die den Gemeindemitgliedern zur
Verfügung stehen. Das Jahr 1924 beweist, was eine für hohe Ideale des
Judentums begeisterte Gemeinde zu erreichen vermag, und so mögen die
Mitglieder auch weiterhin zur gedeihlichen Entwicklung der Gemeinde
beitragen. Der Präsident schloss den Jahresbericht mit der Erklärung,
dass es ihm aus Gesundheitsrücksichten nicht mehr möglich sei, den
Vorsitz auch weiterhin zu behalten und es freue ihn, in dem
Vizepräsidenten, Herrn Sally Harburger, einen würdigen Nachfolger
gefunden zu haben.
Es wurde ein schriftlicher Bericht des Herrn Joseph Wormser über
die Friedhof-Verwaltung verlesen. Herr Isak Rhein erstattete den Bericht
der Schulpflege und zollte den Lehrern Anerkennung für die gut
geleitete Schule. Der gedruckt vorliegende Kassenbericht wurde vom
Kassier, Herr Joseph Rosenblatt erläutert. Nachdem die
Rechnungsrevisoren, die Herren Jakob Weil-Halff und Berthold
Guggenheim sich über die Kassenführung lobend ausgesprochen hatten,
wurden sämtliche Berichte genehmigt und dem Vorstand unter bester
Verdankung der geleisteten Dienste die Decharge erteilt.
Über das Budget pro 1925, im Betrage von Fr. 80.000 hielt Herr Sally
Harburger ein eingehendes Referat, woraufhin das Budget einstimmig
genehmigt wurde. Herr J. Weil-Halff erstattete einen Bericht über die
Schlussabrechnung des Synagogenbaues, der mit großem Interesse
entgegengenommen wurde." |
Anschlag auf die orthodoxe Synagoge in Zürich (1934)
 Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Dezember
1934:
Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Dezember
1934:
"Sprengstoff-Anschlag gegen eine Synagoge in Zürich. Mitglieder
der nationalen Front verhaftet.
Zürich, 11. Dezember (1934).
Nach eingehenden Ergebungen ist es der Kantonspolizei gelungen, einige
Burschen zu ermitteln, die in der vorigen Woche am unteren Eingang zur
orthodoxen Synagoge an der Freigutstraße in Zürich eine Petarde zur
Explosion gebracht hatten, wodurch einige Fensterscheiben zertrümmert und
sonstige Sachschäden angerichtet worden waren. Verhaftet wurden im ersten
Stadtkreis ein 19-jähriger Handlanger, in Altstetten ein 15-jähriger
Bursche und in Albisrieden ein 20-jähriger Kommis. Sie erklärten,
Mitglieder der 'Nationalen Front' zu sein und an jenem Abend an der
Frontenversammlung in der Stadthalle teilgenommen zu haben. Gegen die
Verhafteten wird Anklage wegen böswilliger Eigentumsbeschädigung zum
Nachteil der Jüdischen Kultusgemeinde erhoben.
Der Anschlag gegen die Züricher orthodoxe Synagoge war wohl vorbereitet
gewesen. Kurz vorher hatte der Pförtner einen Rundgang um die Synagoge
gemacht und nichts Verdächtiges wahrgenommen. Diese Rundgänge hatten
sich seit einiger Zeit als notwendig erwiesen, da Beschädigungen an der
Synagoge, Einwerfen von Fernstern, Ankleben von Zetteln mit
antisemitischen Losungen usw. zu einer häufigen Erscheinung geworden
waren. Als bald nach dem Rundgang die Explosion erfolgte, eilten der
Pförtner und sein Sohn auf die Straße und verfolgten zwei verdächtige
junge Burschen, auf die sie von Passanten aufmerksam gemacht wurden. Die
Buschen konnten jedoch in der Dunkelheit
entkommen." |
Adresse/Standort der Synagoge:
Freigutstraße 37
Fotos
Die Synagoge der
Israelitischen Religionsgesellschaft |
 |
 |
| |
Außenansicht
(Quelle: R. Epstein-Mil s.Lit. S. 168) |
Innenansicht
(Quelle: Website der IRGZ) |
| |
|
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | 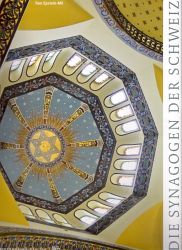 Ron
Epstein-Mil: Die Synagogen der Schweiz. Bauten zwischen Emanzipation, Assimilation und
Akkulturation.
Fotografien von Michael Richter Ron
Epstein-Mil: Die Synagogen der Schweiz. Bauten zwischen Emanzipation, Assimilation und
Akkulturation.
Fotografien von Michael Richter
Beiträge zur Geschichte und Kultur der Juden in der Schweiz. Schriftenreihe des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds, Band 13.
2008. S. 168-177 (hier auch weitere Quellen und
Literatur). |



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
diese Links sind noch nicht aktiviert
|