|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"
Zur Übersicht: "Synagogen im
Rhein-Lahn-Kreis"
Nastätten (VG
Nastätten, Rhein-Lahn-Kreis)
Jüdische Geschichte / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english
version)
In Nastätten bestand eine jüdische Gemeinde bis
1938/41. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17. Jahrhunderts zurück. Der
älteste erhaltene Schutzbrief stammt aus dem Jahr 1654. Noch im Laufe des 17.
Jahrhunderts stieg die Zahl der jüdischen Haushaltungen von drei (1664) auf elf
(1693) beziehungsweise neun an (1695). Im
18. Jahrhundert lag die Zahl der jüdischen Familien zwischen 13 und 16.
Die
jüdische Gemeinde von Nastätten hatte bis Anfang des 19. Jahrhunderts eine
besondere Bedeutung für die jüdischen Gemeinden der Umgebung als Sitz des
Bezirksrabbinates der Grafschaft Katzenelnbogen mit den Amtsbezirken
Nastätten, Langenschwalbach und St. Goarshausen. 1830 verlegte der damalige
Rabbiner Samuel Wormser seine Wohnung und Amtssitz nach Langenschwalbach
(gestorben 1858 in Hadamar, siehe Nachruf
dort). Seit
1843 war der Rabbinatssitz in Bad Ems.
Die jüdischen Familien lebten zunächst vom Handel mit Vieh und Waren aller
Art. Seit dem 19. Jahrhundert trugen sie wesentlich zur wirtschaftlichen
Entwicklung Nastättens bei. Jüdischen Gewerbetreibenden gehörten: mehrere
Viehhandlungen, eine Metzgerei, Kolonial- und Kurzwarenläden, ein
Möbelgeschäft, ein Herrenbekleidungsgeschäft, ein Konfektionsgeschäft,
Lederwarenhandlungen, eines mit einem Fahrradgeschäft, ein Porzellanladen
(Nebenbetrieb des Lehrers Mannheimer), ein Kohlengeschäft sowie eine Handlung
mit landwirtschaftlichen Produkten, Düngemittel, Kohlen und Briketts.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine
Synagoge (s.u.) eine Religionsschule, ein rituelles Bad und einen Friedhof. Zur
Besorgung der religiösen Aufgaben der Gemeinde war ein Religionslehrer
angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schächter wirkte. Bei anstehenden
Neubesetzungen wurde die Stelle immer wieder neu ausgeschrieben (s.u.
Ausschreibungstext unten). 1864 wird als Lehrer der Gemeinde Lehrer Friedberg
genannt. Von etwa 1875 an wirkte über 60 Jahre in der
Gemeinde Lehrer Gustav Mannheimer (siehe Bericht zu seinem 80.
Geburtstag unten; über die brutalen Misshandlungen beim Novemberpogrom 1938
siehe unten).
Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Gustav Strauß
(geb. 27.9.1877 in Nastätten, gef. 15.9.1917) und Gefreiter Moritz Strauß
(geb. 14.10.1890 in Nastätten, gef.
31.10.1916).
Um 1925, als 50 jüdische Einwohner
gezählt wurden (1,77 % von insgesamt etwa 1.800), waren die Vorsteher der
Gemeinde Julius Leopold, Hermann Grünewald, Nathan Heymann. Als Lehrer und
Kantor wirkte der bereits genannte Gustav Mannheimer. Er unterrichtete an der Volksschule 10 bis 12
Kinder in Religion. Die jüdische Gemeinde war dem Rabbinatsbezirk in Bad
Ems zugeteilt. An jüdischen Vereinen bestanden der
israelitische Frauenverein unter Leitung von Frau Aronthal (Ziel:
Wohlfahrtspflege).1932 waren dieselben Personen wie 1924 im
Gemeindevorstand.
Nach 1933 ist ein Teil der
jüdischen Gemeindeglieder (1933: etwa 55 Personen von insgesamt 1813) auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der
Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Nastätten war
bereits seit 1926 eine "Hochburg" der Nationalsozialisten (siehe
Berichte unten über die Vorkommnisse im März 1927). Es kam vor
allem 1938 (am 10. und 16. November 1938) zu schweren Ausschreitungen und gewalttätigen Aktionen gegen die
jüdischen Familien. Mehrere Personen, auch einige der jüdischen Frauen, wurden
misshandelt. Der inzwischen 82-jährige jüdische Lehrer Gustav Mannheimer wurde
durch örtliche Nationalsozialisten eine Treppe hinuntergestoßen, sodass er mit
dem Kopf auf die Steinstufen des Hauseingangs aufschlug. Man ließ ihn mit der
blutenden Wunde am Hinterkopf liegen. Ein halbes Jahr später, am 14. März 1939
verstarb er in Nastätten.
Von den in Nastätten geborenen und/oder
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit
umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad
Vashem, Jerusalem): Moritz Aronthal (1889), Berta Cahn geb. Grünewald
(1872), Klara Cahn geb. Goldschmidt (1902), Sally Cahn (1908), Selma Cahn (1909), Feist Goldschmidt
(1864), Sara Goldschmidt geb. Goldschmidt (1862), Amalie (Mally) Grünewald geb.
Stern (1874 oder 1876); Hermann Grünewald (1874), Nelly Grünewald (1908), Ida
Heuser geb. Thalheimer (1893), Johanna Heymann geb. Levy (1877), Nathan Heymann
(1871), Lina Isaac geb. Aronthal (1879), Paula Kahn geb. Strauss (1910), Sally Kahn
(1907), Paula Katzenstein geb. Hirsch (1898), Gustav Mannheimer (1856), Hedwig
May geb. Leopold (1870; Informationen zu ihr siehe Seite
zu Bad Camberg), Clothilde (Tilly) Rothschild geb. Aronthal (1886),
Siegmund Rückersberg (1882), Ernst Scheye (1908), Rosalie Scheye geb. Mendel
(1885), Irene Juliah Stern (1923), Karl Stern (1886), Gertrud (Träutchen) Strauss geb. Nathan
(1867), Inge Strauss (1934), Otto Jakob Strauss (1905).
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte der
jüdischen Lehrer
Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1870
 Anzeige
in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 5. Januar 1870: "Die Israelitische
Kultusgemeinde Nastätten, Provinz Nassau, sucht einen Religionslehrer und
Vorbeter, bis zum 12. April 1870, womöglich ledig. Gehalt 260 bis 300 Gulden,
Nebenverdienste extra. Herauf Reflektierende belieben sich an den
Unterzeichneten zu melden. Anzeige
in der Zeitschrift
"Der Israelit" vom 5. Januar 1870: "Die Israelitische
Kultusgemeinde Nastätten, Provinz Nassau, sucht einen Religionslehrer und
Vorbeter, bis zum 12. April 1870, womöglich ledig. Gehalt 260 bis 300 Gulden,
Nebenverdienste extra. Herauf Reflektierende belieben sich an den
Unterzeichneten zu melden.
Nastätten, 20. Dezember 1869. Der Vorsteher Aronthal". |
Lehrer Friedberg in Nastätten wird bei einer
Lehrerkonferenz in Singhofen genannt (1864)
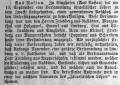 Artikel
in "Der Israelitische Lehrer" vom 6. Oktober 1864:
"Aus Nassau. Zu Singhofen
(Amt Nassau) hat am 19. September eine Versammlung israelitischer Lehrer zu
dem Zwecke stattgefunden, einen gemeinsamen Anschluss an den
Unterstützungsverein zu bewerkstelligen. Diese Versammlung war von den
Herren Friedberg aus Nastätten, Morgenthal aus
Holzappel, Emmel aus
Limburg, Levi aus
Eltville, Laubheim aus
Singhofen, Aron aus
Kördorf (nicht: Kirdorf),
Friedberg aus Ruppertshofen
besucht (Heymann aus Schierstein
hatte seine Verhinderung angezeigt). Als vorzüglichster Erfolg dieser
Vorberatung haben wir vorläufig mitzuteilen, dass Anfangs November eine
größere Versammlung in Limburg a.L.
stattfinden soll, und dass als Vertrauensmann Herr Friedberg aus
Ruppertshofen bestimmt worden,
welcher die Einladung (an Rabbiner, Vorstände, Lehrer und Gemeindeglieder
erlassen wird, und bei welchem auch die Anmeldungen zu machen sind. Die
betreffende Ansprache wird in einer der nächsten Nummern des 'Israelitischen
Lehrer' erscheinen." Artikel
in "Der Israelitische Lehrer" vom 6. Oktober 1864:
"Aus Nassau. Zu Singhofen
(Amt Nassau) hat am 19. September eine Versammlung israelitischer Lehrer zu
dem Zwecke stattgefunden, einen gemeinsamen Anschluss an den
Unterstützungsverein zu bewerkstelligen. Diese Versammlung war von den
Herren Friedberg aus Nastätten, Morgenthal aus
Holzappel, Emmel aus
Limburg, Levi aus
Eltville, Laubheim aus
Singhofen, Aron aus
Kördorf (nicht: Kirdorf),
Friedberg aus Ruppertshofen
besucht (Heymann aus Schierstein
hatte seine Verhinderung angezeigt). Als vorzüglichster Erfolg dieser
Vorberatung haben wir vorläufig mitzuteilen, dass Anfangs November eine
größere Versammlung in Limburg a.L.
stattfinden soll, und dass als Vertrauensmann Herr Friedberg aus
Ruppertshofen bestimmt worden,
welcher die Einladung (an Rabbiner, Vorstände, Lehrer und Gemeindeglieder
erlassen wird, und bei welchem auch die Anmeldungen zu machen sind. Die
betreffende Ansprache wird in einer der nächsten Nummern des 'Israelitischen
Lehrer' erscheinen." |
Zur Biographie des Lehrers H. Kahn (geb. 1823 in Nastätten)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. September
1903: "Schierstein, 10. September (1903). Am 12. vorigen Monats starb
der erst seit 1. Mai dieses Jahres in den wohlverdienten Ruhestand
getretene Lehrer H. Kahn aus Flörsheim (Nassau). In dem nassauischen
Städtchen Nastätten 1823 geboren, besuchte er später von 1830-41 das
frühere jüdische Seminar in Ems. Nach erlangter Lehrbefähigung erhielt
er in Holzhausen über Aur (Nassau) die erste Anstellung. Im Jahre 1870
wurde er auf Ansuchen nach Flörsheim versetzt. Hier wirkte er 33 Jahre.
Kahn war ein sehr tüchtiger Lehrer und besaß ein tiefes jüdisches
Wissen. Für die nassauischen Schulblätter der Jahrgänge 1856-73
lieferte er sehr gediegene Aufsätze pädagogischen Inhalts. An der Bahre
schilderte in würdiger Weise Herr Bezirksrabbiner Dr. Silberstein in
Wiesbaden den Lebenslauf des Verstorbenen und gab insbesondere in
anerkennenden Worten dem Pflichteifer und der Treue des Verstorbenen
seinen Vorgesetzten gegenüber Ausdruck. Nicht unerwähnt mag bleiben,
dass der Verstorbene Mitbegründer des großen Lehrer-, Witwen- und
Waisen-Unterstützungsvereins 'Achawa' Sitz Frankfurt am Main war und
stets großes Interesse für das unschätzbare soziale Werk bekundete.
Ehre seinem Andenken!" Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. September
1903: "Schierstein, 10. September (1903). Am 12. vorigen Monats starb
der erst seit 1. Mai dieses Jahres in den wohlverdienten Ruhestand
getretene Lehrer H. Kahn aus Flörsheim (Nassau). In dem nassauischen
Städtchen Nastätten 1823 geboren, besuchte er später von 1830-41 das
frühere jüdische Seminar in Ems. Nach erlangter Lehrbefähigung erhielt
er in Holzhausen über Aur (Nassau) die erste Anstellung. Im Jahre 1870
wurde er auf Ansuchen nach Flörsheim versetzt. Hier wirkte er 33 Jahre.
Kahn war ein sehr tüchtiger Lehrer und besaß ein tiefes jüdisches
Wissen. Für die nassauischen Schulblätter der Jahrgänge 1856-73
lieferte er sehr gediegene Aufsätze pädagogischen Inhalts. An der Bahre
schilderte in würdiger Weise Herr Bezirksrabbiner Dr. Silberstein in
Wiesbaden den Lebenslauf des Verstorbenen und gab insbesondere in
anerkennenden Worten dem Pflichteifer und der Treue des Verstorbenen
seinen Vorgesetzten gegenüber Ausdruck. Nicht unerwähnt mag bleiben,
dass der Verstorbene Mitbegründer des großen Lehrer-, Witwen- und
Waisen-Unterstützungsvereins 'Achawa' Sitz Frankfurt am Main war und
stets großes Interesse für das unschätzbare soziale Werk bekundete.
Ehre seinem Andenken!" |
50jähriges Ortsjubiläum von Lehrer
und Kantor Gustav Mannheimer (1925, Lehrer in Nastätten, Holzhausen und Miehlen
seit 1875)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. November 1925: "Nastätten,
18. November. Am Schabbat Paraschat Lech Lecha (Samstag, 31. Oktober
1925) war es 50 Jahre, dass Lehrer und Kantor Mannheimer sein Amt in
unserer Gemeinde und in den Gemeinden Holzhausen und
Miehlen angetreten hat. Aus Anlass
dieses seltenen Jubiläums hat unsere Gemeinde einen Festgottesdienst
veranstaltet, zu welchem Herr Bezirksrabbiner Dr. Weingarten aus
Bad Ems erschienen war, um die Festrede
zu halten. Im Anschluss an den Wochenabschnitt rühmte er die Pflichttreue
des im Amt erkrankten Beamten, der seinen heiligen Beruf immer treu und
gewissenhaft erfüllt hat. Der Vorstand der Gemeinde sowie zahlreiche
Gemeindemitglieder ehrten den Jubilar durch reiche Geschenke, und auch viele
Bürger ließen es sich nicht nehmen, ihre Glückwünsche schriftlich und
mündlich zu übermitteln. Die ganze Feier zeugt von der Beliebtheit, die Herr
Lehrer Mannheimer im Laufe der Jahre sich in allen Kreisen der Bevölkerung
erworben hat." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. November 1925: "Nastätten,
18. November. Am Schabbat Paraschat Lech Lecha (Samstag, 31. Oktober
1925) war es 50 Jahre, dass Lehrer und Kantor Mannheimer sein Amt in
unserer Gemeinde und in den Gemeinden Holzhausen und
Miehlen angetreten hat. Aus Anlass
dieses seltenen Jubiläums hat unsere Gemeinde einen Festgottesdienst
veranstaltet, zu welchem Herr Bezirksrabbiner Dr. Weingarten aus
Bad Ems erschienen war, um die Festrede
zu halten. Im Anschluss an den Wochenabschnitt rühmte er die Pflichttreue
des im Amt erkrankten Beamten, der seinen heiligen Beruf immer treu und
gewissenhaft erfüllt hat. Der Vorstand der Gemeinde sowie zahlreiche
Gemeindemitglieder ehrten den Jubilar durch reiche Geschenke, und auch viele
Bürger ließen es sich nicht nehmen, ihre Glückwünsche schriftlich und
mündlich zu übermitteln. Die ganze Feier zeugt von der Beliebtheit, die Herr
Lehrer Mannheimer im Laufe der Jahre sich in allen Kreisen der Bevölkerung
erworben hat." |
80. Geburtstag von Lehrer Gustav Mannheimer
(1936)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Juni 1936: "Nastätten
(Hessen-Nassau), 21. Juni (1936). In seltener körperlicher Rüstigkeit
und geistiger Frische beging Herr Lehrer Gustav Mannheimer seinen
80. Geburtstag unter freudiger Anteilnahme der Gemeinde und Bekannten aus
der Ferne. Der heute noch sehr rüstige Jubilar wirkt seit über 60 Jahren
in der Gemeinde. Einer alten Lehrerfamilie in der Nähe Frankfurts
entstammend, fand er seine Ausbildung bei Reb Losor Ottensoßer - das
Andenken an den Gerechten ist zum Segen - in Höchberg
und im Seminar zu Würzburg, das er 1874
verließ. Nur wenige Kursgenossen werden noch unter uns weilen. Möge dem
Jubilar auch fernerhin ein glücklicher Lebensabend beschieden sein
innerhalb seiner Lieben und seiner Gemeinde. (Alles Gute) bis 120
Jahre". Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Juni 1936: "Nastätten
(Hessen-Nassau), 21. Juni (1936). In seltener körperlicher Rüstigkeit
und geistiger Frische beging Herr Lehrer Gustav Mannheimer seinen
80. Geburtstag unter freudiger Anteilnahme der Gemeinde und Bekannten aus
der Ferne. Der heute noch sehr rüstige Jubilar wirkt seit über 60 Jahren
in der Gemeinde. Einer alten Lehrerfamilie in der Nähe Frankfurts
entstammend, fand er seine Ausbildung bei Reb Losor Ottensoßer - das
Andenken an den Gerechten ist zum Segen - in Höchberg
und im Seminar zu Würzburg, das er 1874
verließ. Nur wenige Kursgenossen werden noch unter uns weilen. Möge dem
Jubilar auch fernerhin ein glücklicher Lebensabend beschieden sein
innerhalb seiner Lieben und seiner Gemeinde. (Alles Gute) bis 120
Jahre". |
Aus dem jüdischen Gemeindeleben
Ein antijüdisch eingestellter Pfarrer wird verurteilt (1876)
 Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Mai 1876:
"Aus dem Nassauischen, 14. Mai 1876. Schon seit Wochen ist unsere
ganze Umgegend durch eine Injurienklage um der bei diesem Prozesse
beteiligten Persönlichkeiten willen in die erregteste Spannung versetzt
worden. Der Pfarrer und Schulinspektor Bode von Ruppertshofen hatte
nämlich während einer Fahrt von St. Goarshausen nach Bogel seinen Reisegesellschafter
im Postwagen, den Nastätter Bürger Salomon Oppenheimer, mit den
beleidigendsten Worten angeredet; dann suchte er ihn zum Christentum zu bekehren,
indem er ihm die Zukunft, nämlich 'als Jude zu sterben', sehr schwarz
ausmalte. Der durch eine solche Äußerung schwer gekränkte Mann reichte
alsbald beim königlichen Amtsgericht zu Nastätten eine Klage auf
Ehrenkränkung ein. Die erste Gerichtsverhandlung fand am 21. vorigen
Monats statt. Der Herr Pfarrer glaubte als Seelsorger mit seiner
ehrenrührigen Äußerung dem Kläger gegenüber vollkommen in seinem
Rechte zu sein. Dies half ihm aber nichts, und er wurde schließlich zu 50
Mark Geldbuße und zur Tragung der Kosten verurteilt. Die Nassauische
'Volkszeitung' fügt die Bemerkung hinzu: 'Dieser Fall bietet auch nach in
anderer Beziehung eine äußerst ernste Seite dar. Der Verurteilte ist
zugleich Schulinspektor und als solcher eine Vertrauensperson. Unsere
Regierung meint es mit dem Schulwesen und den Lehrern gut, das ist
zweifellos. So lange aber das Aufsichtspersonal noch allzu viel
ungeeignete Persönlichkeiten zählt, wird das Schulwesen selbst beim
besten Willen der königlichen Regierung niedergehalten und der
Lehrerstand bei allen Gehaltsaufbesserungen, Zulagen, Remunerationen,
Lehrerkurse und dergleichen gedrückt und gebückt bleiben. Möchte doch
auch hier eine schönere Morgenröte bald hereinbrechen!!" Artikel
in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Mai 1876:
"Aus dem Nassauischen, 14. Mai 1876. Schon seit Wochen ist unsere
ganze Umgegend durch eine Injurienklage um der bei diesem Prozesse
beteiligten Persönlichkeiten willen in die erregteste Spannung versetzt
worden. Der Pfarrer und Schulinspektor Bode von Ruppertshofen hatte
nämlich während einer Fahrt von St. Goarshausen nach Bogel seinen Reisegesellschafter
im Postwagen, den Nastätter Bürger Salomon Oppenheimer, mit den
beleidigendsten Worten angeredet; dann suchte er ihn zum Christentum zu bekehren,
indem er ihm die Zukunft, nämlich 'als Jude zu sterben', sehr schwarz
ausmalte. Der durch eine solche Äußerung schwer gekränkte Mann reichte
alsbald beim königlichen Amtsgericht zu Nastätten eine Klage auf
Ehrenkränkung ein. Die erste Gerichtsverhandlung fand am 21. vorigen
Monats statt. Der Herr Pfarrer glaubte als Seelsorger mit seiner
ehrenrührigen Äußerung dem Kläger gegenüber vollkommen in seinem
Rechte zu sein. Dies half ihm aber nichts, und er wurde schließlich zu 50
Mark Geldbuße und zur Tragung der Kosten verurteilt. Die Nassauische
'Volkszeitung' fügt die Bemerkung hinzu: 'Dieser Fall bietet auch nach in
anderer Beziehung eine äußerst ernste Seite dar. Der Verurteilte ist
zugleich Schulinspektor und als solcher eine Vertrauensperson. Unsere
Regierung meint es mit dem Schulwesen und den Lehrern gut, das ist
zweifellos. So lange aber das Aufsichtspersonal noch allzu viel
ungeeignete Persönlichkeiten zählt, wird das Schulwesen selbst beim
besten Willen der königlichen Regierung niedergehalten und der
Lehrerstand bei allen Gehaltsaufbesserungen, Zulagen, Remunerationen,
Lehrerkurse und dergleichen gedrückt und gebückt bleiben. Möchte doch
auch hier eine schönere Morgenröte bald hereinbrechen!!" |
Landfriedensbruchprozess gegen Nationalsozialisten
wegen Ausschreitungen bei einer Versammlung in Nastätten (1927)
 Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Wiesbaden und
Umgebung" vom 9. März 1927: "Am 6. März 1927 hatte der jüdische
Landwirt Hermann Hennig aus Nastätten im Taunus eine Versammlung in
das dortige Hotel Guntrum einberufen mit dem Thema 'Das wahre Gesicht der
Nationalsozialisten'. Als Redner waren Geistliche verschiedener
Konfessionen vorgesehen. Auf die Ankündigung der Versammlung in der
Zeitung waren Hakenkreuzlergruppen aus Köln, Neuwied, Koblenz, Wiesbaden
und anderen Orten mit Lastautos herbeigeeilt, um gegen die Veranstaltung
zu demonstrieren. Die Versammlung wurde aber noch vor ihrem Beginn von den
anwesenden Landjägern wegen Überfüllung des Saales verboten, worauf
sich die Teilnehmer ins Freie begaben und der nationalsozialistische
Gauleiter des Bezirks Rheinland, der bekannte Dr. Ley, von einem Auto
herab eine Rede hielt, die mit den Worten schloss: 'Nassauer Bauern,
verteidigt euer Eigentum, und wenn es mit der Mistgabel sein müsste'. Die
Erregung, die alle Teilnehmer erfasst hatte, führte zu Wortgefechten und
schließlich zu Tätlichkeiten, in den Verlauf sowohl der Einberufer der
Versammlung, Hennig, einen tritt vor den Bau erhielt, als auch zwei andere
Juden aus der Umgebung Nastättens verprügelt wurden. Hennig, der sich in
das Hotel Guntrum begeben hatte, sah, wie ein Nationalsozialist auf einen
Juden einschlug und versetzte deshalb vom Fenster aus einem Angreifer mit
der Faust einen Hieb. Dieser Schlag war das Signal für einen Sturm auf
das Hotel, in dessen Verlauf die bedrängten Landjäger von der Waffe
Gebrauch machten und dabei einen jungen Nationalsozialisten tödlich
trafen.
Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Wiesbaden und
Umgebung" vom 9. März 1927: "Am 6. März 1927 hatte der jüdische
Landwirt Hermann Hennig aus Nastätten im Taunus eine Versammlung in
das dortige Hotel Guntrum einberufen mit dem Thema 'Das wahre Gesicht der
Nationalsozialisten'. Als Redner waren Geistliche verschiedener
Konfessionen vorgesehen. Auf die Ankündigung der Versammlung in der
Zeitung waren Hakenkreuzlergruppen aus Köln, Neuwied, Koblenz, Wiesbaden
und anderen Orten mit Lastautos herbeigeeilt, um gegen die Veranstaltung
zu demonstrieren. Die Versammlung wurde aber noch vor ihrem Beginn von den
anwesenden Landjägern wegen Überfüllung des Saales verboten, worauf
sich die Teilnehmer ins Freie begaben und der nationalsozialistische
Gauleiter des Bezirks Rheinland, der bekannte Dr. Ley, von einem Auto
herab eine Rede hielt, die mit den Worten schloss: 'Nassauer Bauern,
verteidigt euer Eigentum, und wenn es mit der Mistgabel sein müsste'. Die
Erregung, die alle Teilnehmer erfasst hatte, führte zu Wortgefechten und
schließlich zu Tätlichkeiten, in den Verlauf sowohl der Einberufer der
Versammlung, Hennig, einen tritt vor den Bau erhielt, als auch zwei andere
Juden aus der Umgebung Nastättens verprügelt wurden. Hennig, der sich in
das Hotel Guntrum begeben hatte, sah, wie ein Nationalsozialist auf einen
Juden einschlug und versetzte deshalb vom Fenster aus einem Angreifer mit
der Faust einen Hieb. Dieser Schlag war das Signal für einen Sturm auf
das Hotel, in dessen Verlauf die bedrängten Landjäger von der Waffe
Gebrauch machten und dabei einen jungen Nationalsozialisten tödlich
trafen.
Wegen dieser Vorfälle hatte die Staatsanwaltschaft Wiesbaden Anklage
gegen 18 Nationalsozialisten wegen Landfriedensbruch und gegen Hennig
wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben. Die für den 28. Februar
anberaumte Verhandlung, für die vier Tage vorgesehen waren, bildete seit
Wochen das Tagesgespräch in Wiesbaden und eine Sensation für die
völkische Presse. Mit großen Worten waren als Verteidiger der aus den Fememordprozessen
bekannte Rechtsanwalt Dr. Sack - Berlin und der Kronanwalt der Münchener
Hitlerleute Dr. Frank angekündigt. Erschienen war jedoch nur Rechtsanwalt
Dr. Sack, für dessen Unkosten die Wiesbadener Nationalsozialisten am
Abend des zweiten Verhandlungstages in einer öffentlichen Versammlung den
Klingelbeutel rührten und an Ort und Stelle eine Sammlung vornahmen. Der
jüdische Angeklagte Hennig wurde von Rechtsanwalt Dr. Martin Marx -
Frankfurt am Main vertreten.
Der Verlauf der Verhandlung brachte den in großer Zahl von auswärts
erschienenen Nationalsozialisten und Pressevertretern dank der
vorbildlichen und sich auf den reinen Prozessstoff beschränkenden Leitung
des Vorsitzenden (Landgerichtsdirektor Dr. Gellhorn) eine große
Enttäuschung. Unter Weglassung aller Nebensächlichkeiten, insbesondere
aller politischen Gesichtspunkte und Gegensätze, wurden sowohl Angeklagte
wie Zeugen nur insoweit vernommen, als dies die zur Verhandlung stehende
Tat erforderte. Infolgedessen konnte auch der Gauleiter Dr. Ley - Köln
seine offenbar vorbereitete politische Rede nicht an den Mann bringen,
sondern wurde nach Beantwortung einer einzelnen Frage als entbehrlich
entlassen. Der eingangs der Verhandlung ausgesprochenen Bitte des
Vorsitzenden, jede politische Schärfe zu vermeiden, trugen, wie am
Schlusse der Verhandlung nochmals anerkannt wurde, alle Prozessbeteiligten
Rechnung. So wurden auch die Anträge der Staatsanwaltschaft und das
Urteil selbst in aller Ruhe aufgenommen. Während die Anklagebehörde
gegen die achtzehn Angeklagten die Mindestgefängnisstrafe von je sechs
Monaten forderte, beantragte sie gegen Hennig eine Geldstrafe von 300 Mark
wegen hinterlisten Überfalls und ließ die Anklage wegen gefährlicher
Körperverletzung fallen, weil bei den widerspruchsvollen Zeugenaussagen
den Angaben des Angeklagten, dass er nur mit der Hand geschlagen habe,
Glauben geschenkt werden müsse.
Das Urteil lautete für elf Angeklagte auf je sechs Monate Gefängnis mit
Bewährungsfrist nach Verbüßung von 1-3 Monaten der Strafe, für sieben
Angeklagte auf Freisprechung und für Hennig auf Einstellung des
Verfahrens unter Überbürdung der Kosten auf die Staatskasse. In der
Begründung führte der Vorsitzende aus, dass entsprechend dem Vortrag
sämtlicher Verteidiger nur auf die Mindeststrafe erkannte worden sei, um
die Angeklagten nicht zu Märtyrern zu stempeln und keine neue
Verbitterung zu schaffen, sondern das friedliche Zusammenleben zu
fördern. Bei Hennig wurde entsprechend den Ausführungen seines
Verteidigers anerkannt, dass der in nervöser Aufwallung geführte Schlag
nicht als hinterlistiger Überfall zu erachten sei, dass aber für die
Bestrafung wegen einfacher Körperverletzung von dem Verletzten der
gesetzlich erforderliche Strafantrag zu spät gestellt worden
sei.
Im Anschluss an die Verhandlung war für Sonntag, 6. März, dem Jahrestag
der Erschießung des Nationalsozialisten in Nastätten, eine große
Kundgebung in dem benachbarten Singhofen mit Einweihung eines Gedenksteins
geplant, zu der Abordnungen der Hakenkreuzler aus allen Windrichtungen
kommandiert waren. Wie wir hören, hat die zuständige Behörde diese
Kundgebung verboten.
Es steht zu hoffen, dass durch die Reinigung der Atmosphäre, die der
Prozess zweifellos gebracht hat, die politischen Gegensätze in Nastätten
und Umgebung in Zukunft nicht mehr Formen annehmen werden, die das
friedliche Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsklassen
beeinträchtigen. Dr. M." |
Eine jüdische Jugendgruppe wurde
gegründet (1933)
 Artikel
im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. Januar 1933: "Nastätten. Am
Jahresende wurde eine 'Jüdische Jugendgruppe' gegründet, die bereits
30 Mitglieder aus Nastätten, Miehlen
und Holzhausen zählt. Ihre Aufgabe ist die Pflege jüdischen Wissens. Bei der
eigentlichen Gründungsfeier am 14. Januar wird Bezirksrabbiner Dr.
Laupheimer, auf dessen Anregung der Verein ins Leben gerufen wurde,
einen Vortrag halten." Artikel
im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. Januar 1933: "Nastätten. Am
Jahresende wurde eine 'Jüdische Jugendgruppe' gegründet, die bereits
30 Mitglieder aus Nastätten, Miehlen
und Holzhausen zählt. Ihre Aufgabe ist die Pflege jüdischen Wissens. Bei der
eigentlichen Gründungsfeier am 14. Januar wird Bezirksrabbiner Dr.
Laupheimer, auf dessen Anregung der Verein ins Leben gerufen wurde,
einen Vortrag halten." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Lehrlingssuche des Gemischtwarengeschäftes Hermann
Grünewald (1901)
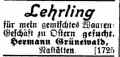 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Februar 1901:
"Lehrling Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Februar 1901:
"Lehrling
für mein gemischtes Waren-Geschäft zu Ostern gesucht.
Hermann Grünewald, Nastätten." |
Todesanzeige für den Lehrer i.R. Jakob Salomon (1936)
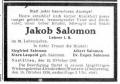 Anzeige
in der Zeitschrift "Israelitisches Familienblatt" vom 15. Oktober 1936:
"Statt jeder besonderen Anzeige! Anzeige
in der Zeitschrift "Israelitisches Familienblatt" vom 15. Oktober 1936:
"Statt jeder besonderen Anzeige!
Heute entschlief nach kurzer Krankheit unser innigst geliebter,
treusorgender Vater und Großvater, unser lieber Bruder, Schwager und Onkel
Jakob Salomon
Lehrer i. R.
im 91. Lebensjahre.
In tiefer Trauer die Kinder:
Siegfried Salomon Albert Salomon
Klara Leopold geb. Salomon Dr. Eugen Salomon
Nastätten, den 12. Oktober 1936
Die Beerdigung findet in seinem langjährigen Wirkungskreise
Altenkirchen (Westerw.), Donnerstag,
den 15. Oktober 1936, nachmittags 3 Uhr, statt." |
Zur Geschichte der Synagoge
Zunächst war ein Gebetsraum (Synagoge, "Jurreschul")
in einem jüdischen Wohnhaus vorhanden. Er befand sich bis 1904 im Wohnhaus des
jüdischen Lehrers Gustav Oppenheimer an der Ecke Römer-/Poststraße.
Im
Oktober 1865 stand ein für die jüdische Gemeinde und den ganzen Ort
festliches Ereignis an. Die Einweihung einer neuen Torarolle und ihre
Überbringung in die Synagoge durch eine feierliche Prozession.
 Die Zeitschrift
"Der Israelit" berichtete am 25. Oktober 1865: "Nastätten (Herzogtum
Nassau). Mittwoch, der 11. Oktober, muss gewiss der israelitischen
Kultusgemeinde zu Nastätten noch lange in freundlichem Andenken bleiben.
Verkündeten auch nicht Böllerschüsse und Glockengeläute den Festesmorgen, so
war es doch ein solcher, und gewiss ein recht schöner. Galt es ja der Weihe
einer von der frommen und gottesfürchtigen Familie Oppenheimer daselbst, der
Synagoge zum Geschenk gemachten Sefer Tora (Torarolle). Die Zeitschrift
"Der Israelit" berichtete am 25. Oktober 1865: "Nastätten (Herzogtum
Nassau). Mittwoch, der 11. Oktober, muss gewiss der israelitischen
Kultusgemeinde zu Nastätten noch lange in freundlichem Andenken bleiben.
Verkündeten auch nicht Böllerschüsse und Glockengeläute den Festesmorgen, so
war es doch ein solcher, und gewiss ein recht schöner. Galt es ja der Weihe
einer von der frommen und gottesfürchtigen Familie Oppenheimer daselbst, der
Synagoge zum Geschenk gemachten Sefer Tora (Torarolle).
Schon Tags zuvor waren viele Hände beschäftigt, um Vorbereitung zur würdigen
Feier des Tages zu treffen. Fahnen wurden ausgehängt, Girlanden gewunden,
passende Transparente angefertigt, Illuminationen etc. vorbereitet. Wahrlich,
ein erhebender Moment war es für uns, die herrliche von Herrn J. Lissauer aus
Ungedanken angefertigte Sefer Tora in ihrem Heichal, umgeben von
Lichterglanz und Blumenduft, zu sehen. Wenn es überhaupt möglich ist, die
Tora, diesen unseren schönsten Schmuck, durch äußeren Reiz noch zu
verschönern, so hat Herr G. Oppenheimer diese Aufgabe erfüllt.
Haufenweise strömten Beschauer herbei, um die herrliche, in völligem
Blütenschmuck stehende Tora zu sehen. Herr Dr. Hochstädter von Ems war Tags
zuvor angekommen und sprach sich am Vorabend des Festtages in herrlichen Worten
über die Bedeutung solcher Tage aus, worin er besonders den religiösen Sinn
der Familie Oppenheimer anerkannte und lobte.
Nachdem man am Festesmorgen Haschama gemacht hatte, wurde um 9 1/2 Uhr
die Sefer Tora unter Sang und Klang in einem festlich geschmückten Zuge von der
Behausung des Herrn E.G. Oppenheimer nach der Synagoge gebracht, woselbst außer
Verrichtung der üblichen Gebete der Festredner Herr Dr. Hochstädter in einem 1
1/2stündigen, von Herzen kommenden und zu Herzen gehenden Vortrage die Vorzüge
unserer heiligen Tora ins klare Licht stellte und schließlich die Gemeinde
aufforderte, sich um dieses Panier zu scharen.
Wir aber verfolgen mit diesen Zeilen nur den Zweck, den Namen der höchsten
ehrenwerten Familie öffentlich zu nennen und den Wunsch auszudrücken, dass
solche Taten vielfache Nachahmung finden mögen, auf dass unsere heilige Tora,
unser Stab und unsere Stütze zu allen Zeiten, in recht vielfachen Exemplaren
vorhanden sein möge zur Zierde Israels und zur Veredlung der ganzen Menschheit.
Das walte Gott!".
|
| Hinweis: die 1865 eingeweihte Torarolle
wurde 2014 wiederentdeckt. Sie enthält auf einem dünnen
Pergamentstreifen auf dem Holzteller den Text: "Das Torabuch ist geschrieben vom geehrten Jaakov, Sohn des geehrten Reb Mosche Lissauer, Schreiber aus Ungedanken im Land Kur-Hessen. Die Torarolle ist hier in die Synagoge Nastätten an Hoschana Rabba (5)626 gebracht worden." Das hebräische Datum ist der 7. Tag des Laubhüttenfestes, eben der 11. Oktober 1865. |
Um die
Wende zum 20. Jahrhundert war der bisherige Betsaal zu klein geworden; die jüdische
Gemeinde wünschte den Bau einer repräsentativen Synagoge. Im Januar 1902
reichte die Gemeinde das Baugesuch ein. Man konnte ein Grundstück an der
Rheinstraße erwerben. Die Pläne für die Synagoge zeichnete der Nastätter
Architekt Christian Schuck. 1903/04 konnte die Synagoge erbaut und am 29./30.
Juli 1904 unter großer Anteilnahme der Bevölkerung eingeweiht werden:
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. Juli 1904: "Nastätten.
Synagogeneinweihung. Am 29. und 30. Juli dieses Jahres findet dahier die
feierliche Einweihung der hiesigen Synagoge durch den Bezirksrabbiner Weingarten
- Ems mit folgendem Programm statt. Für Freitag, 29. ist die Überführung der
Tora aus der alten in die neue Synagoge geplant. Daran anschließend wird sich
ein Festzug durch die Stadt unter Beteiligung sämtlicher hiesiger Vereine und
unter Mitwirkung der gesamten Militärkapelle des 8. Pionier-Regiments zu
Koblenz bewegen. Herr Landrat Berg - St. Goarshausen hat zu der Festlichkeit
sein Erscheinen zugesagt." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. Juli 1904: "Nastätten.
Synagogeneinweihung. Am 29. und 30. Juli dieses Jahres findet dahier die
feierliche Einweihung der hiesigen Synagoge durch den Bezirksrabbiner Weingarten
- Ems mit folgendem Programm statt. Für Freitag, 29. ist die Überführung der
Tora aus der alten in die neue Synagoge geplant. Daran anschließend wird sich
ein Festzug durch die Stadt unter Beteiligung sämtlicher hiesiger Vereine und
unter Mitwirkung der gesamten Militärkapelle des 8. Pionier-Regiments zu
Koblenz bewegen. Herr Landrat Berg - St. Goarshausen hat zu der Festlichkeit
sein Erscheinen zugesagt."
|
Nur 34 Jahre blieb die Nastätter Synagoge Zentrum des jüdischen Gemeindelebens
der Stadt. In der NS-Zeit kam es zu Ausschreitungen gegen die Synagoge bereits
im März 1937, als die Fenster der Synagoge eingeworfen wurden. Eine
Reparatur wurde nicht vorgenommen, da eine Wiederholung einer solchen Aktion
befürchtet wurde. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung der
Synagoge durch Nationalsozialisten und SA-Leuten aus Nastätten und der Umgebung
zerstört. Der goldene Davidstern wurde vom Giebel geholt.
Die
Synagogenruine wurde im März 1939 abgebrochen und das Grundstück
eingeebnet.
Nach 1945 blieb das Grundstück unbebaut und wurde als Parkplatz
angelegt. Eine Gedenktafel wurde im Juli 1987 angebracht: "Zum
Gedenken an das Schicksal unserer jüdischen Mitbürger. Hier stand die Synagoge
bis 1938. Stadt Nastätten".
Adresse/Standort der Synagoge: Rheinstraße/Ecke
Brühlstraße
Fotos
(Quelle der historischen Fotos und Pläne: Landesamt:
Synagogen s.Lit.; neue Fotos: Hahn, Aufnahmen im August 2006)
Pläne zum Bau der
Synagoge
von Christian Schuck |
 |
 |
| |
Seitenansicht |
Vorderansicht |
| |
|
|
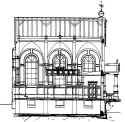 |
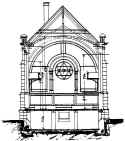 |
 |
| Längsschnitt |
Querschnitt |
Handwerker vor dem Toraschrein
1904 |
| |
|
|
| |
 |
 |
| |
Die ehemalige Synagoge
nach
der Einweihung 1904 |
Die zerstörte Synagoge Ende
1938
(Haus rechts der Synagoge entspricht dem
Haus in der unteren Zeile
linkes Foto) |
| |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Blick auf den
Synagogenplatz |
Die Gedenktafel |
| |
|
|
| |
|
|
| Andernorts
entdeckt |
 |
| |
Grabstein
für Hermann Hennig aus Nastätten (1870 - 1940) im jüdischen
Friedhof
an der Eckenheimer Landstraße in Frankfurt am Main |
| |
|
|
Erinnerungsarbeit
vor Ort - einzelne Berichte
| Februar 2014:
Eine Torarolle aus Nastätten wurde gefunden |
Artikel von Winfried Ott in der
"Rhein-Zeitung" vom 20. Februar 2014: "Thorarolle aus Nastätten gefunden
Nastätten - Es mutet wie ein kleines Wunder an: In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 kamen bei der Schändung der Synagoge alle Kultgegenstände abhanden. Jetzt tauchte auf recht geheimnisvolle Weise eine beschädigte und damit entweihte Thorarolle wieder auf, die nachweislich am 11. Oktober 1865 der jüdischen Gemeinde Nastätten übergeben worden war..."
Link
zum Artikel |
| |
Juni 2019:
Die dritte Verlegung von
"Stolpersteinen" in Nastätten
Anmerkung: auf Initiative der Nicolaus-August-Otto-Schule wurden am 26.
Juni 2019 zum dritten Mal "Stolpersteine" in Nastätten verlegt, dieses Mal
26. Damit erinnern nun 60 solcher Steine an die früheren jüdischen Einwohner
der Stadt. |
Einladung zur Verlegung von "Stolpersteinen"
in der Website der Nicolaus-August-Otto-Schule in Nastätten im Juni 2019: "Nastätten.
Dritte Verlegung von Stolpersteinen in Nastätten
Die IGS Nastätten initiiert die dritte Verlegung von Stolpersteinen am
26.06.2019 in Nastätten. Wie in der Vergangenheit auch wird die Schule
tatkräftig durch die Verbandsgemeinde, die Stadt Nastätten und die Kirchen
unterstützt. Die erste Verlegung fand im Februar 2014 statt, die zweite dann
im Juli 2016. Von dem Künstler Gunter Demnig gestaltete Messinggedenksteine
werden vor den Wohnhäusern von Opfern des NS-Regimes verlegt. In der
geplanten dritten und letzten Verlegung werden 26 weitere Steine verlegt.
Insgesamt liegen dann in Nastätten 60 Steine im Boden vor den ehemaligen
Wohnhäusern der Opfer. Die Schule möchte jetzt schon zu der Verlegung
einladen.
Die Stolpersteinverlegung wird ausschließlich aus Spendengeldern finanziert.
Wer sich mit einem Betrag beteiligen möchte, der ist herzlich zu einer
Spende aufgerufen (Förderkreis der IGS Nastätten, Volksbank, DE 94 5709 2800
0208 5221 83). Spendenbescheinigungen werden ausgestellt.
Die Schule bedankt sich für das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, die
mit viel Herz und Verstand mitgeholfen haben, die Verlegung zu realisieren."
|
| |
Pressemitteilung in "Blaues Ländchen
aktuell" - Heimat- und Bürgerzeitung VG Nastätten. Ausgabe 28/2019: "Stolpersteine
erinnern an Nastätter Juden
Auf Initiative der Nicolaus-August-Otto-Schule wurden am Mittwoch, den 26.
Juni 2019 zum dritten Mal Stolpersteine in Nastätten verlegt. Die ersten
Steine wurden im Februar 2014 gesetzt. Die Kosten dafür erwirtschafteten die
Schülerinnen und Schüler der IGS mit verschiedenen Aktionen. Im Juli 2016
wurden weitere 20 Steine von dem Künstler Gunther Demnig verlegt. Im Juni
2019 stand Geld für die letzten 26 Steine zur Verfügung, an denen sich
diesmal auch die Stadt Nastätten finanziell beteiligte. Damit fand das
Projekt seinen Abschluss. Die Namen der jüdischen Mitbürger verlasen
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe elf. Pfarrer Kristian Körver und
Pfarrer Michael Wallau sprachen ein jüdisches Gedenkgebet auf Deutsch und
Hebräisch. Die Steine sollen ein Zeichen dafür sein, dass
Menschenverachtung, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsradikalismus
keinen Platz in unserer Gesellschaft haben dürfen." |
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 | Paul Arnsberg: Jüdische Gemeinden in Hessen. 1971
Bd. 2 S. 101-103.
|
 | Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt
des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies
ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland. Mainz 2005. S. 280-282 (mit weiteren Literaturangaben).
|
 | Brigitte Meier-Hussing: Jüdisches Leben in
Nastätten und Miehlen in der Zeit von 1933-1945. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit
in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor
und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für
politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad
Kreuznach. 7. Jahrgang, Ausgabe 1/1997 Heft Nr. 13 S. 19-23. Online
zugänglich (pdf-Datei). |
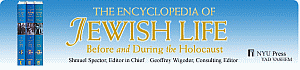
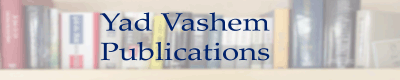
Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the
Holocaust".
First published in 2001 by NEW
YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad
Vashem Jerusalem, Israel.
Nastaetten Hesse-Nassau.
Jews lived here from 1664 and established a community numbering 79 (5 % of the
total) in 1885 and 49 in 1933. The synagogue was destroyed on Kristallnacht
(9-10 November 1938) and at least 15 Jews emigrated.



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|