|
Eingangsseite
Aktuelle Informationen
Jahrestagungen von Alemannia Judaica
Die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
Jüdische Friedhöfe
(Frühere und bestehende) Synagogen
Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale
in der Region
Bestehende jüdische Gemeinden
in der Region
Jüdische Museen
FORSCHUNGS-
PROJEKTE
Literatur und Presseartikel
Adressliste
Digitale Postkarten
Links
| |
zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"
zur Übersicht "Synagogen
im Elsass"
Saint-Louis
(St. Ludwig,
Dep. Haut-Rhin / Alsace / Oberelsass)
Jüdische Geschichte / Synagogue / Synagoge
Übersicht:
Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde
In Saint-Louis zogen die ersten jüdischen Familien in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts nahmen
sie am jüdischen Gemeindeleben im benachbarten
Hüningen (Huningue) teil und besuchten die dortigen Gottesdienste. Nachdem
sich Saint-Louis immer mehr entwickelte, zogen seit Mitte des 19. Jahrhunderts
aus etwa 25 jüdischen Dörfern der weiteren Umgebung jüdische Familien zu.
Eine größere Gruppe bildeten die aus Hagenthal
zugezogenen Familien. Ende des 19. Jahrhunderts lebten etwa 60 jüdische
Personen in der Stadt.
1906 wurde eine von Hüningen selbständige
Gemeinde in Saint-Louis gegründet. Im folgenden Jahr 1907 konnte die bis
heute stehende Synagoge eingeweiht werden (siehe Bericht unten). In diesem Jahr
wurde auch der Sitz des Rabbinates von Hégenheim
nach Saint-Louis verlegt. Der damalige Inhaber des Rabbinates war Dr. Salomon
Schüler, der bis zu seinem Tod im September 1938 Rabbiner von Saint-Louis
geblieben ist.
An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge, eine jüdische
Schule und ein rituelles Bad. Die Toten der Gemeinde wurden im
jüdischen Friedhof Hegenheim beigesetzt.
Zur Besorgung religiöser Aufgaben war neben dem Rabbiner zeitweise ein Lehrer
angestellt, der zugleich als Kantor und Schochet tätig war (vgl. Ausschreibung
unten von 1899). 1913 wird als Kantor Herr Jakob genannt.
Nach dem Ersten Weltkrieg zogen mehrere ostjüdische Familien zu.
Seit 1933 vergrößerte sich die Gemeinde stark durch Flüchtlinge aus
Deutschland. Die Synagoge war dadurch zu klein geworden. Ein Anbau wurde
erstellt, zu dem hin Türen vom Betsaal geöffnet werden konnten (später
Wintersynagoge). In der NS-Zeit konnten viele der Gemeindeglieder flüchten,
teilweise in die nahe Schweiz, andere wurden deportiert und in
Konzentrationslagern ermordet.
Auf dem Gedenkstein für die Ermordeten in der NS-Zeit im jüdischen Friedhof in
Hegenheim stehen folgende Namen: Benni (Benjamin) Bloch (1904), Paul Bloch,
Gertrude Bloch geb. Bloch, Claudine Bloch, Bernhard Bloch, Henri Norach, Renée
Borach geb Levy (1900), Paul Geismar (1919), Emile Jacob (1877), Florette Jacob
geb. Kahn (1883), Lucien Levy, Esther Levy geb. Lamm.
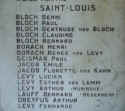 |
 |
|
Die in der Zeit
des Shoa ermordeten Juden aus Saint-Louis
(auf dem Gedenkstein im Friedhof
Hegenheim) |
|
Nach 1945 konnte die Gemeinde neu begründet werden.
Sie besteht bis zur Gegenwart. Als besondere Einrichtung besteht am Ort eine Jeschiwa.
Das Rabbinat St. Louis wurde gleichfalls wiederbesetzt. Als Rabbiner waren in
St. Louis tätig:
- Rabbiner Brandeis: ab 1939 in St. Louis.
- Rabbiner Roger Winsbacher (geb. 1928): von 1952 bis 1958 Rabbiner in St.
Louis.
- Rabbiner Jérôme Cahen (geb. 1929, gest. 1987): von 1958 bis 1960
Rabbiner in St. Louis.
- Rabbiner Edmond Schwob (geb. 1936): von 1961 bis 1964 Rabbiner in St.
Louis.
- Rabbiner Marx Meyer (geb. 1938): ab 1965 Rabbiner in St. Louis.
Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde
Aus der Geschichte des Rabbinates
Verlegung des Rabbinates von Hegenheim nach St. Ludwig (1907)
 Artikel
aus dem "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. August
1907: "St. Ludwig. Nachdem Herrn Rabbiner Dr. Schüler von Seiten des
Kaiserlichen Ministeriums Ende vorigen Jahres die Erlaubnis erteilt worden
war, seinen Wohnsitz von Hegenheim, das leider von Tag zu Tag abnimmt,
nach der neugegründeten Gemeinde St. Ludwig zu verlegen, ist nunmehr von
Seiten des Kaiserlichen Statthalters für Elsass-Lothringen die
landesherrliche Ermächtigung zur Verlegung des Rabbinates von Hegenheim
nach St. Ludwig eingetroffen. Artikel
aus dem "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. August
1907: "St. Ludwig. Nachdem Herrn Rabbiner Dr. Schüler von Seiten des
Kaiserlichen Ministeriums Ende vorigen Jahres die Erlaubnis erteilt worden
war, seinen Wohnsitz von Hegenheim, das leider von Tag zu Tag abnimmt,
nach der neugegründeten Gemeinde St. Ludwig zu verlegen, ist nunmehr von
Seiten des Kaiserlichen Statthalters für Elsass-Lothringen die
landesherrliche Ermächtigung zur Verlegung des Rabbinates von Hegenheim
nach St. Ludwig eingetroffen. |
| |
 Artikel
aus der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. August 1907:
"St. Ludwig, 12. August (1907). Nachdem Herrn Rabbiner Dr. Schüler
von Seiten des Kaiserlichen Ministeriums Ende vorigen Jahres die Erlaubnis
erteilt worden war, seinen Wohnsitz von Hegenheim, das leider fortwährend
abnimmt, nach St. Ludwig zu verlegen, ist nunmehr von Seiten des
Kaiserlichen Statthalters für Elsass-Lothringen die landesherrliche
Ermächtigung eingetroffen, dass der Sitz des Rabbinats von Hegenheim nach
St. Ludwig verlegt werde. Herr Dr. Schüler bleibt nach wie vor Rabbiner
von Hegenheim, nur verwaltet er die Filialgemeinden Hegenheim,
Hüningen
und Bischweiler sowie das Rabbinat
Hagenthal von St. Ludwig aus." Artikel
aus der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. August 1907:
"St. Ludwig, 12. August (1907). Nachdem Herrn Rabbiner Dr. Schüler
von Seiten des Kaiserlichen Ministeriums Ende vorigen Jahres die Erlaubnis
erteilt worden war, seinen Wohnsitz von Hegenheim, das leider fortwährend
abnimmt, nach St. Ludwig zu verlegen, ist nunmehr von Seiten des
Kaiserlichen Statthalters für Elsass-Lothringen die landesherrliche
Ermächtigung eingetroffen, dass der Sitz des Rabbinats von Hegenheim nach
St. Ludwig verlegt werde. Herr Dr. Schüler bleibt nach wie vor Rabbiner
von Hegenheim, nur verwaltet er die Filialgemeinden Hegenheim,
Hüningen
und Bischweiler sowie das Rabbinat
Hagenthal von St. Ludwig aus." |
Das Rabbinat Rixheim wird aufgelöst
und soll dem Rabbinat St. Louis angegliedert werden (1909)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Dezember 1909: "Mühlhausen
im Elsass, 25. November. Bei der von der Regierung beabsichtigten
Neueinteilung der Rabbinate, ist bekanntlich für Mühlhausen ein zweiter
Rabbiner in Aussicht genommen. Die Verwaltungskommission der hiesigen
israelitischen Gemeinde hat sich jedoch gegen dieses Vorhaben der Regierung
gewandt, in dem sie folgendes geltend machte: 'es ist in Mühlhausen kein
Bedürfnis für zwei Rabbinatstellen vorhanden, nachdem der jetzt amtierende
Rabbiner reichlich Zeit übrig hat, um die rituellen Funktionen in
Rixheim und
Habsheim mitbesorgen zu können. Sollte
das Kaiserliche Ministerium eine gegenteilige Ansicht vertreten, so
erscheint die Anlieferung der Gemeinden
Rixheim und Habsheim zweckmäßiger
an den Rabbinatsbezirk St. Ludwig, welcher eine sehr geringe
israelitische Bevölkerung aufweist.' Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Dezember 1909: "Mühlhausen
im Elsass, 25. November. Bei der von der Regierung beabsichtigten
Neueinteilung der Rabbinate, ist bekanntlich für Mühlhausen ein zweiter
Rabbiner in Aussicht genommen. Die Verwaltungskommission der hiesigen
israelitischen Gemeinde hat sich jedoch gegen dieses Vorhaben der Regierung
gewandt, in dem sie folgendes geltend machte: 'es ist in Mühlhausen kein
Bedürfnis für zwei Rabbinatstellen vorhanden, nachdem der jetzt amtierende
Rabbiner reichlich Zeit übrig hat, um die rituellen Funktionen in
Rixheim und
Habsheim mitbesorgen zu können. Sollte
das Kaiserliche Ministerium eine gegenteilige Ansicht vertreten, so
erscheint die Anlieferung der Gemeinden
Rixheim und Habsheim zweckmäßiger
an den Rabbinatsbezirk St. Ludwig, welcher eine sehr geringe
israelitische Bevölkerung aufweist.'
Wie man hört will sich auch der Gemeinderat, der sich in seiner heutigen
Sitzung mit der Angelegenheit befassen wird, dem Antrag der jüdischen
Gemeinde anschließen."
|
| |
 Artikel
in "Die jüdische Presse" vom 14. Januar 1910: "Fast
durchgehend verlieren die Gemeinden ihre bisherigen Rabbiner ungern;
andererseits wird - was nicht gerade als ein Beweis opferwilligen Interesses
gelten kann - der Neueinstellung eines Rabbiners wegen Mehrbelastung ihres
Etats von einzelnen Gemeinden Widerstand entgegengesetzt. Letzteres ist in
einer der weitaus leistungsfähigsten Gemeinden, in
Mühlhausen, der Fall. Hier soll neben
dem bestehenden ein zweites Rabbinat (Mühlhausen-Süd) eingerichtet werden,
dass die Gemeinden Pfaffstadt, Rixheim
und Habsheim mit umfasst. Gegen die
Anstellung eines zweiten Rabbiners hat sich nun die Verwaltungskommission
der Gemeinde Mühlhausen mit der Begründung ausgesprochen, dass der
derzeitige Rabbiner zur vollsten Zufriedenheit sein Amt auch in den
angeschlossenen Filialgemeinden versehen. Die Regierung holte ein Gutachten
des Gemeinderats ein, das einstimmig im Sinne des Beschlusses der
Verwaltungskommission lautete. Über ein gegen diesen Beschluss sich
richtendes Schreiben des Herrn Konsistorialrats Bernheim wurde vom
Gemeinderat zur Tagesordnung über gegangen, seine Inhalt als eine Äußerung
der Antipathie gegen den derzeitigen Rabbiner bezeichnet ein Abbild der
gegenwärtigen unerquicklichen Mühlhausener Gemeindeverhältnisse. Die
Verwaltungskommission ihrerseits empfahl der Regierung,
Habsheim und
Rixheim dem Rabbinat St. Ludwig
anzugliedern. " Artikel
in "Die jüdische Presse" vom 14. Januar 1910: "Fast
durchgehend verlieren die Gemeinden ihre bisherigen Rabbiner ungern;
andererseits wird - was nicht gerade als ein Beweis opferwilligen Interesses
gelten kann - der Neueinstellung eines Rabbiners wegen Mehrbelastung ihres
Etats von einzelnen Gemeinden Widerstand entgegengesetzt. Letzteres ist in
einer der weitaus leistungsfähigsten Gemeinden, in
Mühlhausen, der Fall. Hier soll neben
dem bestehenden ein zweites Rabbinat (Mühlhausen-Süd) eingerichtet werden,
dass die Gemeinden Pfaffstadt, Rixheim
und Habsheim mit umfasst. Gegen die
Anstellung eines zweiten Rabbiners hat sich nun die Verwaltungskommission
der Gemeinde Mühlhausen mit der Begründung ausgesprochen, dass der
derzeitige Rabbiner zur vollsten Zufriedenheit sein Amt auch in den
angeschlossenen Filialgemeinden versehen. Die Regierung holte ein Gutachten
des Gemeinderats ein, das einstimmig im Sinne des Beschlusses der
Verwaltungskommission lautete. Über ein gegen diesen Beschluss sich
richtendes Schreiben des Herrn Konsistorialrats Bernheim wurde vom
Gemeinderat zur Tagesordnung über gegangen, seine Inhalt als eine Äußerung
der Antipathie gegen den derzeitigen Rabbiner bezeichnet ein Abbild der
gegenwärtigen unerquicklichen Mühlhausener Gemeindeverhältnisse. Die
Verwaltungskommission ihrerseits empfahl der Regierung,
Habsheim und
Rixheim dem Rabbinat St. Ludwig
anzugliedern. " |
Zum Tod von Rabbiner Dr. Schüler (1938)
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Oktober 1938:
"Zum Ableben von Rabbiner Dr. Schüler. St. Louis - Basel, 20.
Oktober (1938). Die Kunde vom Tode des Rabbiners Dr. Schüler traf die
Gemeinde St. Louis völlig unerwartet, obwohl Dr. Schüler seit Jahren
leidend war. Aber trotz seines Leidens hat er alle Pflichten seines Amtes
wahrgenommen und mit großer Hingabe den Unterricht in den verschiedenen
Gemeinden versehen. Kurz vor Roschhaschana kam Dr. Schüler nach Basel, um
seine angegriffene Gesundheit unter die Obhut seines Sohnes zu stellen,
der dort als Arzt praktiziert, starb jedoch schon während des Feiertags.
Rabbiner Schüler kam 1889 nach Hegenheim, einer der früher bedeutenden
Landgemeinden, die jedoch dann unter der Landflucht sehr litt. Im Jahre
1907 bemühte sich Dr. Schüler, die in dem aufstrebenden Ort St. Lous
wohnenden Glaubensgenossen zu einer Gemeinde zusammenzuschließen und
verlegte den Sitz des Bezirksrabbinats dorthin. Während 31 Jahren versag
er das Rabbinat in St. Louis und ist den Gemeindemitgliedern zum Freund
und Berater geworden. Dort erzog er sich Menschen, mit denen er täglich
'lernte' und dadurch der Tora eine Stätte schuf in der jungen Gemeinde,
die besonders nach dem Krieg einen großen Zuwachs erfahren hat. Die
allseitige Beliebtheit von Herrn Dr. Schüler, die weit über die
jüdische Gemeinde hinausreichte, kam in dem großen Begräbnis zum
Ausdruck, das am Zom Gedalja stattfand. Die von zahlreichen Gästen
besuchte Trauerfeier wird in der lokalen Presse als 'Sympathiekundgebung
für den Verstorbenen und die Hinterbliebenen' bezeichnet. An dieser
Feierlichkeit nahmen neben den vollzählig erschienenen
Gemeindemitgliedern und vielen Rabbinern und Lehrern zahlreiche
nichtjüdische Vertreter von Behörden teil, unter ihnen der französische
Konsul und Vizekonsul in Basel, der Maire von St. Louis und der Maire von
Hegenheim, sowie die Geistlichen der beiden christlichen Konfessionen.
Nach einem Trauergebet sprach Herr Rein als Vorsitzender der Gemeinde St.
Louis, nach ihm der Maire von Sr. Louis, Dr. Hörst, und der Maire von
Hegenheim, Greder. Als Grand-Rabbin des Département Haut-Rhin würdigte
Rabbiner Dr. E. Weil, Colmar, die rabbinischen Verdienste des
Verstorbenen; Rabbiner Block, Dornach sprach im Namen der elsässischen
Rabbiner und Rabbiner Dr. Weil, Basel, als Nachbarkollege und
persönlicher Freund des Verstorbenen. Alle Redner schilderten in bewegten
Worten die vorzügliches Herzenseigenschaften von Rabbiner Schüler, in
dem alle einen vornehmen Menschen, einen gütigen Berater und viele ihren
Wohltäter beweinen. Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Oktober 1938:
"Zum Ableben von Rabbiner Dr. Schüler. St. Louis - Basel, 20.
Oktober (1938). Die Kunde vom Tode des Rabbiners Dr. Schüler traf die
Gemeinde St. Louis völlig unerwartet, obwohl Dr. Schüler seit Jahren
leidend war. Aber trotz seines Leidens hat er alle Pflichten seines Amtes
wahrgenommen und mit großer Hingabe den Unterricht in den verschiedenen
Gemeinden versehen. Kurz vor Roschhaschana kam Dr. Schüler nach Basel, um
seine angegriffene Gesundheit unter die Obhut seines Sohnes zu stellen,
der dort als Arzt praktiziert, starb jedoch schon während des Feiertags.
Rabbiner Schüler kam 1889 nach Hegenheim, einer der früher bedeutenden
Landgemeinden, die jedoch dann unter der Landflucht sehr litt. Im Jahre
1907 bemühte sich Dr. Schüler, die in dem aufstrebenden Ort St. Lous
wohnenden Glaubensgenossen zu einer Gemeinde zusammenzuschließen und
verlegte den Sitz des Bezirksrabbinats dorthin. Während 31 Jahren versag
er das Rabbinat in St. Louis und ist den Gemeindemitgliedern zum Freund
und Berater geworden. Dort erzog er sich Menschen, mit denen er täglich
'lernte' und dadurch der Tora eine Stätte schuf in der jungen Gemeinde,
die besonders nach dem Krieg einen großen Zuwachs erfahren hat. Die
allseitige Beliebtheit von Herrn Dr. Schüler, die weit über die
jüdische Gemeinde hinausreichte, kam in dem großen Begräbnis zum
Ausdruck, das am Zom Gedalja stattfand. Die von zahlreichen Gästen
besuchte Trauerfeier wird in der lokalen Presse als 'Sympathiekundgebung
für den Verstorbenen und die Hinterbliebenen' bezeichnet. An dieser
Feierlichkeit nahmen neben den vollzählig erschienenen
Gemeindemitgliedern und vielen Rabbinern und Lehrern zahlreiche
nichtjüdische Vertreter von Behörden teil, unter ihnen der französische
Konsul und Vizekonsul in Basel, der Maire von St. Louis und der Maire von
Hegenheim, sowie die Geistlichen der beiden christlichen Konfessionen.
Nach einem Trauergebet sprach Herr Rein als Vorsitzender der Gemeinde St.
Louis, nach ihm der Maire von Sr. Louis, Dr. Hörst, und der Maire von
Hegenheim, Greder. Als Grand-Rabbin des Département Haut-Rhin würdigte
Rabbiner Dr. E. Weil, Colmar, die rabbinischen Verdienste des
Verstorbenen; Rabbiner Block, Dornach sprach im Namen der elsässischen
Rabbiner und Rabbiner Dr. Weil, Basel, als Nachbarkollege und
persönlicher Freund des Verstorbenen. Alle Redner schilderten in bewegten
Worten die vorzügliches Herzenseigenschaften von Rabbiner Schüler, in
dem alle einen vornehmen Menschen, einen gütigen Berater und viele ihren
Wohltäter beweinen.
Nach der Feier bewegte sich der Zug nach dem Friedhof
Hegenheim, wo Dr.
Schüler in der Reihe der Rabbiner beigesetzt wurde. Nach seinem Wunsch
ruht er auf dem alten, ehrwürdigen Friedhof, für dessen Erhaltung er zu
Lebzeiten mit Hingabe wirksam war. Seine Seele sei eingebunden in den Bund
des Lebens." |
Der Krieg bedroht auch viele Orte mit jüdischen
Gemeinden im Oberelsass (1914)
Anmerkung: die angegebene Zahl der jüdischen Gemeindeglieder bezieht sich
auf ca. 1890.
 Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 18. September 1914: "Hagenau, 10. September (1914).
Die schweren Kämpfe im Oberelsaß, die in letzter Zeit zwischen den
Franzosen und Deutschen ausgefochten wurden, erinnern uns daran, dass die
dortige Gegend ziemlich stark von Juden bewohnt ist, die jetzt nicht nur
zum großen Teil gezwungen waren, Heim und Herd zu verlassen, sondern
neben der schweren seelischen Not auch viel durch die Zerstörung von Hab
und Gut zu dulden haben. Es wohnen in dem vielgenannten Altkirch
289 jüdische Seelen, Hirsingen 74, Dammerkirch (Dannemarie)
15, Hagenbach 26, Bergheim
110, Grussenheim 314, Neubreisach
102, Blotzheim 62, Bollweiler
120, Ensisheim 27, Regisheim
154, Dürmenach 205, Hegenheim
169, Hüningen 50, Kolmar
1105, Dornach 202, Mülhausen
2271, Niederhagental 145, Niedersept
124, Pfastatt 73, Markirch
147, Rappoltsweiler 134, Habsheim
73, Rixheim 69, Sennheim
151, Wattweiler (Wattwiller) 37, St.
Ludwig 60, Kembs 50, Sierenz
113, Uffheim 120, Gebweiler
305, Sulz 182, Thann
163, Winzenheim 421 Juden. Die
meisten Familien, besonders in der Mülhauser Gegend, haben sich flüchten
müssen, viele davon haben sich während dieser schweren Zeit in der
Schweiz niedergelassen.".
Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"
vom 18. September 1914: "Hagenau, 10. September (1914).
Die schweren Kämpfe im Oberelsaß, die in letzter Zeit zwischen den
Franzosen und Deutschen ausgefochten wurden, erinnern uns daran, dass die
dortige Gegend ziemlich stark von Juden bewohnt ist, die jetzt nicht nur
zum großen Teil gezwungen waren, Heim und Herd zu verlassen, sondern
neben der schweren seelischen Not auch viel durch die Zerstörung von Hab
und Gut zu dulden haben. Es wohnen in dem vielgenannten Altkirch
289 jüdische Seelen, Hirsingen 74, Dammerkirch (Dannemarie)
15, Hagenbach 26, Bergheim
110, Grussenheim 314, Neubreisach
102, Blotzheim 62, Bollweiler
120, Ensisheim 27, Regisheim
154, Dürmenach 205, Hegenheim
169, Hüningen 50, Kolmar
1105, Dornach 202, Mülhausen
2271, Niederhagental 145, Niedersept
124, Pfastatt 73, Markirch
147, Rappoltsweiler 134, Habsheim
73, Rixheim 69, Sennheim
151, Wattweiler (Wattwiller) 37, St.
Ludwig 60, Kembs 50, Sierenz
113, Uffheim 120, Gebweiler
305, Sulz 182, Thann
163, Winzenheim 421 Juden. Die
meisten Familien, besonders in der Mülhauser Gegend, haben sich flüchten
müssen, viele davon haben sich während dieser schweren Zeit in der
Schweiz niedergelassen.". |
Aus der
Geschichte der jüdischen Lehrer, Kantoren und der Schule
Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers, Vorbeters
und Schächters für Hüningen - St. Ludwig 1899, unterzeichnet vom Vorsteher der
Gemeinde St. Ludwig E. Weill
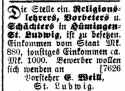 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. November 1899:
"Die Stelle eines Religionslehrers, Vorbeters und Schächters in
Hüningen - St. Ludwig, ist zu besetzen. Einkommen vom Staat Mk. 880,
sonstiges Einkommen ca. Mk. 1000. Bewerber wollen sich wenden an Vorsteher
E. Weill, Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. November 1899:
"Die Stelle eines Religionslehrers, Vorbeters und Schächters in
Hüningen - St. Ludwig, ist zu besetzen. Einkommen vom Staat Mk. 880,
sonstiges Einkommen ca. Mk. 1000. Bewerber wollen sich wenden an Vorsteher
E. Weill,
St. Ludwig." |
Kantor Jakob bewirbt sich auf die
Stelle in Saarburg (1913)
 Artikel
in "Das jüdische Blatt" vom 14. März 1913: "Saarburg. Um die hiesige
Kantorstelle haben sich zahlreiche Kandidaten beworben. Nach einer
Gesangesprobe sämtlicher Bewerber sind zur engeren Wahl zugelassen die
Herren: Wolff - Saarunion, Weill -
Winzenheim, Jakob - St. Ludwig und
Becker - Weißenburg. " Artikel
in "Das jüdische Blatt" vom 14. März 1913: "Saarburg. Um die hiesige
Kantorstelle haben sich zahlreiche Kandidaten beworben. Nach einer
Gesangesprobe sämtlicher Bewerber sind zur engeren Wahl zugelassen die
Herren: Wolff - Saarunion, Weill -
Winzenheim, Jakob - St. Ludwig und
Becker - Weißenburg. " |
Berichte
zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde
Emil Weill wird bei den Gemeinderatswahlen als
Gemeinderat gewählt (1908)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 10. Juli 1908:
"Straßburg. Die Gemeinderatswahlen haben auch eine stattliche
Anzahl Juden in die Stadtparlamente gebracht. Wir verzeichneten in der
vorwöchentlichen Nummer bereits eine Anzahl Namen. Es wurden ferner
gewählt: Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 10. Juli 1908:
"Straßburg. Die Gemeinderatswahlen haben auch eine stattliche
Anzahl Juden in die Stadtparlamente gebracht. Wir verzeichneten in der
vorwöchentlichen Nummer bereits eine Anzahl Namen. Es wurden ferner
gewählt:
Marc Blum, Max Frank und Fritz Meyer in Straßburg;
Gilbert Meyer, Abraham Bloch und Joseph Weil in Ingweiler;
David Levy in Dettweiler;
Nathan Heller in Brumath; Leo Ginsburger
in Uffheim; Dr. Leon Weill und
Arthur Moch in Hagenau;
Bernhard Baer und Leopold Klotz in Sulz
u.W.; Achille gen. Elie Weil in Bollweiler;
Jakob Schwab und Leon Bloch in Winzenheim;
Adrian Bloch und Ferdinand Dreyfus in Mülhausen;
Emil Weill in St. Ludwig;
Salomon Heimerdinger und Emile Picard in Grussenheim;
Silvani Beer und August Levy in Saarburg; Tuteur und Leiser
in Metz; Leopold Blum und Julien Levy in Umlingen, Felix Barth
in Forbach; Marcel Cahen und
Levy Aron in
Püttlingen." |
Anzeigen
jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen
Lehrlingsbesuch des
Manufakturwaren- und Ausstattungsgeschäftes Jos. Mayer (1890)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. September 1890: "Lehrlings-Gesuch. Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. September 1890: "Lehrlings-Gesuch.
Ein junger Mann, der das Manufakturwaren- und Ausstattungsgeschäft
gründlich erlernen will, findet Stelle bei
Jos. Mayer,
St. Ludwig im Elsass bei Basel.
Samstags und Feiertags streng geschlossen. Kost und Wohnung gegen mäßige
Vergütung im Hause." |
Eine Köchin empfiehlt sich (1896)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November 1896:
"Israelitische Köchin, Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November 1896:
"Israelitische Köchin,
welche in ersten Häusern in Paris
selbständig gearbeitet hat, empfiehlt sich für Hochzeiten, Verlobungen
und sonstige Anlässe.
Frau Moise Levy, Sankt Ludwig im Elsass (bei Basel). |
E. Haas sucht einen Commis für Manufakturwaren (1900 /
1901)
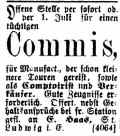 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1900: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1900:
"Offene
Stelle per sofort oder per 1. Juli für einen tüchtigen
Commis
für
Manufakturwaren, der schon kleinere Touren gereist, sowie als Comptoirist
und Verkäufer. Gute Zeugnisse erforderlich. Offerten nebst
Gehaltsansprüche bei freier Stadt gefälligst an E. Haas, St. Ludwig
i.E." |
| |
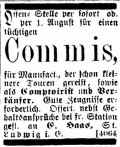 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juli 1900: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juli 1900:
"Offene Stelle per sofort oder per 1. August für einen
tüchtigen
Commis
für Manufakturwaren, der schon kleinere Touren gereist, sowie als Comptoirist
und Verkäufer. Gute Zeugnisse erforderlich. Offerten nebst
Gehaltsansprüche bei freier Station gefälligst an E. Haas, St.
Ludwig im Elsass." |
| |
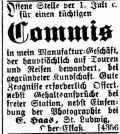 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1901: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1901:
"Offene Stelle per 1. Juli dieses Jahres für einen tüchtigen
Commis
in mein Manufaktur-Geschäft, der hauptsächlich auf Touren und Reisen
bewandert, bei gegründeter Kundschaft. Gute Zeugnisse erforderlich.
Offerten nebst Gehaltsansprüche bei freier Station, nebst Einsendung der
Photographie bei
E. Haas, St. Ludwig,
Ober-Elsass". |
S. Ruf - Guggenheim sucht einen Lehrling für sein Manufakturwarengeschäft
(1900)
 Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1900: Anzeige
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1900:
"Für mein Manufaktur-Herren- und Damen-Konfektionsgeschäft suche
per sofort einen
Lehrling.
Kost und Logis im Hause.
S. Ruf-Guggenheim,
St. Ludwig im Elsass." |
Zur Geschichte der Synagoge
Bis zum Bau und der Einweihung der eigenen Synagoge 1907
besuchten die in Saint-Louis lebenden jüdischen Personen die Gottesdienste in
Hüningen (Hueningue). Da der Weg nach
Hüningen vor allem bei schlechtem "zu beschwerlich war" und an den
Feiertagen die Synagoge in Hüningen nicht für alle Gemeindeglieder ausreichte,
beschlossen die in St. Ludwig lebenden jüdischen Einwohner die Bildung einer
eigenen Gemeinde und den Bau einer Synagoge. 1905 konnte hierfür ein
Gründstück erworben und noch im selben Jahre mit dem Bau der Synagoge begonnen
werden. Die Einweihung der Synagoge
bedeutete zugleich die Trennung von der jüdischen Gemeinde in Hüningen.
Nähere Informationen hierzu und der Einweihung der Synagoge gehen aus
nachstehenden Artikeln hervor:
Nach dem Erwerb eines Grundstückes kann mit dem Bau
einer Synagoge begonnen werden (Dezember 1905)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Dezember
1905: "St. Ludwig im Elsass, Bau einer Synagoge. Es sind ca. 3
Jahre her, da, einer Anregung von Seiten des Präsidenten des
Israelitischen Konsistoriums im Ober-Elsass, Herrn Lazard Lantz, folgend,
die in S. Ludwig wohnenden Mitglieder der bisherigen Kultusgemeinde
Hüningen - St. Ludwig beschlossen, eine selbständige Gemeinde zu bilden
und eine eigene Synagoge zu errichten. Sie gingen bei diesem Entschlusse
von den Erwägungen aus, dass die gemeinsame Synagoge in Hüningen für
die Feiertage ohnehin nicht mehr genüge und dass es beim schlechten
Wetter zu beschwerlich ist, den Gottesdienst zu besuchen. Infolge der
Rührigkeit der Baukommission und ihres Vorsitzenden, Herr Emil Weil, hat
der Plan des Synagogenbaues nun schon soweit greifbare Gestalt angenommen,
dass vor einigen Monaten bereits ein Platz in der Nähe des Marktplatzes
gekauft werden konnte. Nachdem nun auch der Bauplan von der Kaiserlichen
Regierung genehmigt worden ist, wurden die Arbeiten am vorigen Mittwoch
der Firma Schumacher aus Haltingen übertragen. Selbstverständlich wird
Samstags nicht gearbeitet werden. Die Synagoge muss bis zum 25. August
fertiggestellt sein." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Dezember
1905: "St. Ludwig im Elsass, Bau einer Synagoge. Es sind ca. 3
Jahre her, da, einer Anregung von Seiten des Präsidenten des
Israelitischen Konsistoriums im Ober-Elsass, Herrn Lazard Lantz, folgend,
die in S. Ludwig wohnenden Mitglieder der bisherigen Kultusgemeinde
Hüningen - St. Ludwig beschlossen, eine selbständige Gemeinde zu bilden
und eine eigene Synagoge zu errichten. Sie gingen bei diesem Entschlusse
von den Erwägungen aus, dass die gemeinsame Synagoge in Hüningen für
die Feiertage ohnehin nicht mehr genüge und dass es beim schlechten
Wetter zu beschwerlich ist, den Gottesdienst zu besuchen. Infolge der
Rührigkeit der Baukommission und ihres Vorsitzenden, Herr Emil Weil, hat
der Plan des Synagogenbaues nun schon soweit greifbare Gestalt angenommen,
dass vor einigen Monaten bereits ein Platz in der Nähe des Marktplatzes
gekauft werden konnte. Nachdem nun auch der Bauplan von der Kaiserlichen
Regierung genehmigt worden ist, wurden die Arbeiten am vorigen Mittwoch
der Firma Schumacher aus Haltingen übertragen. Selbstverständlich wird
Samstags nicht gearbeitet werden. Die Synagoge muss bis zum 25. August
fertiggestellt sein." |
Die Einweihung der Synagoge kommt näher (November 1906)
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. November
1906: "St. Ludwig. Immer näher rückt unsere Synagoge ihrer
Vollendung entgegen. Die Einweihung des neuen Gotteshauses soll im Monat
Dezember, womöglich am Chanukkah-Feste stattfinden. Durch den Bau einer
Synagoge trennt sich die hiesige israelitische Kultusgemeinde, die von
Jahr zu Jahr zunimmt, von der in Hüningen und wird eine selbstständige
Gemeinde." Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. November
1906: "St. Ludwig. Immer näher rückt unsere Synagoge ihrer
Vollendung entgegen. Die Einweihung des neuen Gotteshauses soll im Monat
Dezember, womöglich am Chanukkah-Feste stattfinden. Durch den Bau einer
Synagoge trennt sich die hiesige israelitische Kultusgemeinde, die von
Jahr zu Jahr zunimmt, von der in Hüningen und wird eine selbstständige
Gemeinde." |
Ankündigung der Einweihung der Synagoge (1907)
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 1. Februar 1907: "Die Einweihung der Synagoge in St.
Ludwig, nach welchem Orte auch das Rabbinat, dessen Sitz bisher Hegenheim
war, verlegt worden ist, ist auf den 5. Februar festgesetzt worden.
Hegenheim, das einst eine Gemeinde von 180 jüdischen Familien war, hat
eine schöne und gut erhaltene Synagoge. Doch jetzt wohnen nur noch wenige
jüdische Familien in Hegenheim und die Synagoge wird selten
benutzt." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 1. Februar 1907: "Die Einweihung der Synagoge in St.
Ludwig, nach welchem Orte auch das Rabbinat, dessen Sitz bisher Hegenheim
war, verlegt worden ist, ist auf den 5. Februar festgesetzt worden.
Hegenheim, das einst eine Gemeinde von 180 jüdischen Familien war, hat
eine schöne und gut erhaltene Synagoge. Doch jetzt wohnen nur noch wenige
jüdische Familien in Hegenheim und die Synagoge wird selten
benutzt." |
Die Einweihung der Synagoge im März 1907
 Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. März 1907: "St.
Ludwig, 11. März. Die hiesige Israelitische Gemeinde feierte vergangenen
Dienstag die Einweihung ihrer Synagoge. Als Ehrengäste waren erschienen
die Herren Ober-Rabbiner J. Weill aus Colmar, Geheimer Regierungsrat
Peucer in Vertretung des Bezirkspräsidenten Freiherr von Puttkammer aus
Colmar, Polizeipräsident und Kreisdirektor Dr. Dirihoff aus Mülhausen,
Rabbiner Schüler, der Vater des hiesigen Herrn Rabbiners, aus Bollweiler,
Pastor Birmele, Konsistorialrat Wallach, A. Ginzburger, Vorsteher der
israelitischen Gemeinde in Mülhausen, Bezirksrat Jaeck, Bürgermeister in
Hegenheim, Kantonal-Polizeikommissar Weinhagen, sowie fast sämtliche Gemeinderäte
von St. Ludwig. Herr Unterstaatssekretär Dr. Petri bedauerte in einem Schreiben,
der Einweihung nicht beiwohnen zu können und übersandte seine
herzlichsten Glückwünsche. Die Feier begann um 1 Uhr mit dem Festzug,
der sich vom Hotel John aus unter Vorantritt einer Musikkapelle, der die
Schulkinder folgten, nach der Synagoge bewegte. Dort übergab Herr
Regierungsrat Peucer den Schlüssel dem Herrn Oberrabbiner, der die
Synagoge öffnete. In der Synagoge empfing der Synagogenchor, der von
Herrn Kantor Lehmann geleitet war, die Festversammlung mit dem Vortrag
eines Psalms. Nach der Ansprache des Oberrabbiners begrüßte Rabbiner Dr.
Schüler die Festversammlung und knüpfte daran an, dass vor 45 Jahren
sein Großvater Oberrabbiner Salomon Wolf Klein - das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen - aus Colmar die Synagoge zu Hüningen, die so viele
Jahre auch der hiesigen Gemeinde als Andachtsstätte diente, eingeweiht
hat. Die Rede Dr. Schüler gipfelte in der Erklärung der Bedeutung und
des Zweckes des jüdischen Gotteshauses. Der Vorsteher der Gemeinde, Herr
E. Weill, dankte im Namen derselben allen Behörden und Privaten, die zum
Bau der Synagoge beigetragen hatten. Hierauf sprach Herr Rabbiner Dr.
Schüler das Kaisergebet. Die verschiedenen Reden und Ansprachen
wechselten mit Gesängen ab, die teils vom Herrn Kantor Lehmann, teils von
Herrn Kantor Weill aus Altkirch vorgetragen wurden. Kurz nach der
offiziellen Feier fand ein Bankett statt, bei welchem der Vorsitzende,
Herr E. Weill, das Hoch auf den Kaiser ausbrachte, in das alle Anwesenden
begeistert einstimmten. Herr Rabbiner Dr. Schüler dankte allen denen, die
zum Gelingen des Festes beigetragen hatten, ganz besonders aber hob er die
Verdienste des rührigen Vorstehers und seiner wackeren Gattin hervor. Das
Bankett dauerte bis zum Abend. - Die Synagoge ist ein schöner schlichter
Kuppelbau, nach den Plänen des Herrn Architekten Louv, Mühlhausen, von
der Firma Simon hier ausgeführt. Die innere Einrichtung lieferten Herr
Architekt Lehr und das Baugeschäft Groß hier. Das Parochet, die
Schulchan. Decke, ein Torarollen - Mäntelchen und die Menora sind aus dem
Atelier des Herrn Bloch, Strassburg." Artikel
in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. März 1907: "St.
Ludwig, 11. März. Die hiesige Israelitische Gemeinde feierte vergangenen
Dienstag die Einweihung ihrer Synagoge. Als Ehrengäste waren erschienen
die Herren Ober-Rabbiner J. Weill aus Colmar, Geheimer Regierungsrat
Peucer in Vertretung des Bezirkspräsidenten Freiherr von Puttkammer aus
Colmar, Polizeipräsident und Kreisdirektor Dr. Dirihoff aus Mülhausen,
Rabbiner Schüler, der Vater des hiesigen Herrn Rabbiners, aus Bollweiler,
Pastor Birmele, Konsistorialrat Wallach, A. Ginzburger, Vorsteher der
israelitischen Gemeinde in Mülhausen, Bezirksrat Jaeck, Bürgermeister in
Hegenheim, Kantonal-Polizeikommissar Weinhagen, sowie fast sämtliche Gemeinderäte
von St. Ludwig. Herr Unterstaatssekretär Dr. Petri bedauerte in einem Schreiben,
der Einweihung nicht beiwohnen zu können und übersandte seine
herzlichsten Glückwünsche. Die Feier begann um 1 Uhr mit dem Festzug,
der sich vom Hotel John aus unter Vorantritt einer Musikkapelle, der die
Schulkinder folgten, nach der Synagoge bewegte. Dort übergab Herr
Regierungsrat Peucer den Schlüssel dem Herrn Oberrabbiner, der die
Synagoge öffnete. In der Synagoge empfing der Synagogenchor, der von
Herrn Kantor Lehmann geleitet war, die Festversammlung mit dem Vortrag
eines Psalms. Nach der Ansprache des Oberrabbiners begrüßte Rabbiner Dr.
Schüler die Festversammlung und knüpfte daran an, dass vor 45 Jahren
sein Großvater Oberrabbiner Salomon Wolf Klein - das Andenken an den
Gerechten ist zum Segen - aus Colmar die Synagoge zu Hüningen, die so viele
Jahre auch der hiesigen Gemeinde als Andachtsstätte diente, eingeweiht
hat. Die Rede Dr. Schüler gipfelte in der Erklärung der Bedeutung und
des Zweckes des jüdischen Gotteshauses. Der Vorsteher der Gemeinde, Herr
E. Weill, dankte im Namen derselben allen Behörden und Privaten, die zum
Bau der Synagoge beigetragen hatten. Hierauf sprach Herr Rabbiner Dr.
Schüler das Kaisergebet. Die verschiedenen Reden und Ansprachen
wechselten mit Gesängen ab, die teils vom Herrn Kantor Lehmann, teils von
Herrn Kantor Weill aus Altkirch vorgetragen wurden. Kurz nach der
offiziellen Feier fand ein Bankett statt, bei welchem der Vorsitzende,
Herr E. Weill, das Hoch auf den Kaiser ausbrachte, in das alle Anwesenden
begeistert einstimmten. Herr Rabbiner Dr. Schüler dankte allen denen, die
zum Gelingen des Festes beigetragen hatten, ganz besonders aber hob er die
Verdienste des rührigen Vorstehers und seiner wackeren Gattin hervor. Das
Bankett dauerte bis zum Abend. - Die Synagoge ist ein schöner schlichter
Kuppelbau, nach den Plänen des Herrn Architekten Louv, Mühlhausen, von
der Firma Simon hier ausgeführt. Die innere Einrichtung lieferten Herr
Architekt Lehr und das Baugeschäft Groß hier. Das Parochet, die
Schulchan. Decke, ein Torarollen - Mäntelchen und die Menora sind aus dem
Atelier des Herrn Bloch, Strassburg." |
| |
 Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 15. März 1907: Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"
vom 15. März 1907:
weiterer Bericht zur Synagogeneinweihung: zum Lesen bitte
Textabbildungen anklicken |
 |
Aus dem gottesdienstlichen Leben in St. Ludwig liegen nur wenige Berichte
hervor. 1908 erfährt man von einer religiösen Feier in der Synagoge
zum Kaisergeburtstag:
 Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 31. Januar
1908: "St. Ludwig. Kaisergeburtstagsfeier. In der letzten
Sitzung des Kriegervereins wurde beschlossen, am Kaisergeburtstag der
religiösen Feier in der Synagoge beizuwohnen. Am Montag Morgen um 10 Uhr
versammelte sich dieser Verein, dem sich die Mitglieder des hiesigen
Bahnbeamten Vereins und noch ein größerer Teil der hiesigen
Bürgerschaft anschlossen, unter Musikklängen in unserem Gotteshaus. Der
Chor, geleitet von Herrn Kantor Lehmann, begann die Feier mit 'Ma towu',
worauf die Musikkapelle 'St. Ludwig' 'Die Himmel rühmen' ertönen
ließ. Anknüpfend an die Worte des weisen Königs Salomo 'Ehrfüchte,
mein Sohn, Gott und den KönigÄ schilderte unser Rabbiner, Herr Dr.
Schüler, die Bedeutung des Tages, und mit begeisterten und zündenden
Worten ermahnte er die in dem Gotteshause versammelten Konfessionen
gemeinsam, verbrüdert unter dem Schirmherr des deutschen Reiches, unter
dem Sprößling des großen Hohenzollerngeschlechtes mit Gott für Kaiser
und Reich zu arbeiten. Die von Herzen kommenden Worte drangen zu Herzen.
Nachdem der Kantor unter 'Wajhi Binssoa'-Gesange die Torarolle ausgehoben
hatte, wurden die Psalmen 21, 61 und 112 rezitiert, worauf der Rabbiner
das Kaisergebiet sprach, und im Anschluss an dasselbe intonierte die Musik
'Heil Dir im Siegerkranz'. Mit abermaligem Gesange schloss der würdige
und imposante Gottesdienst. Artikel
im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 31. Januar
1908: "St. Ludwig. Kaisergeburtstagsfeier. In der letzten
Sitzung des Kriegervereins wurde beschlossen, am Kaisergeburtstag der
religiösen Feier in der Synagoge beizuwohnen. Am Montag Morgen um 10 Uhr
versammelte sich dieser Verein, dem sich die Mitglieder des hiesigen
Bahnbeamten Vereins und noch ein größerer Teil der hiesigen
Bürgerschaft anschlossen, unter Musikklängen in unserem Gotteshaus. Der
Chor, geleitet von Herrn Kantor Lehmann, begann die Feier mit 'Ma towu',
worauf die Musikkapelle 'St. Ludwig' 'Die Himmel rühmen' ertönen
ließ. Anknüpfend an die Worte des weisen Königs Salomo 'Ehrfüchte,
mein Sohn, Gott und den KönigÄ schilderte unser Rabbiner, Herr Dr.
Schüler, die Bedeutung des Tages, und mit begeisterten und zündenden
Worten ermahnte er die in dem Gotteshause versammelten Konfessionen
gemeinsam, verbrüdert unter dem Schirmherr des deutschen Reiches, unter
dem Sprößling des großen Hohenzollerngeschlechtes mit Gott für Kaiser
und Reich zu arbeiten. Die von Herzen kommenden Worte drangen zu Herzen.
Nachdem der Kantor unter 'Wajhi Binssoa'-Gesange die Torarolle ausgehoben
hatte, wurden die Psalmen 21, 61 und 112 rezitiert, worauf der Rabbiner
das Kaisergebiet sprach, und im Anschluss an dasselbe intonierte die Musik
'Heil Dir im Siegerkranz'. Mit abermaligem Gesange schloss der würdige
und imposante Gottesdienst.
Diese recht schöne und erhebende Feier, welche von neuem ein glänzendes
Zeugnis der Eintracht unserer friedensliebenden Bürgerschaft ist, wird
lange bei uns in Andenken bleiben." |
Nach der Deportation der jüdischen Gemeindeglieder
1940 wurde die Synagoge in der NS-Zeit verwüstet, aber nicht zerstört.
Nach 1945 wurde die Synagoge wieder in Betrieb
genommen. Der 1934 erstellte Anbau zur Vergrößerung des Betsaales wurde bis
1963 als Gemeinde- und Jugendzentrum sowie im Winter als Wintersynagoge
verwendet. 1963 konnte ein neues Gemeindezentrum unweit der Synagoge eröffnet
werden.
Adresse/Standort der Synagoge: Rue de la
Synagogue 5
Fotos
(Hahn, Aufnahmedatum 3.6.2007)
Historische
Aufnahme vom Tag
der Einweihung der Synagoge 1907 |
 |
 |
| |
|
Weitere
historische Aufnahme aus der
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg |
| |
|
|
Ansichten der
Synagoge
an der Rue de la Synagogue |
 |
 |
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
 |
| Straßenschild an
der Synagoge |
Eingangsportal mit
Gebotstafeln |
Westfassade mit
Eingangsportal |
| |
|
|
 |
 |
 |
| In der Synagoge -
Blick zum Toraschrein |
Innenansichten
von der Frauenempore |
| |
|
 |
 |
 |
Der
Toraschrein enthält wertvolle, teilweise sehr alte Torarollen und
Toraschmuck aus verschiedenen Gemeinden des Elsass,
darunter auch ein Jad
(Torazeiger) aus Hegenheim und ein Tass (Toraschild) aus
Durmenach |
| |
 |
 |
 |
Leuchter zur
Erinnerung an die
6 Millionen Toten während der Shoa |
Kleiner Leuchter -
aus einem Flüchtlingslager
in der Schweiz (1944/45) |
Großer Leuchter
im Betsaal
über der Bima |
| |
|
|
 |
 |
 |
Ständer für
Zedakabüchsen
aus der Synagoge Hegenheim |
Stuhl des
Propheten Elia
(wird bei Beschneidungen gebraucht) |
Misrachfenster
über dem Toraschrein
mit den Geboten |
| |
|
|
| |
 |
|
| |
Brunnen im Vorraum |
|
| |
|
|
| |
|
|
Die
100-Jahr-Feier des Bestehens der Synagoge am 3. Juni 2007
Centenaire 1907-2007 de la Synagogue de Saint-Louis |
|
 |
 |
 |
| Vor
der Feier: Mincha-Gebet |
|
| |
|
 |
 |
 |
| Unter
den Gästen: mehrere Rabbiner aus dem Elsass |
| |
 |
 |
 |
| Oberrabbiner Jacky
Dreyfus im Gespräch |
Ehrengäste in der
ersten Reihe |
Mitglieder des
Synagogenchores aus Colmar |
| |
|
|
 |
 |
 |
Begrüßung durch
den Vorsitzenden
der jüdischen Gemeinde Gérard Meyer |
Chasan Alcan
Hayoun singt zu Beginn:
Borouch Habo, Retsei |
Ansprache durch
den Vorsitzenden
des Konsistorium |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Die
Gruppe des Synagogenchores aus Colmar singt: Ma tovou sowie Zocharti
Loch |
Die Chor der
Schule Néîr LeMoshé unter Leitung
von S. Weill: Schéyiboné Beiss
Hamikdosch |
| |
| |
|
 |
 |
 |
Ansprache von
Rabbiner Marc Meyer |
Ansprache von
Rabbiner Raphael Breisacher |
Ansprache des
Oberrabbiners
(Grand Rabbin) Jacky Dreyfus |
| |
|
|
 |
 |
 |
Eine Gruppe der
Jeschiwa singt unter
Leitung von Jean Schwab: Eïne Kélokeïnou |
Abschließender
Chor durch die Gruppe
des Synagogenchores Colmar: Seou Scheorim |
Vertreter der
Kirche und der
bürgerlichen Gemeinde |
| |
|
|
 |
 |
Segenssprüche
am geöffneten Toraschrein durch Rabbiner Marc Meyer,
Rabbiner Raphael
Breisacher und Oberrabbiner Jacky Dreyfus |
Chasan Akcan
Hayoun:
Eïne Aroch Lecha |
| |
|
| |
 |
 |
| |
Im
Anschluss an die Feier vor der Synagoge |
| |
|
 |
 |
 |
| Anschließende
Einladung in das Gemeindezentrum zu einem Empfang |
| |
|
|
 |
 |
 |
Besuch der Jeschiwa
in St. Louis
"Jeschiwat Or HaTalmud" |
Studier-
und Betsaal der Jeschiwa |
| |
| |
|
| |
 |
|
| |
Gleichfalls im
Gebäude der Jeschiwa -
ein koscherer Einkaufsladen |
|
| |
|
|
Weitere
Fotos zu demselben Ereignis
(Copyright: David Fishman; permission granted for Alemannia
Judaica) |
|
 |
 |
 |
Vor der Feier:
Gäste treffen ein |
In der Synagoge -
von der
Rabbinerbank aus gesehen |
Junge Besucher des
Festtages |
| |
|
|
 |
 |
 |
Die Chor der
Schule Néîr LeMoshé unter
Leitung von S. Weill |
Eine Gruppe der
Jeschiwa singt
unter Leitung von Jean Schwab |
Nach der Feier
vor
der Synagoge |
| |
|
|
 |
 |
|
| |
Auf dem Weg in das
Gemeindehaus |
|
Links und Literatur
Links:
Literatur:
 |
 Broschüre
zum 100jährigen Bestehen der Synagoge: Centenaire 1907-2007 de la Synagogue de Saint-Louis.
La Communauté Israélite de Saint-Louis, son origine, son extension, son avenir.
Selbstverlag der Gemeinde 2007. Broschüre
zum 100jährigen Bestehen der Synagoge: Centenaire 1907-2007 de la Synagogue de Saint-Louis.
La Communauté Israélite de Saint-Louis, son origine, son extension, son avenir.
Selbstverlag der Gemeinde 2007.
|



vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge
|